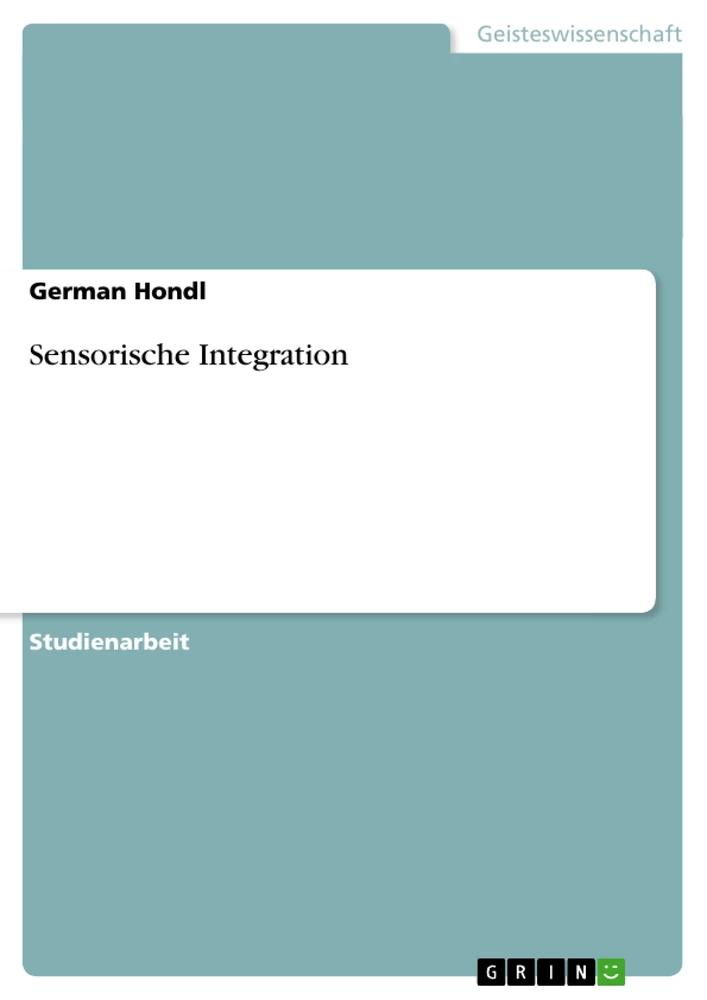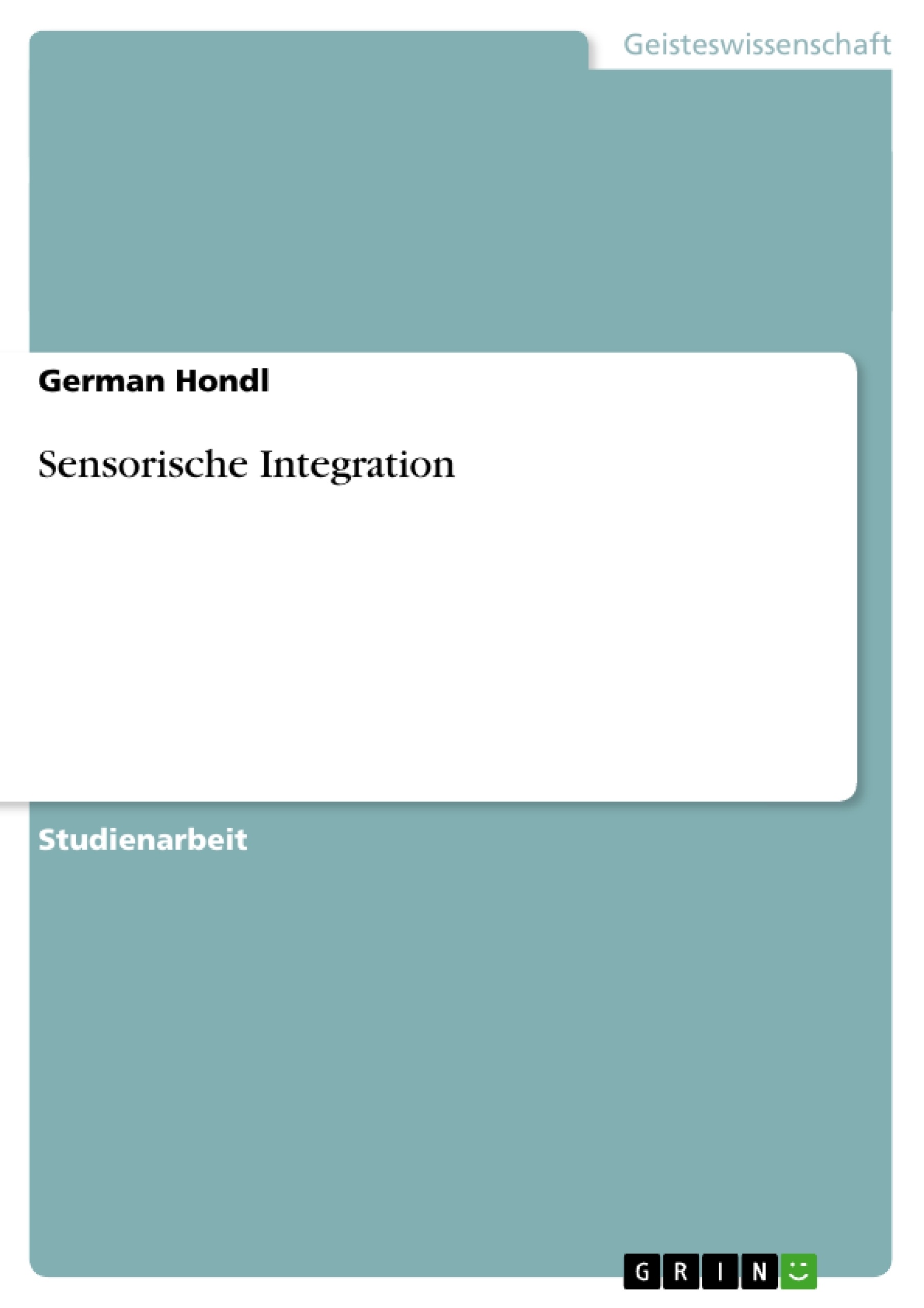Wie der Titel schon sagt, möchte sich diese Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie mit dem Thema "Sensorische Integration" näher auseinandersetzen. Interessant und aufschlussreich ist die "Sensorische Integration" nicht nur im Hinblick auf die "normale" gesunde Entwicklung eines Kindes von Geburt an - vielmehr lassen sich eine mittlerweile für eine Vielzahl von unterschiedlichsten Lern- und Verhaltensstörungen (Dyskalkulie, Legasthenie, ADHS, usw.) im Kindesalter eine Störung auf der Ebene der Sensorischen Integration als sog. Primärstörung diagnostizieren. Eine Einsicht die für Mediziner, Psychologen und Pädagogen in gleichem Maße bei ihrer täglichen Arbeit und Therapie mit betroffenen Kindern von Nutzen ist. Somit sollte es eine Selbstverständlichkeit darstellen mit den Grundlagen der Sensorischen Integration, sowie Diagnostik und Förderung bei auftretenden Dysfunktionen zumindest Grundzügen vertraut zu sein. Deshalb wird im folgenden Hauptteil der Versuch unternommen die Sensorische Integration hinreichend zu definieren und deren Entwicklung auf den verschiedenen Ebenen einzuführen. Um einen möglichst nahen Bezug zur Praxis geht es dann bei der Darstellung und Auswirkungen verschiedener Störung auf dem Gebiet des Verhaltens und Lernens (Lesen, Schreiben und Rechnen). Abschließend möchte diese Arbeit zu dem Faktor "Psychosoziale Einflüsse und Entwicklung" Stellung beziehen und einige interessante Thesen verifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Sensorische Integration und Entwicklung
- 2. Entwicklung auf vier Ebenen
- 2.1 Neuronale Ebene
- 2.2 Sensorische Ebene
- 2.3 Kognitive Ebene
- 2.4 Motorische Ebene
- 3. Verhaltens- und Konzentrationsstörungen
- 3.1 Kinder mit taktiler Überempfindlichkeit
- 3.2 Kinder mit vestibulärer Unterempfindlichkeit
- 4. Lernstörungen
- 4.1 Lese- und Rechtsschreibschwäche
- 4.2 Rechenschwäche
- 5. Psychosoziale Einflüsse auf die Entwicklung
- 5.1 Beurteilung des sozialen Umfeldes
- 5.2 Bedeutsame Elemente der Interaktion
- 5.3 Einflüsse auf das Betreuungsverhalten
- 5.4 Veränderung der Interaktion durch Beeinträchtigung des Kindes
- III. Schlussgedanke
- IV. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Sensorische Integration im Kindesalter und deren Auswirkungen auf die Entwicklung. Ziel ist es, die Grundlagen der Sensorischen Integration zu erläutern und deren Bedeutung für Lern- und Verhaltensstörungen aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sensorischen Integrationsprozessen und verschiedenen Entwicklungsebenen.
- Sensorische Integration und ihre Entwicklung
- Auswirkungen von sensorischen Integrationsstörungen auf Verhalten und Lernen
- Verschiedene Ebenen der sensorischen Integrationsentwicklung (neuronal, sensorisch, kognitiv, motorisch)
- Lernstörungen im Zusammenhang mit sensorischen Integrationsstörungen
- Psychosoziale Einflüsse auf die Entwicklung im Kontext sensorischer Integration
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sensorische Integration ein und beschreibt deren Relevanz für die Entwicklungspsychologie, insbesondere im Hinblick auf Lern- und Verhaltensstörungen wie Dyskalkulie, Legasthenie und ADHS. Es wird die Bedeutung eines grundlegenden Verständnisses der Sensorischen Integration für Mediziner, Psychologen und Pädagogen hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit skizziert, der die Definition der Sensorischen Integration, die Darstellung ihrer Entwicklung auf verschiedenen Ebenen und die Auswirkungen von Störungen auf Verhalten und Lernen umfasst. Schließlich wird der Einfluss psychosozialer Faktoren auf die Entwicklung thematisiert.
II. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit einer Definition der Sensorischen Integration als sinnvolle Ordnung und Verarbeitung von Sinnesreizen im Gehirn. Er erklärt den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Kognition und betont die Rolle der Sensorischen Integration beim Lernen. Die Entstehung von Lernstörungen wird mit Störungen der Sensorischen Integration in Verbindung gebracht. Der Hauptteil beschreibt anschließend die Entwicklung der Sensorischen Integration auf vier Ebenen: neuronal, sensorisch, kognitiv und motorisch. Er betont, dass eine Störung auf einer Ebene das gesamte System beeinträchtigen kann. Anschließend werden Verhaltens- und Konzentrationsstörungen, sowie Lernstörungen (Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche) im Zusammenhang mit sensorischen Integrationsstörungen behandelt. Der Abschnitt schließt mit einer Betrachtung psychosozialer Einflüsse auf die Entwicklung und deren Interaktion mit sensorischen Integrationsstörungen ab. Hier werden Aspekte wie die Beurteilung des sozialen Umfeldes, bedeutsame Elemente der Interaktion, Einflüsse auf das Betreuungsverhalten und die Veränderung der Interaktion durch Beeinträchtigungen des Kindes diskutiert.
Schlüsselwörter
Sensorische Integration, Entwicklungspsychologie, Lernstörungen, Verhaltensstörungen, Neuronale Ebene, Sensorische Ebene, Kognitive Ebene, Motorische Ebene, taktile Überempfindlichkeit, vestibuläre Unterempfindlichkeit, Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS, Psychosoziale Einflüsse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sensorische Integration im Kindesalter und deren Auswirkungen auf die Entwicklung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Sensorische Integration im Kindesalter und ihren Auswirkungen auf die Entwicklung. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierten Unterkapiteln, einen Schlussgedanken und ein Literaturverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der Grundlagen der Sensorischen Integration und der Darstellung ihrer Bedeutung für Lern- und Verhaltensstörungen.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil der Arbeit behandelt die Sensorische Integration und ihre Entwicklung auf vier Ebenen: neuronal, sensorisch, kognitiv und motorisch. Es werden Verhaltens- und Konzentrationsstörungen, sowie Lernstörungen wie Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche im Zusammenhang mit sensorischen Integrationsstörungen analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den psychosozialen Einflüssen auf die Entwicklung im Kontext sensorischer Integration, einschließlich der Beurteilung des sozialen Umfeldes und der Interaktion mit dem Kind.
Welche Lernstörungen werden im Zusammenhang mit sensorischen Integrationsstörungen diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie) und Rechenschwäche (Dyskalkulie) im Zusammenhang mit sensorischen Integrationsstörungen. Der Zusammenhang zwischen diesen Lernstörungen und Problemen in der sensorischen Integration wird untersucht.
Welche Verhaltens- und Konzentrationsstörungen werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt Verhaltens- und Konzentrationsstörungen im Allgemeinen und geht spezifisch auf Kinder mit taktiler Überempfindlichkeit und Kinder mit vestibulärer Unterempfindlichkeit ein, um die Auswirkungen von sensorischen Integrationsstörungen auf das Verhalten zu verdeutlichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt: eine Einleitung, einen Hauptteil mit verschiedenen Unterkapiteln zu den genannten Themen, einen Schlussgedanken und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die Struktur und die einzelnen Kapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Grundlagen der Sensorischen Integration zu erläutern und deren Bedeutung für Lern- und Verhaltensstörungen aufzuzeigen. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen sensorischen Integrationsprozessen und verschiedenen Entwicklungsebenen (neuronal, sensorisch, kognitiv, motorisch).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Sensorische Integration, Entwicklungspsychologie, Lernstörungen, Verhaltensstörungen, Neuronale Ebene, Sensorische Ebene, Kognitive Ebene, Motorische Ebene, taktile Überempfindlichkeit, vestibuläre Unterempfindlichkeit, Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS, Psychosoziale Einflüsse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Mediziner, Psychologen und Pädagogen, die ein grundlegendes Verständnis der Sensorischen Integration benötigen, um Lern- und Verhaltensstörungen besser zu verstehen und zu behandeln.
Welche psychosozialen Einflüsse werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Beurteilung des sozialen Umfeldes, bedeutsame Elemente der Interaktion zwischen Kind und Bezugspersonen, Einflüsse auf das Betreuungsverhalten und die Veränderung der Interaktion durch Beeinträchtigungen des Kindes als psychosoziale Einflüsse auf die Entwicklung im Kontext sensorischer Integration.
- Quote paper
- German Hondl (Author), 2003, Sensorische Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18416