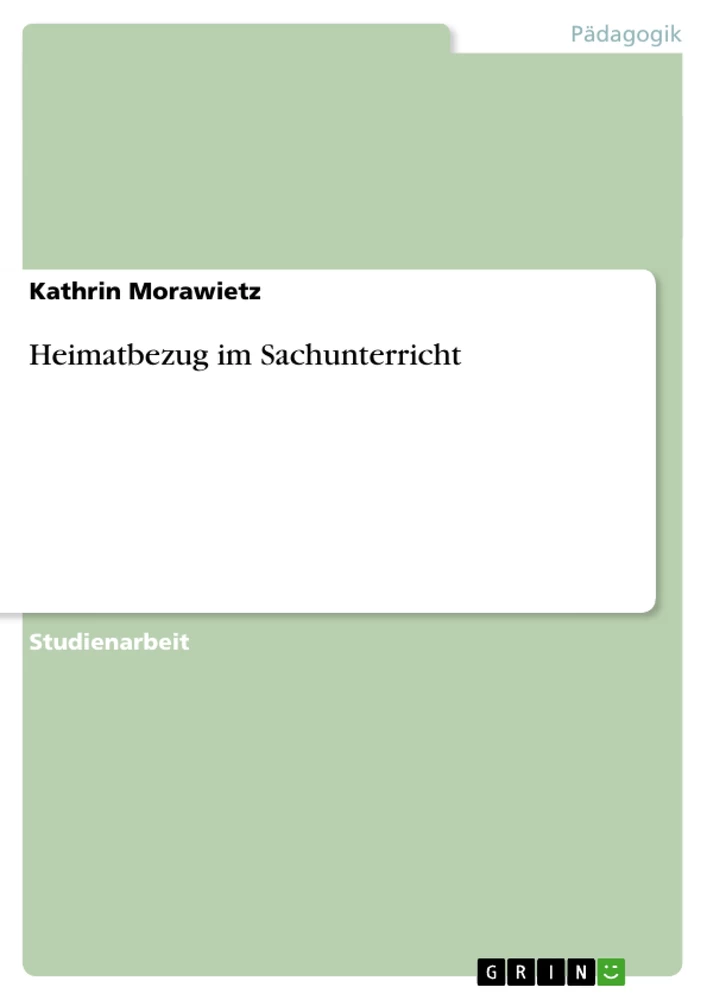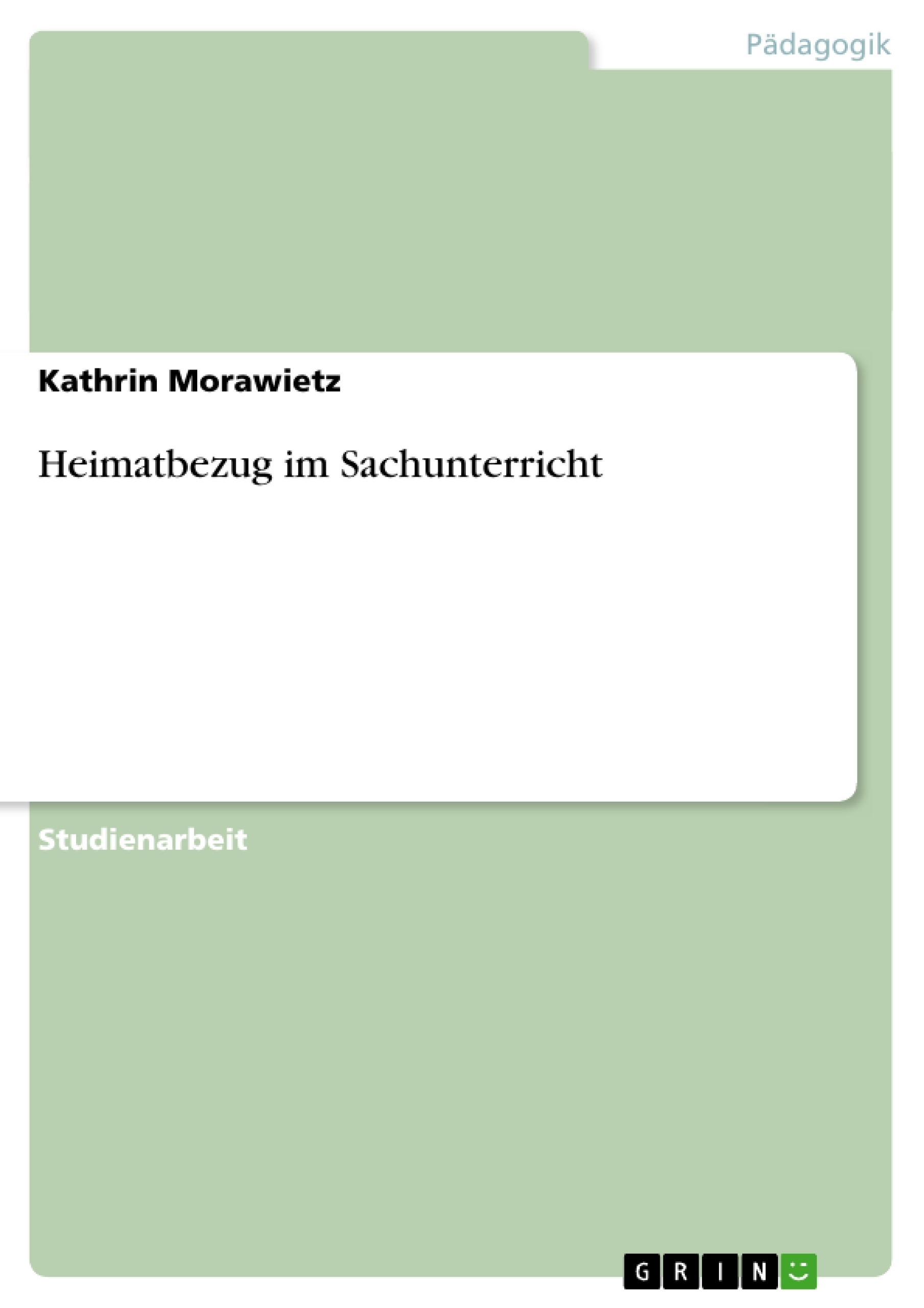Für das Kind stellt die Heimat zunächst etwas Selbstverständliches dar. Es erlebt
Heimat unreflektiert als ein „Eingebettetsein in das Wohlwollen der Mitmenschen,
besonders der Familienmitglieder (...) und in der Übernahme der Gefühlsreaktionen
und Stimmungen der Erwachsenen“. (Gärtner, Friedrich: Neuzeitliche Heimatkunde.
Der ungefächerte Sachunterricht der Grundschule. 4. Auflage, München: Ehrenwirth
Verlag 1963, Seite 13)
Um dem Alltäglichen eine besondere Bedeutung zu verleihen, muss man sich mit
dem Selbstverständlichen immer wieder aktiv auseinandersetzten und es ins Bewusstsein
der Kinder rufen.
„Objektiv betrachtet bezeichnen wir mit Heimat einen räumlichen Ausschnitt aus der
Wirklichkeit, der im Umkreis der Geburtsstätte, des Kindheitsaufenthaltes oder des
Wahlwohnortes eines Menschen gelegen ist, mit allen Natur- und Kulturgegebenheiten,
mit allen leblosen Dingen und allen Lebewesen.“ (GÄRTNER 1963, Seite 14)
Man bezeichnet einen solchen Ausschnitt auch als Gegend und „die Heimat eines
Menschen ist objektiv gesehen eine bestimmte Gegend“ (GÄRTNER 1963, Seite 14)
Im Heimatkundeunterricht nach 1945 musste man diese Gegend erwandern können,
um die Grenzen der Heimat festzulegen. Unterricht, der sich mit fremden Räumen
beschäftigte, die nicht mehr unmittelbar erfahren werden konnten, war eigentlich der
Erdkundeunterricht. Jeder Mensch legt den Umfang seiner heimatlichen Gegend jedoch
selbst fest. So stellen bestimmte Gegenden auch nur für bestimmte Menschen,
die eine besondere Beziehung zur dieser Gegend haben, eine Heimat dar. Für alle
anderen handelt es sich bei dieser Gegend tatsächlich nur um eine Gegend, einen
Raum oder eine Landschaft, nicht jedoch um Heimat. Die Bindung des Menschen an
eine bestimmte Gegend ist die subjektiv-emotionale Seite des Heimatbegriffs, die
man auch mit „Heimatliebe, Heimattreue, Heimatverbundenheit, Heimatgefühl,
Heimaterlebnis“ (GÄRTNER 1963, Seite 16) bezeichnen kann. Heimat ist ein fester
Bezugspunkt des Menschen. Insbesondere in unserer Zeit besteht bei den Kindern
das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, denn „Heimatlosigkeit“ ist ein
Kennzeichen des modernen Menschen. Das Lebensgefühl der heutigen Zeit drückt
sich häufig im Heimatverlust als „Preis des Fortschritts“ (Klein, Heinrich: Heimat und
Heimatkunde. Anthropologische Grundlagen, didaktische Überlegungen, Unterrichtsbeispiele.
1. Auflage, Landau: Knecht 1998, Seite 27) aus. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Der Heimatbegriff – Was ist Heimat eigentlich?
- 2. Die Entstehung der Heimatkunde
- 3. Heimatgeschichte und Regionalgeschichte in der DDR bis 1990
- 4. Die traditionelle Heimatkunde
- 5. Das Heimatprinzip
- 6. Der traditionelle Heimatkundelehrer
- 7. Kritik an der Heimatkunde
- 8. Der neue Sachunterricht
- 9. Heimatbezug im heutigen Sachunterricht
- 10. Die Aufgabe des modernen Heimatkundeunterrichts
- 11. Der Heimatbezug im Lehrplan für den Sachunterricht der Grundschule (RLP)
- 12. Ist Heimatgeschichte heute noch aktuell?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Heimatbegriffs und seine Bedeutung im Sachunterricht. Sie analysiert die Entstehung der Heimatkunde, ihre traditionellen Inhalte und die Kritik daran. Zudem werden die Herausforderungen des modernen Sachunterrichts im Hinblick auf den Heimatbezug erörtert.
- Entwicklung des Heimatbegriffs
- Traditionelle und moderne Konzepte der Heimatkunde
- Kritik an der Heimatkunde
- Heimatbezug im Sachunterricht
- Die Bedeutung des Heimatbegriffs in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Das Kapitel definiert den Heimatbegriff und untersucht seine Vielschichtigkeit, insbesondere im Hinblick auf die subjektiv-emotionale Seite. Es werden die Herausforderungen des Heimatverlusts in der modernen Gesellschaft beleuchtet.
- Kapitel 2: Die Entstehung der Heimatkunde als Unterrichtsprinzip und die didaktischen Überlegungen von Christian Wilhelm Harnisch werden vorgestellt. Der Beitrag von Friedrich August Finger zur Weiterentwicklung des Heimatbegriffs wird ebenfalls analysiert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel betrachtet die Entwicklung der Heimatkunde und Regionalgeschichte in der DDR bis 1990.
- Kapitel 4: Die traditionelle Heimatkunde wird hinsichtlich ihrer Inhalte und Methoden untersucht.
- Kapitel 5: Das Kapitel befasst sich mit dem Heimatprinzip und seiner Bedeutung für den Unterricht.
- Kapitel 6: Die Rolle und die Herausforderungen des traditionellen Heimatkundelehrers werden beleuchtet.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel stellt die Kritik an der Heimatkunde dar, die aus verschiedenen Perspektiven geäußert wird.
- Kapitel 8: Der neue Sachunterricht und seine Bedeutung für den Heimatbezug werden vorgestellt.
- Kapitel 9: Der Heimatbezug im heutigen Sachunterricht wird im Kontext der aktuellen pädagogischen Diskussionen und der Bedeutung für die Schülerentwicklung betrachtet.
- Kapitel 10: Die Aufgabe des modernen Heimatkundeunterrichts im Hinblick auf die Vermittlung von Heimatgefühl und Orientierung in der heutigen Welt wird beleuchtet.
- Kapitel 11: Die Umsetzung des Heimatbegriffs im Lehrplan für den Sachunterricht der Grundschule in Rheinland-Pfalz wird analysiert.
- Kapitel 12: Die aktuelle Relevanz der Heimatgeschichte wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Heimatkunde, Heimatbegriff, Sachunterricht, Heimatbezug, Tradition, Moderne, Kritik, Lehrplan, Regionalgeschichte, Bildung, Identität, Gesellschaft, Wandel, Fortschritt, Heimatverlust, Vertrautheit, Lebensraum, Anschauung, Didaktik, Methoden, Unterrichtsprinzip.
- Quote paper
- Kathrin Morawietz (Author), 2003, Heimatbezug im Sachunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18394