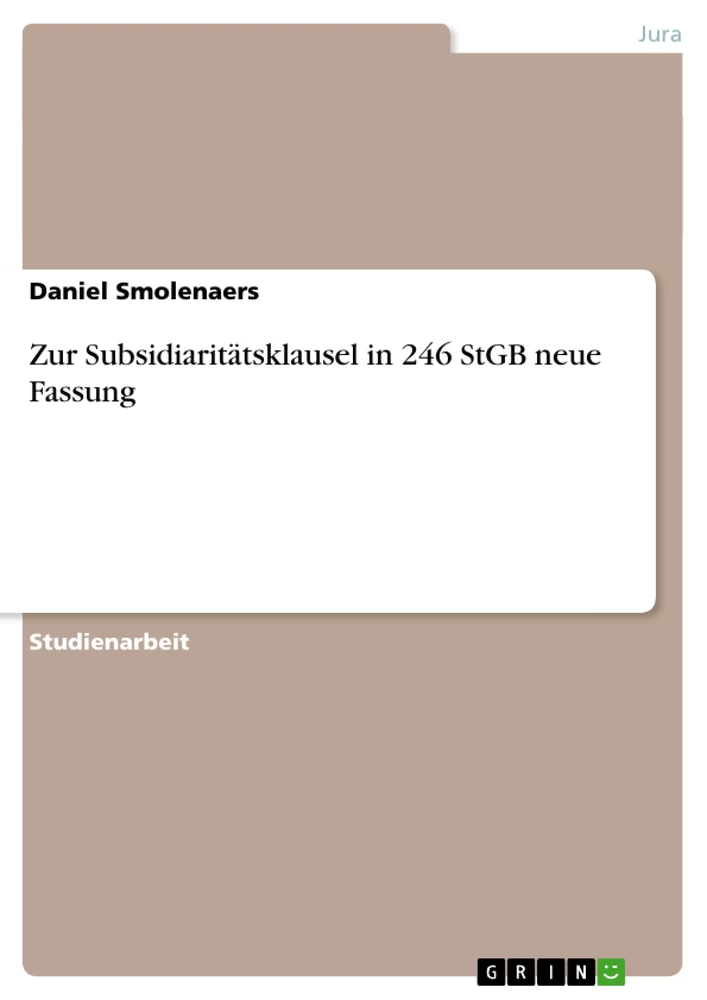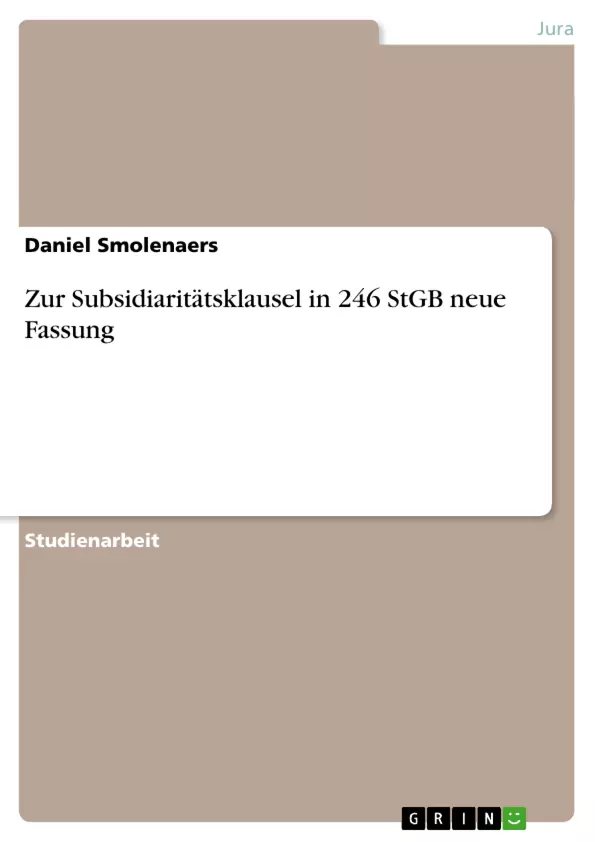Durch das am 01.04.1999 in Kraft getretene 6. Strafrechtsreformgesetz wurde auch §246 StGB Änderungen unterworfen. Das vom Gesetzgeber intendierte Ziel lag darin, Strafbarkeitslücken zu schließen und bestehende Auslegungsschwierigkeiten zu beseitigen. Diese Änderungen haben dazu geführt, dass unter anderem der Tatbestand des Unterschlagung einer der am stärksten reformierten Vorschriften ist. Der erste Absatz der Norm in seiner bisherigen Fassung lautete:
„Wer eine fremde bewegliche Sache, die er im Besitz oder Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Sache ihm anvertraut ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
Absatz eins in seiner neuen Fassung lautet hingegen:
„Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.“
Zum einen ist demnach das Erfordernis des Besitzes oder des Gewahrsams weggefallen, des weiteren wurde eine Subsidiaritätsklausel eingeführt. Doch genau diese Subsidiaritätsklausel in Absatz eins der Vorschrift wird zum teil heftig diskutiert, wobei deren Auslegungsprobleme und Auswirkungen auf verschiedene Tatbestandsmerkmale des §246 StGB noch nicht vollständig überblickt sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Die Gesetzesbegründung
- III. Der "Tatbegriff" der Subsidiaritätsklausel
- IV. Was bedeutet die Bezeichnung "andere Vorschrift" in §246 I StGB?
- V. Wann ist die Tat in einer anderen Vorschrift mit "schwerere Strafe bedroht"?
- VI. Allgemeine oder spezielle Auslegung der Subsidiaritätsklausel?
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Überlegungen nach Jescheck/Weigend
- 3. Die "frühere" Auffassung des BGH
- 4. Die Auffassung des BGH zur gleichlautenden Subsidiaritätsklausel des §125 StGB
- 5. Kritik an BGHSt 43, 237f. durch Rudolphi
- 6. Stellungnahme zu Rudolphi
- 7. Kritik an BGHSt 43, 237f. durch Mitsch
- 8. Stellungnahme zu Mitsch
- 9. Kritik an BGHSt 43, 237f. auch von Wagner
- 10. Stellungnahme zu Wagner
- 11. Gegenargument Maurach/Schroeder/Maiwald
- 12. Die "neueste" Entscheidung des BGH zur Subsidiaritätsklausel in §246 StGB
- 13. Stellungnahme zur neuen BGH Rechtsprechung
- VII. Anwendung der Subsidiaritätsklausel auf die Gleichzeitigkeitsfälle?
- 1. Die bisherige Rechtsprechung des Großen Senates des BGH zu §246 StGB a.F.
- 2. Keine Vereinbarkeit dieser Annahme tatbestandlicher Subsidiarität durch den BGH mit der Subsidiaritätsklausel in §246 StGB n.F.?
- 3. Kritik an der Auffassung der h.L. durch Krey
- 4. Stellungnahme
- VIII. Wie wirkt sich die Einführung der Subsidiaritätsklausel auf die Möglichkeit der wiederholten Zueignung aus?
- 1. Tatbestandslösung
- 2. Konkurrenzlösung
- 3. Zur Beeinflussung durch die Subsidiaritätsklausel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Subsidiaritätsklausel in §246 Absatz 1 StGB n.F. Ziel ist es, die Auslegung und Anwendung dieser Klausel im Kontext verschiedener Rechtsprechungsentscheidungen und wissenschaftlicher Meinungen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Problematik der konkurrierenden Delikte und der Auswirkung auf die wiederholte Zueignung.
- Auslegung des "Tatbegriffs" in der Subsidiaritätsklausel
- Bedeutung der Formulierung "andere Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht"
- Allgemeine vs. spezielle Auslegung der Subsidiaritätsklausel
- Anwendung auf Gleichzeitigkeitsfälle
- Auswirkungen auf die wiederholte Zueignung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik der Subsidiaritätsklausel in §246 StGB n.F. und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit. Es legt den Fokus auf die Bedeutung der Klausel für die Strafbarkeit von Vermögensdelikten.
II. Die Gesetzesbegründung: Dieses Kapitel analysiert die Entstehungsgeschichte und die Intentionen des Gesetzgebers bei der Einführung der Subsidiaritätsklausel. Es untersucht die Begründung und die damit verbundenen Ziele der Gesetzesänderung. Die Analyse der Gesetzesmaterialien bietet einen wichtigen Kontext für die nachfolgende juristische Auseinandersetzung.
III. Der "Tatbegriff" der Subsidiaritätsklausel: Hier wird der zentrale Begriff des "Tatbegriffs" im Kontext der Subsidiaritätsklausel eingehend untersucht. Es wird analysiert, welche Handlungen unter den Tatbegriff fallen und welche nicht. Dies ist essenziell für die Anwendung der Klausel in der Praxis. Die unterschiedlichen Interpretationen des Tatbegriffs werden kritisch beleuchtet.
IV. Was bedeutet die Bezeichnung "andere Vorschrift" in §246 I StGB?: Dieser Abschnitt beleuchtet die Auslegung des Begriffs "andere Vorschrift" im Detail. Die Arbeit untersucht welche anderen Strafvorschriften von der Subsidiaritätsklausel betroffen sind. Die Analyse umfasst die Abgrenzung zu ähnlichen Delikten und die Klärung von Unsicherheiten in der Gesetzesanwendung.
V. Wann ist die Tat in einer anderen Vorschrift mit "schwerere Strafe bedroht"?: Dieses Kapitel analysiert den Vergleich der Strafandrohungen verschiedener Delikte. Es geht um die Frage, wie "schwerere Strafe" zu definieren und zu vergleichen ist und welche Konsequenzen sich daraus für die Anwendung der Subsidiaritätsklausel ergeben. Es werden verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
VI. Allgemeine oder spezielle Auslegung der Subsidiaritätsklausel?: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage der Auslegung der Subsidiaritätsklausel. Es werden unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze und die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) kritisch verglichen und analysiert. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Frage, ob eine allgemeine oder spezielle Auslegung der Klausel vorzuziehen ist. Die Argumentationslinien der verschiedenen Autoren und deren jeweilige Stärken und Schwächen werden im Detail dargestellt und bewertet. Die Entwicklung der Rechtsprechung des BGH wird nachvollzogen und eingeordnet.
VII. Anwendung der Subsidiaritätsklausel auf die Gleichzeitigkeitsfälle?: Hier wird die Anwendung der Subsidiaritätsklausel auf Fälle untersucht, in denen mehrere Delikte gleichzeitig begangen werden. Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung und die dazugehörige Literatur zum Thema und bietet eine differenzierte Betrachtung der Problematik. Es wird darauf eingegangen, wie die Klausel in solchen komplexen Sachverhalten anzuwenden ist. Die verschiedenen Meinungen in der Literatur werden kritisch gegenübergestellt und bewertet. Die Bedeutung der BGH-Rechtsprechung wird herausgestellt.
VIII. Wie wirkt sich die Einführung der Subsidiaritätsklausel auf die Möglichkeit der wiederholten Zueignung aus?: Das Kapitel untersucht die Auswirkung der Subsidiaritätsklausel auf die Frage der wiederholten Zueignung. Es werden verschiedene theoretische Ansätze und die Rechtsprechung dazu analysiert und bewertet. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Lösungsansätze der Literatur und die jeweilige Argumentation. Es wird ein Fazit gezogen, wie die Subsidiaritätsklausel die Problematik der wiederholten Zueignung beeinflusst.
Schlüsselwörter
Subsidiaritätsklausel, §246 StGB, Strafrecht, Vermögensdelikte, Unterschlagung, Konkurrenzen, Rechtsprechung, BGH, Tatbegriff, gleichzeitig begangene Delikte, wiederholte Zueignung, Gesetzesauslegung.
Häufig gestellte Fragen zur Subsidiaritätsklausel in §246 StGB n.F.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Subsidiaritätsklausel in §246 Absatz 1 StGB n.F. Sie untersucht die Auslegung und Anwendung dieser Klausel im Kontext verschiedener Rechtsprechungsentscheidungen und wissenschaftlicher Meinungen, insbesondere die Problematik konkurrierender Delikte und die Auswirkung auf die wiederholte Zueignung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Auslegung des "Tatbegriffs" in der Subsidiaritätsklausel; Bedeutung der Formulierung "andere Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht"; allgemeine vs. spezielle Auslegung der Subsidiaritätsklausel; Anwendung auf Gleichzeitigkeitsfälle; Auswirkungen auf die wiederholte Zueignung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einführung; Gesetzesbegründung; Der "Tatbegriff" der Subsidiaritätsklausel; Bedeutung von "andere Vorschrift" in §246 I StGB; Wann ist eine Tat in einer anderen Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht?; Allgemeine oder spezielle Auslegung der Subsidiaritätsklausel; Anwendung auf Gleichzeitigkeitsfälle; Auswirkungen der Subsidiaritätsklausel auf wiederholte Zueignung. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung und analysiert die jeweilige Thematik anhand von Rechtsprechung und Literatur.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Auslegung und Anwendung der Subsidiaritätsklausel in §246 StGB n.F. umfassend zu analysieren und die verschiedenen Interpretationen und Rechtsprechungslinien kritisch zu bewerten.
Welche Rechtsprechungsentscheidungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu §246 StGB, insbesondere die Entwicklung der Rechtsprechung zur Subsidiaritätsklausel und deren Anwendung auf verschiedene Konstellationen. Die Arbeit analysiert kritisch verschiedene Entscheidungen des BGH und deren Begründung.
Welche wissenschaftlichen Meinungen werden diskutiert?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene wissenschaftliche Meinungen und Interpretationen der Subsidiaritätsklausel. Es werden die Argumentationslinien von Autoren wie Jescheck/Weigend, Rudolphi, Mitsch, Wagner und Maurach/Schroeder/Maiwald analysiert und kritisch bewertet.
Wie wird der "Tatbegriff" in der Subsidiaritätsklausel ausgelegt?
Das Kapitel III untersucht den "Tatbegriff" der Subsidiaritätsklausel detailliert. Es analysiert, welche Handlungen unter diesen Begriff fallen und welche nicht, und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen in Rechtsprechung und Literatur kritisch.
Wie wird der Begriff "andere Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht" interpretiert?
Kapitel V analysiert den Vergleich der Strafandrohungen verschiedener Delikte. Es untersucht, wie "schwerere Strafe" definiert und verglichen wird und welche Konsequenzen sich daraus für die Anwendung der Subsidiaritätsklausel ergeben. Verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile werden diskutiert.
Wie wird die Subsidiaritätsklausel auf Gleichzeitigkeitsfälle angewendet?
Kapitel VII untersucht die Anwendung der Subsidiaritätsklausel auf Fälle, in denen mehrere Delikte gleichzeitig begangen werden. Die Rechtsprechung und Literatur zu diesem Thema werden analysiert, und es wird eine differenzierte Betrachtung der Problematik geboten.
Welche Auswirkungen hat die Subsidiaritätsklausel auf die wiederholte Zueignung?
Kapitel VIII analysiert die Auswirkungen der Subsidiaritätsklausel auf die Frage der wiederholten Zueignung. Es werden verschiedene theoretische Ansätze und die Rechtsprechung dazu analysiert und bewertet. Die Arbeit untersucht verschiedene Lösungsansätze der Literatur und die jeweilige Argumentation.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Subsidiaritätsklausel, §246 StGB, Strafrecht, Vermögensdelikte, Unterschlagung, Konkurrenzen, Rechtsprechung, BGH, Tatbegriff, gleichzeitig begangene Delikte, wiederholte Zueignung, Gesetzesauslegung.
- Quote paper
- Daniel Smolenaers (Author), 2002, Zur Subsidiaritätsklausel in 246 StGB neue Fassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18381