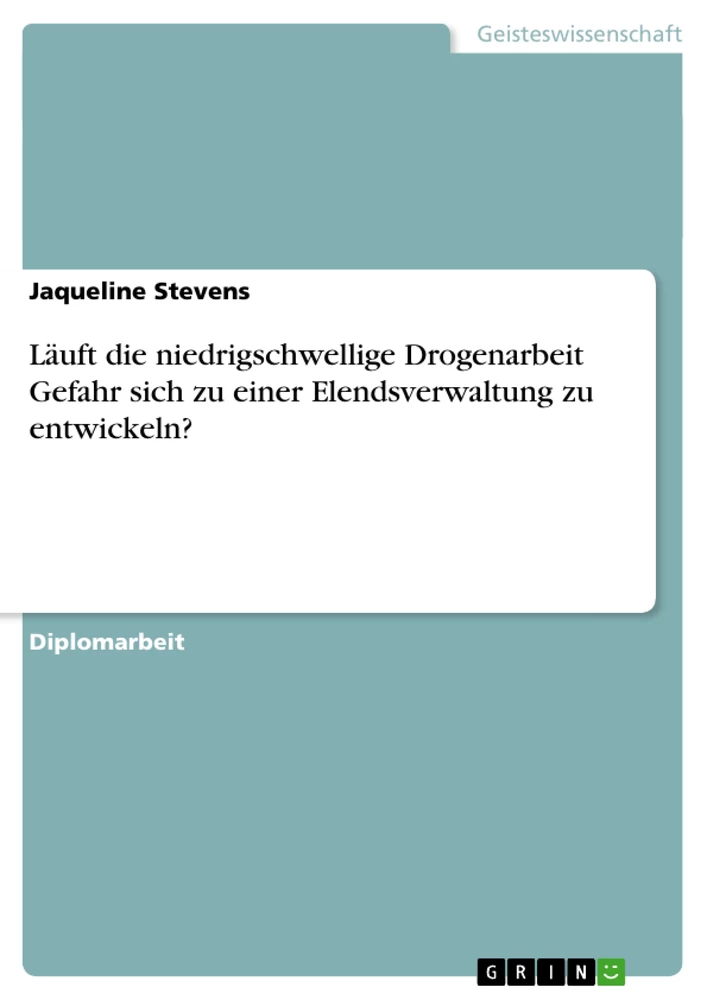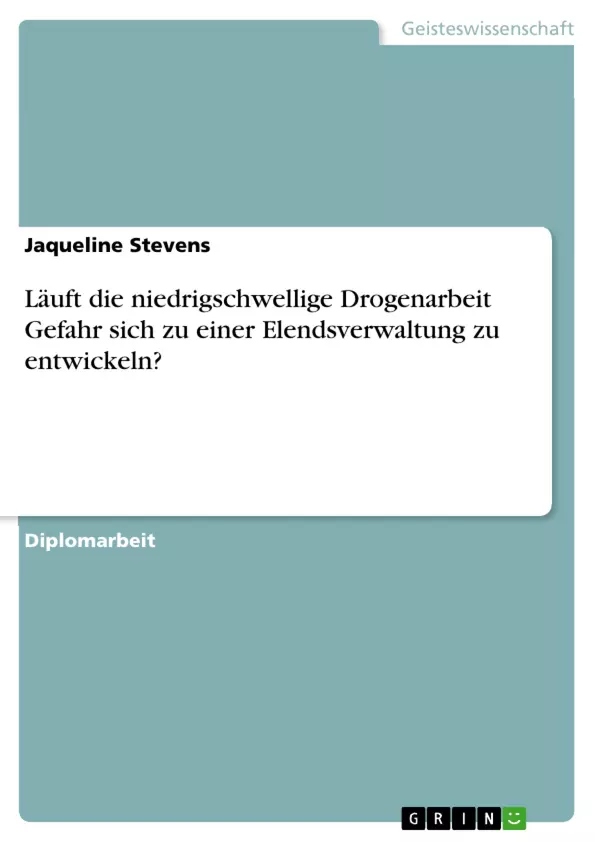In der Drogenhilfe und Drogenarbeit hat sich seit Anfang der 90 er Jahren viel bewegt. 20 Jahre nach dem Reformeifer wird nun in aktuellen Diskussionen der gegenwärtige Status quo der niedrigschwelligen Drogenarbeit hinterfragt. Reformpolitisch scheint man momentan an die Grenzen des Machbaren angelangt zu sein – Stichwort: Heroinvergabe. Es gibt zum Teil sogar Rückschritte, wie
beispielsweise die gesetzliche Herabsetzung des Eigenbedarfs in Nordrhein Westfalen zeigt. Wie steht es um die Praxis der niedrigeschwelligen Drogenarbeit? Ist die praktische Arbeit nach all den überlebenswichtigen Erfolgen methodisch ins Stocken geraten? Läuft die niedrigschwellige Drogenarbeit Gefahr sich zu einer Elendsverwaltung zu entwickeln? (vgl. BOSSONG 2008)
Diese Fragestellung ist Gegenstand dieser Arbeit. Im Fokus steht dabei die niedrigschwellige Drogenarbeit aus professioneller Sicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1. Drogen
- 2.2. Sucht und Abhängigkeit
- 2.2.1. Abhängigkeitsdefinition nach ICD 10
- 2.2.2. Drogenabhängigkeit als Krankheit
- 2.2.3. Ursachen von Drogenabhängigkeit
- 2.3. Niedrigschwellige akzeptanzorientierte Drogenarbeit?
- 3. Drogenpolitik – Drogenhilfe - Gesellschaft
- 3.1. Die Entwicklungen in der Drogenpolitik
- 3.1.1. Die historischen internationalen Entwicklungen als Ursprünge der nationalen Prohibitionspolitik
- 3.1.2. Der Umgang mit psychoaktiven Substanzen in Deutschland vor dem Opiumgesetz
- 3.1.3. Die Einführung des deutschen Opiumgesetzes
- 3.1.4. Vom Opiumgesetz zum Betäubungsmittelgesetz
- 3.2. Strukturen der gegenwärtigen Drogenpolitik
- 3.2.1. Aktive und reaktive Drogenkontrolle
- 3.2.2. Hauptstrategien der Drogenpolitik
- 3.3. Veränderungen in der Drogenhilfe
- 3.3.1. Suchtkrankenhilfe und Psychiatrie
- 3.3.2. Die Anfänge der Drogenarbeit - die Release-Bewegung
- 3.3.3. Die Professionalisierung und Institutionalisierung der Drogenhilfe
- 3.4. Drogenkonsumenten im öffentlichen Raum
- 4. Niedrigschwellige Drogenarbeit
- 4.1. Die Entstehung der akzeptanzorientierter Drogenarbeit
- 4.2. Prämissen, Zielsetzungen und Methoden
- 4.3. Angebote und Einrichtungen der niedrigschwelligen Drogenarbeit
- 4.4. Exkurs: Heroinvergabe
- 4.5. Die ordnungspolitische Dimension der niedrigschwelligen Drogenarbeit
- 5. Zur Bilanz niedrigschwelliger Drogenarbeit
- 5.1. Ökonomisierungstendenzen und Qualitätssicherung
- 5.2. Schadensminimierende Wirksamkeit niedrigschwelliger Angebote
- 5.3. Inanspruchnahme des niedrigschwelligen Hilfesystems
- 5.4. Grenzen und Defizite der niedrigschwelliger Drogenarbeit
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob niedrigschwellige Drogenarbeit Gefahr läuft, sich zu einer bloßen Elendsverwaltung zu entwickeln. Sie analysiert die Entwicklung der Drogenpolitik und -hilfe, den Wandel der niedrigschwelligen Ansätze und deren aktuelle Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der professionellen Perspektive der Drogenarbeit.
- Entwicklung der Drogenpolitik und -hilfe in Deutschland
- Entstehung und Methoden der niedrigschwelligen Drogenarbeit
- Wirksamkeit und Grenzen schadenmindernder Angebote
- Ökonomisierungstendenzen und Qualitätssicherung in der Drogenhilfe
- Gesellschaftliche Wahrnehmung von Drogenkonsum und -hilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 definiert zentrale Begriffe wie Drogen, Sucht und Abhängigkeit sowie niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit. Kapitel 3 beleuchtet die historischen und aktuellen Entwicklungen der Drogenpolitik und -hilfe in Deutschland, inklusive der gesellschaftlichen Dimension. Kapitel 4 beschreibt die Entstehung, Ziele und Methoden der niedrigschwelligen Drogenarbeit sowie deren Angebote und den ordnungspolitischen Aspekt. Kapitel 5 zieht eine Bilanz der niedrigschwelligen Drogenarbeit, betrachtet deren Wirksamkeit und Inanspruchnahme und analysiert Defizite und Grenzen.
Schlüsselwörter
Niedrigschwellige Drogenarbeit, Drogenpolitik, Drogenhilfe, Sucht, Abhängigkeit, Schadensminimierung, Akzeptanzorientierung, Ökonomisierung, Qualitätssicherung, Elendsverwaltung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „niedrigschwellige Drogenarbeit“?
Es handelt sich um akzeptanzorientierte Hilfsangebote, die ohne Abstinenzforderung den Zugang für Konsumenten erleichtern, um Überleben zu sichern und Schäden zu minimieren.
Was ist die zentrale Befürchtung bezüglich der „Elendsverwaltung“?
Die Arbeit hinterfragt, ob die Drogenhilfe methodisch stagniert und nur noch das Elend verwaltet, statt echte Fortschritte oder Reformen (wie die Heroinvergabe) voranzutreiben.
Wie hat sich die deutsche Drogenpolitik historisch entwickelt?
Die Arbeit beleuchtet den Weg von den internationalen Ursprüngen der Prohibition über das Opiumgesetz bis hin zum heutigen Betäubungsmittelgesetz.
Welche Rolle spielt die Ökonomisierung in der Drogenhilfe?
Es wird untersucht, wie Ökonomisierungstendenzen und Qualitätssicherungsmaßnahmen die praktische Arbeit der Einrichtungen beeinflussen.
Was war die „Release-Bewegung“?
Sie markiert die Anfänge der Drogenarbeit und leitete die Professionalisierung und Institutionalisierung der Hilfe ein.
Gibt es aktuell politische Rückschritte in der Drogenhilfe?
Ja, als Beispiel wird die gesetzliche Herabsetzung der Eigenbedarfsmenge in Nordrhein-Westfalen angeführt.
- Quote paper
- Jaqueline Stevens (Author), 2009, Läuft die niedrigschwellige Drogenarbeit Gefahr sich zu einer Elendsverwaltung zu entwickeln?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183685