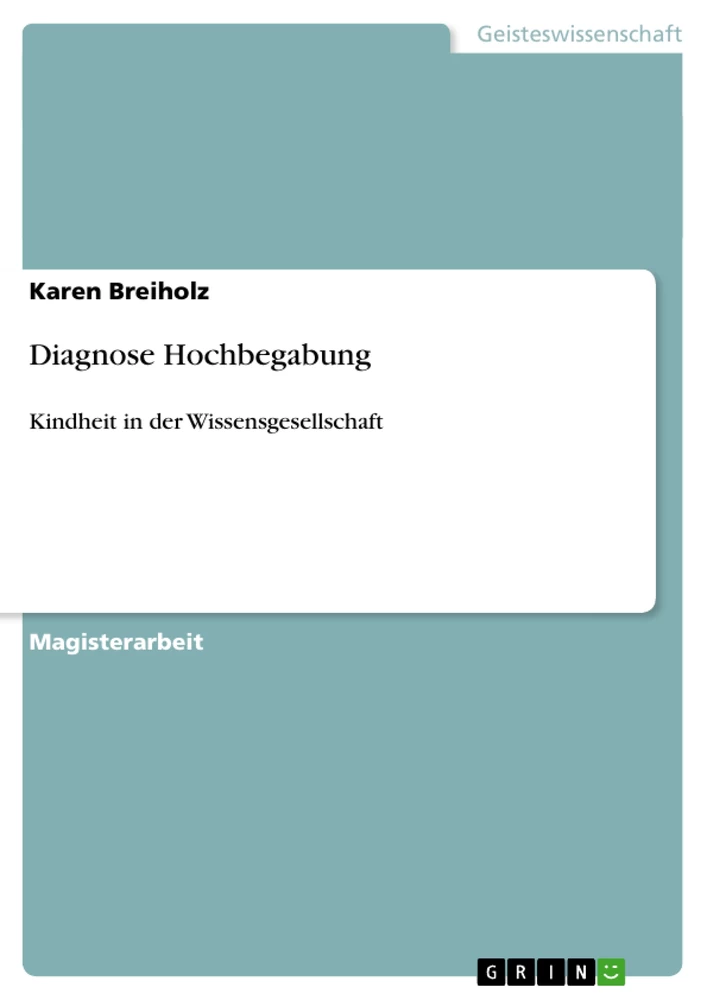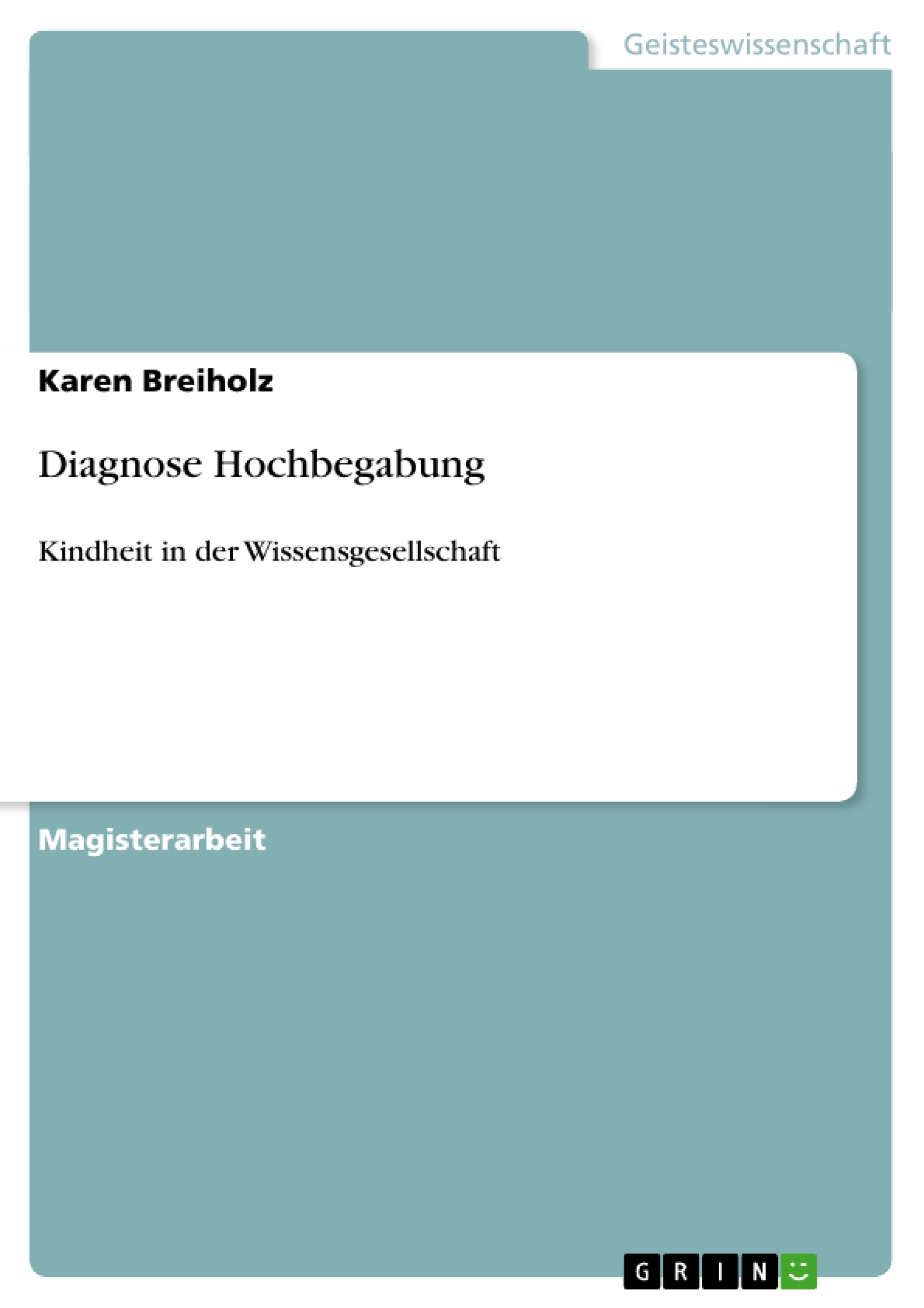1 Einleitung
Sie gelten als „Jung-Genies“ , „Einsteins von morgen“ und Wunderkinder . Sie gelten aber auch als Neunmalkluge, Schulversager und Problemkinder. Die Diagnose Hochbegabung weckt in der Gesellschaft vielfältige Assoziationen und Konnotationen. Ziel dieser Arbeit ist es daher, einen Überblick über die Thematisierung von hochbegabten Kindern zu geben. Dies soll vor dem Hintergrund einer neuen Sichtweise auf Kindheit geschehen, die - so wird postuliert - seit den 1980er Jahren im wesentlichen eine Zeit der freien Entfaltung und Förderung darstellt und daher Kindern ganz allgemein gesprochen einen Platz in der Gesellschaft einräumt, der auf der „Eigenständigkeit dieser Lebensphase“ beruht.
Legt man diese Prämisse zugrunde, wird der Bezug zur Wissensgesellschaft deutlich, in deren Voraussetzungen Bildung einen zentralen Stellenwert im Sinne eines mit Foucault gesprochenen selbst regulierten Subjekts einnimmt. Der Verdacht, dass hochbegabten Kindern die dafür nötigen Kompetenzen aufgrund ihrer konstatierten höheren Intelligenz leichter zufallen als Normalbegabten, ist bereits Gegenstand vieler wissenschaftlicher Abhandlungen und Ratgeber, welche die theoretische Fundierung dieser Glaubenssätze untersuchen und ins rechte Licht zu stellen suchen. Diese Arbeit setzt sich vielmehr zum Ziel, die bei näherer Betrachtung zu beobachtenden Ausmaße der gesellschaftlichen Thematisierung von Hochbegabung zu beleuchten, die angesichts der konstatierten geringen Ausprägung von circa zwei Prozent Hochbegabten erstaunen.
Angesichts zahlreicher Buchneuerscheinungen zum Thema Hochintelligenz, von vielen Seiten geäußerter Kritik am Intelligenzbegriff, den politischen Diskussionen über geistige Führungseliten und dem recht neuen Terminus des Underachievers wird der diskursive Charakter des Begriffs Hochbegabung offenkundig. Wenn Eltern wie in dem gleichnamigen Buchtitel fragen: „Ist mein Kind hochbegabt?“ , zeigt sich die Brisanz, welche die Diagnose Hochbegabung mit sich bringt, wenn es um „unübliche“ Fragen wie das Überspringen von Klassen, die frühere Einschulung oder andere geeignete Fördermaßnahmen geht. Wie also wird aus kulturwissenschaftlicher Sicht mit diesem aktuellen Problemkomplex umzugehen sein?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand
- 2.1 Begriffsgeschichtliche Herleitung von Hochbegabung
- 2.2 Abweichendes Verhalten in der Gesellschaft
- 2.2.1 Die Entstehung eines gesellschaftlichen Regulativs nach Norbert Elias
- 2.2.2 Der Normalitätsdispositiv als modernes Kontrollinstrumentarium sozialen Verhaltens
- 2.2.3 Subjekte im Dreieck Kultur – Identität – Macht
- 2.3 Kindheitsforschung
- 2.3.1 „Das Drama des begabten Kindes“
- 2.3.2 Aktuelle Kindheitskonzepte
- 3 Erkenntnisinteresse
- 3.1 Die Bedeutung der Hochbegabtenthematik für gesellschaftliche Zusammenhänge
- 3.2 Fragestellung und Hypothesen
- 4 Methodisches Vorgehen
- 4.1 Foucault: Die Machtwirkung der Diskurse auf das Subjekt
- 4.2 Foucault als Wegbereiter von Diskursanalysen
- 4.3 Diskursanalyse nach Siegfried Jäger
- 4.3.1 Zweck
- 4.3.2 Vorgehensweise
- 4.3.2.1 Ermittlung des diskursiven Kontexts
- 4.3.2.2 Auswahl des Materials
- 4.3.2.3 Strukturanalyse
- 4.3.2.4 Diskursverschränkungen
- 5 Diskursanalyse
- 5.1 Öffentlicher Diskurs über Hochbegabung = Interdiskurs
- 5.1.1 Ebene der Wissensgenerierung
- 5.1.1.1 Von Wunderkindern zu hochbegabten Kindern
- 5.1.1.2 Diagnostik
- 5.1.1.3 Hochbegabung als Abweichung von der Norm?
- 5.1.1.4 Abgrenzung zu krankheitswertigen Störungsbildern
- 5.1.1.5 Fazit
- 5.1.2 Bildungspolitische Diskursebene
- 5.1.2.1 Die Entwicklung eines Notstands
- 5.1.2.2 Die Sechste Weltkonferenz für das hochbegabte Kind und die Folgen
- 5.1.2.3 Die PISA-Krise 2001 und die Folgen
- 5.1.2.4 Fazit
- 5.1.3 Mediale Diskursebene
- 5.1.3.1 Wie die Medien auf Hochbegabte kamen
- 5.1.3.2 Was die Medien über Hochbegabte sagen
- 5.1.3.3 Fazit
- 5.2 Binnendiskurs über Hochbegabung = Spezialdiskurs
- 5.2.1 Pädagogische Diskursebene
- 5.2.1.1 Die Adressaten pädagogischen Wissens
- 5.2.1.2 Spezifische Wissenstransformation
- 5.2.1.3 Fazit
- 5.2.2 Ebene der hochbegabten Subjekte - Analyse zweier Hochbegabten-Foren im Internet
- 5.2.2.1 Internetforen als kulturwissenschaftliche Forschungsräume
- 5.2.2.2 Hochbegabte Kindheit im Diskurs der hochbegabten Subjekte
- 5.2.2.3 Fazit
- 5.3 Diskursverschränkungen
- 5.3.1 Fallbeispiel: Wie Hochbegabte in den Medien von hochbegabten Subjekten thematisiert werden
- 5.3.2 Zusammenfassung der Diskursverschränkungen
- 5.3.2.1 Diskursebenenverschränkungen
- 5.3.2.2 Diskursstrangverschränkungen
- Die begriffsgeschichtliche Entwicklung von Hochbegabung
- Die gesellschaftliche Konstruktion von Hochbegabung als Abweichung von der Norm
- Die Rolle der Medien und der Bildungspolitik im Diskurs um Hochbegabung
- Die Perspektiven hochbegabter Kinder selbst
- Die Analyse der Diskursverschränkungen im Kontext von Hochbegabung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Thematisierung von Hochbegabung bei Kindern vor dem Hintergrund neuer Kindheitskonzepte. Sie beleuchtet den diskursiven Charakter des Begriffs Hochbegabung und analysiert die verschiedenen Diskurse, die ihn prägen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die vielfältigen Assoziationen, die mit dem Begriff „Hochbegabung“ verbunden sind. Sie skizziert den Forschungsansatz und die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel 2 (Forschungsstand): Dieses Kapitel beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zur Hochbegabung, betrachtet begriffsgeschichtliche Aspekte und analysiert abweichendes Verhalten im gesellschaftlichen Kontext. Es beinhaltet auch einen Überblick über relevante Kindheitskonzepte.
Kapitel 3 (Erkenntnisinteresse): Dieses Kapitel definiert das Erkenntnisinteresse der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage sowie die Hypothesen.
Kapitel 4 (Methodisches Vorgehen): Hier wird die gewählte Methodik, die Diskursanalyse nach Foucault und Jäger, detailliert beschrieben und begründet.
Kapitel 5 (Diskursanalyse): Der Hauptteil der Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Diskursanalyse, aufgeteilt in öffentliche und interne Diskurse und deren Verschränkungen. Es werden die Diskurse auf Ebene der Wissensgenerierung, der Bildungspolitik und der Medien analysiert, sowie der Diskurs der betroffenen Kinder selbst.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Kindheitsforschung, Diskursanalyse, Foucault, Siegfried Jäger, Wissensgesellschaft, Bildungspolitik, Medien, Abweichendes Verhalten, Normalität, Identität.
- Quote paper
- Karen Breiholz (Author), 2011, Diagnose Hochbegabung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183558