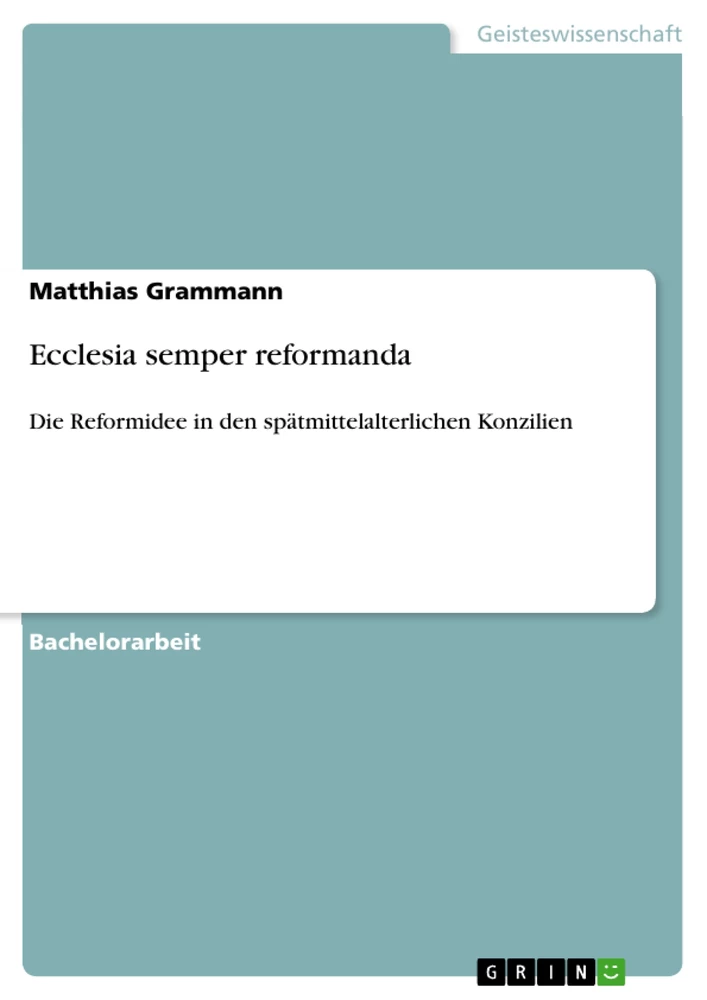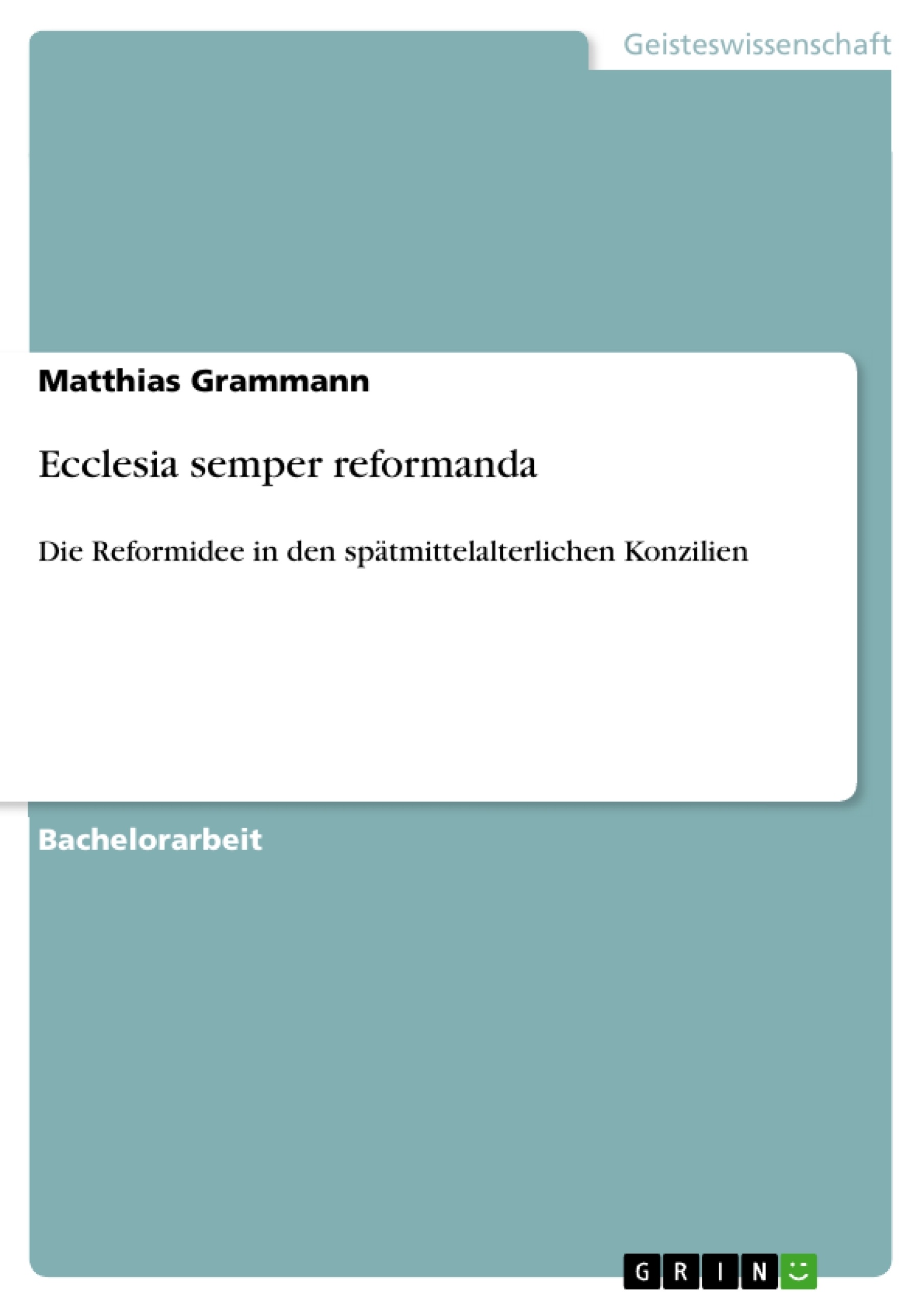Im Diskurs der Erforschung des Mittelalters spielt der Reformbegriff eine große Rolle.
Man spricht von ‚Karolingischer Reform‘, ‚Klosterreform‘, ‚Reformpapsttum‘, ‚Reichsreform‘, ‚Kirchenreform‘ und Ähnlichem.1
Dabei ist ‚Reform‘ keinesfalls ein Schlagwort, das erst im historischen Rückblick entstanden ist. Der Begriff ‚reformatio‘ war im Ausklang des Mittelalters in aller Munde.
Besonders laut wurde der Ruf nach einer grundlegenden Kirchenreform. In einer deutlich pathetischen Predigt zu Beginn des Konstanzer Konzil heißt es:
„Wie notwendig die Reform der Kirche ist, weiß alle Welt, weiß der Klerus, weiß das ganze Christenvolk. Der Himmel, die Elemente, das Blut der täglich zugrunde gehenden Seelen, ja selbst die Steine rufen nach Reform.“2
Das 15. Jahrhundert, in dem das Konstanzer Konzil und die anderen sogenannten Reformkonzilien stattfanden, war in der Dichte der Forderungen nach Kirchenreform sicherlich einzigartig. So schreibt der Kommunikationswissenschaftler Ralf Bollmann: „Keine andere Epoche war so sehr von diesem Schlagwort [‚Reformatio‘, Anm. d. Autors] geprägt wie das 15. Jahrhundert.“3
[...]
1 Vgl. MIETHKE, Jürgen: Kirchenreform auf den Konzilien des 15. Jahrhunderts. Motive – Methoden – Wirkungen. In: HELMRATH, Jürgen / MÜLLER, Heribert (Hg.): Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen. Bd. 1. München: Oldenbourg 1994. S.13-42. S. 14.
2 Matthias Röder in einer Predigt zu Beginn des Konstanzer Konzils. Zit. nach: BOLLMANN, Ralph: Reform. Ein deutscher Mythos. Berlin: wjs 2008.
3 BOLLMANN, Ralph: Reform. S. 13.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Reformatio“ – zur Begriffsgeschichte
- 2.1. Profane Entstehung
- 2.2. Biblischer und patristischer Sprachgebrauch
- 2.3. „Reformatio“ im Früh- und Hochmittelalter
- 2.4. Theoretische Überlegungen zur Reformatio im Spätmittelalter
- 3. Das Große Abendländische Schisma und der Konziliarismus
- 4. Die De Squaloribus Curiae Romane des Matthäus von Krakau
- 4.1. Reformvorstellungen in De Squaloribus Curiae Romane
- 4.2. Matthäus Kritik am Pfründensystem
- 5. Das Konzil von Pisa
- 5.1. Weg zum Konzil und Verlauf
- 5.2. Reformarbeit auf dem Konzil von Pisa
- 6. Das Konzil von Konstanz
- 6.1. Weg zum Konzil und Verlauf
- 6.2. Union oder Kirchenreform?
- 6.3. Die Reformarbeit des Konstanzer Konzils
- 6.3.1. Haec Sancta
- 6.3.2. Frequens
- 6.4. Die Verurteilungen von Wyclif und Hus
- 7. Das Konzil von Pavia/Siena
- 7.1. Weg zum Konzil und Verlauf
- 7.2. Reformprozesse in Pavia/Siena
- 8. Das Konzil von Basel
- 8.1. Weg zum Konzil und Verlauf
- 8.2. Reformarbeit in Basel
- 8.2.1 De annatis
- 8.2.1.1. Die Annaten als Thema der Kirchenreform
- 8.2.1.2. Das Basler Dekret
- 8.2.2. Das Konzil von Basel als Zentrale der Ordensreform
- 9. Fazit
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Reformdiskurs auf den spätmittelalterlichen Konzilien. Ziel ist es, die Bedeutung des Begriffs "Reformatio" im 15. Jahrhundert zu klären, die kritisierten Missstände der Kirche zu identifizieren und die konkreten Reformbemühungen zu analysieren. Die Arbeit fragt nach den Zielen der Reformforderungen, den Verantwortlichkeiten und dem letztendlichen Erfolg der Reformbestrebungen.
- Begriffsgeschichte von „Reformatio“ im spätmittelalterlichen Kontext
- Analyse der Kritik an der Kirche im 15. Jahrhundert
- Untersuchung der Reformarbeit auf den Konzilien von Pisa, Konstanz, Pavia/Siena und Basel
- Bewertung des Verhältnisses zwischen Papsttum und Konzilien im Reformdiskurs
- Erfolgsbilanz der Reformbemühungen im ausgehenden Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kirchenreform im Spätmittelalter ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie betont die Bedeutung des Begriffs „Reformatio“, der im 15. Jahrhundert weit verbreitet war, und hebt die Notwendigkeit hervor, dessen Bedeutung im historischen Kontext zu verstehen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Konzilien als Orte der Reform und untersucht deren Rolle im Verhältnis zum Papsttum. Die Einleitung skizziert das Problem der unterschiedlichen Perspektiven auf Reform und die Schwierigkeit, den Erfolg der Reformbemühungen zu beurteilen.
2. „Reformatio“ – zur Begriffsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Reformatio“ von seinen profanen Ursprüngen über seinen Gebrauch in der Bibel und der Patristik bis hin zu seiner Verwendung im Früh- und Hochmittelalter. Es analysiert die semantischen Veränderungen des Begriffs und bereitet den Boden für das Verständnis seiner Bedeutung im Kontext der spätmittelalterlichen Konzilien. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der verschiedenen Nuancen und Interpretationen des Begriffs, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
3. Das Große Abendländische Schisma und der Konziliarismus: Das Kapitel untersucht den Einfluss des Großen Abendländischen Schismas auf den Reformdiskurs. Es analysiert die Krise des Papsttums und die Entstehung des Konziliarismus als Antwort auf die Spaltungen innerhalb der Kirche. Hier wird die zunehmende Bedeutung von Konzilien als Reforminstanzen im späten Mittelalter herausgearbeitet und der Zusammenhang zwischen der Kirchenspaltung und den verstärkten Forderungen nach Reform deutlich gemacht.
4. Die De Squaloribus Curiae Romane des Matthäus von Krakau: Dieses Kapitel analysiert die Schrift „De Squaloribus Curiae Romane“ von Matthäus von Krakau als wichtigen Beitrag zum Reformdiskurs. Es untersucht Matthäus’ Kritik am römischen Hof und seinen Vorschlägen zur Reform der Kirche. Die Analyse konzentriert sich auf Matthäus’ Kritik am Pfründesystem und dessen Auswirkungen auf die Moral und die Effektivität der Kirche. Es wird die Bedeutung seiner Arbeit für das Verständnis der Reformforderungen des 15. Jahrhunderts herausgestellt.
5. Das Konzil von Pisa: Das Kapitel beschreibt den Weg zum Konzil von Pisa und seinen Verlauf. Es untersucht die Reformbemühungen des Konzils und analysiert deren Erfolg bzw. Misserfolg. Der Fokus liegt auf den Maßnahmen, die das Konzil zur Behebung der Missstände in der Kirche ergriffen hat, und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Reformdiskurses.
6. Das Konzil von Konstanz: Dieses Kapitel widmet sich dem Konzil von Konstanz, einem der wichtigsten Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts. Es beleuchtet den Weg zum Konzil, seinen Verlauf und die zentrale Frage nach Union oder Kirchenreform. Die Analyse konzentriert sich auf die konkrete Reformarbeit des Konzils, insbesondere auf die Dekrete „Haec Sancta“ und „Frequens“, und deren Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Kirche. Die Verurteilung von Wyclif und Hus wird ebenfalls eingeordnet und deren Kontextualisierung bezüglich des Reformdiskurses hervorgehoben.
7. Das Konzil von Pavia/Siena: Das Kapitel behandelt das Konzil von Pavia/Siena und seine Reformprozesse. Es analysiert den Verlauf des Konzils und die Maßnahmen, die zur Kirchenreform ergriffen wurden. Der Fokus liegt auf der Kontinuität und dem Wandel im Reformdiskurs im Vergleich zu den vorherigen Konzilien. Die spezifischen Herausforderungen und die Ergebnisse der Reformbemühungen in Pavia/Siena werden im Detail untersucht.
8. Das Konzil von Basel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzil von Basel und seinen Reformbemühungen, insbesondere im Kontext der Annaten und der Ordensreform. Es untersucht den Verlauf des Konzils und analysiert die Bedeutung der Reformdekrete. Die Arbeit an den Annaten als wichtiges Thema der Kirchenreform und das Basler Dekret werden ausführlich dargestellt. Die Rolle des Konzils von Basel als Zentrum der Ordensreform wird ebenfalls umfassend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kirchenreform, Reformatio, Konziliarismus, Spätmittelalter, Konzil von Konstanz, Konzil von Basel, Konzil von Pisa, Papsttum, Matthäus von Krakau, De Squaloribus Curiae Romane, Annaten, Pfründesystem, Ordensreform, Haec Sancta, Frequens, Wyclif, Hus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kirchenreform auf den spätmittelalterlichen Konzilien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Reformdiskurs auf den spätmittelalterlichen Konzilien des 15. Jahrhunderts. Sie untersucht die Bedeutung des Begriffs "Reformatio", identifiziert kritisierte Missstände der Kirche und analysiert konkrete Reformbemühungen. Im Mittelpunkt stehen die Ziele der Reformforderungen, die Verantwortlichkeiten und der Erfolg der Bestrebungen.
Welche Konzilien werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Konzilien von Pisa, Konstanz, Pavia/Siena und Basel. Diese Konzilien werden hinsichtlich ihrer Reformarbeit detailliert untersucht und miteinander verglichen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsgeschichte von "Reformatio", die Kritik an der Kirche im 15. Jahrhundert (u.a. mit Bezug auf Matthäus von Krakau und seine Schrift "De Squaloribus Curiae Romane"), die Reformarbeit der einzelnen Konzilien (mit detaillierten Analysen ihrer Dekrete und Maßnahmen), das Verhältnis zwischen Papsttum und Konzilien im Reformdiskurs und die Erfolgsbilanz der Reformbemühungen.
Welche Bedeutung hat der Begriff "Reformatio"?
Ein eigenes Kapitel widmet sich der Begriffsgeschichte von "Reformatio". Es wird die Entwicklung des Begriffs von seinen profanen Ursprüngen über die Bibel und Patristik bis ins Hochmittelalter nachvollzogen. Die semantischen Veränderungen und unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs im Kontext der spätmittelalterlichen Konzilien werden analysiert.
Welche Rolle spielte Matthäus von Krakau?
Die Schrift "De Squaloribus Curiae Romane" von Matthäus von Krakau wird als wichtiger Beitrag zum Reformdiskurs analysiert. Seine Kritik am römischen Hof, insbesondere am Pfründesystem, und seine Reformvorschläge werden detailliert untersucht.
Wie werden die Konzilien im Einzelnen behandelt?
Jedes Konzil (Pisa, Konstanz, Pavia/Siena, Basel) wird in einem eigenen Kapitel behandelt. Die Kapitel beschreiben den Weg zum Konzil, seinen Verlauf, die Reformbemühungen, die konkreten Maßnahmen und deren Auswirkungen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Dekreten "Haec Sancta" und "Frequens" (Konstanz) sowie den Bemühungen um die Annatenreform (Basel) gewidmet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kirchenreform, Reformatio, Konziliarismus, Spätmittelalter, Konzil von Konstanz, Konzil von Basel, Konzil von Pisa, Papsttum, Matthäus von Krakau, De Squaloribus Curiae Romane, Annaten, Pfründesystem, Ordensreform, Haec Sancta, Frequens, Wyclif, Hus.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht ein Fazit über die Reformbemühungen auf den spätmittelalterlichen Konzilien, bewertet deren Erfolg und beleuchtet das komplexe Verhältnis zwischen Papsttum und Konzilien im Reformdiskurs. Eine abschließende Erfolgsbilanz der Reformbestrebungen im ausgehenden Mittelalter wird gegeben.
Wo finde ich das Literaturverzeichnis?
Das Literaturverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und dient der Nachvollziehbarkeit der Quellenangaben.
- Arbeit zitieren
- Matthias Grammann (Autor:in), 2009, Ecclesia semper reformanda, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183500