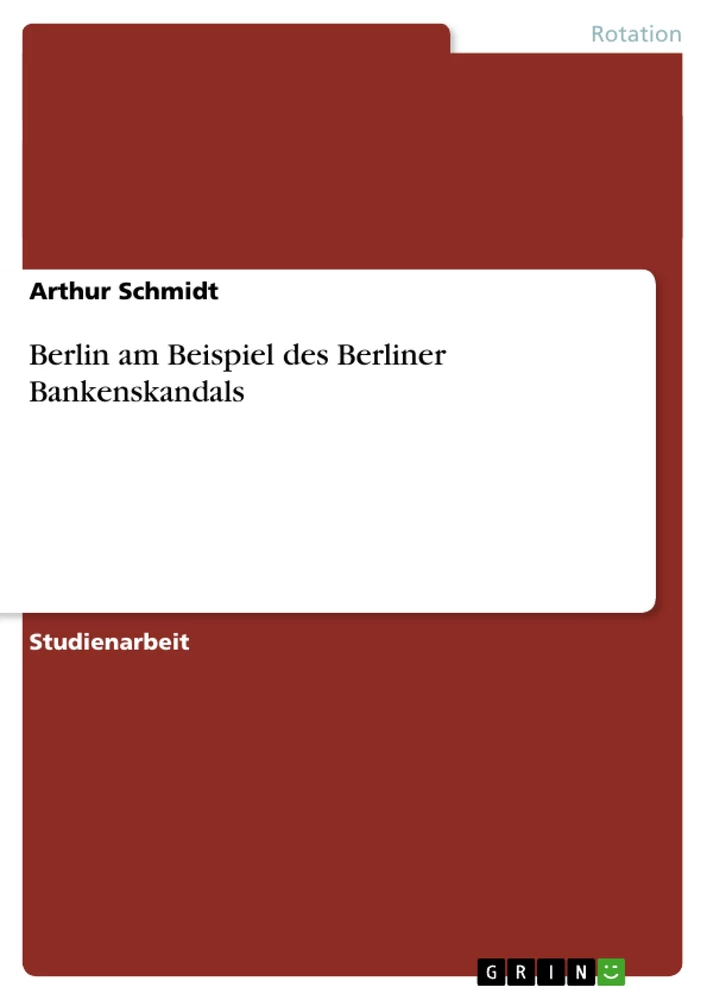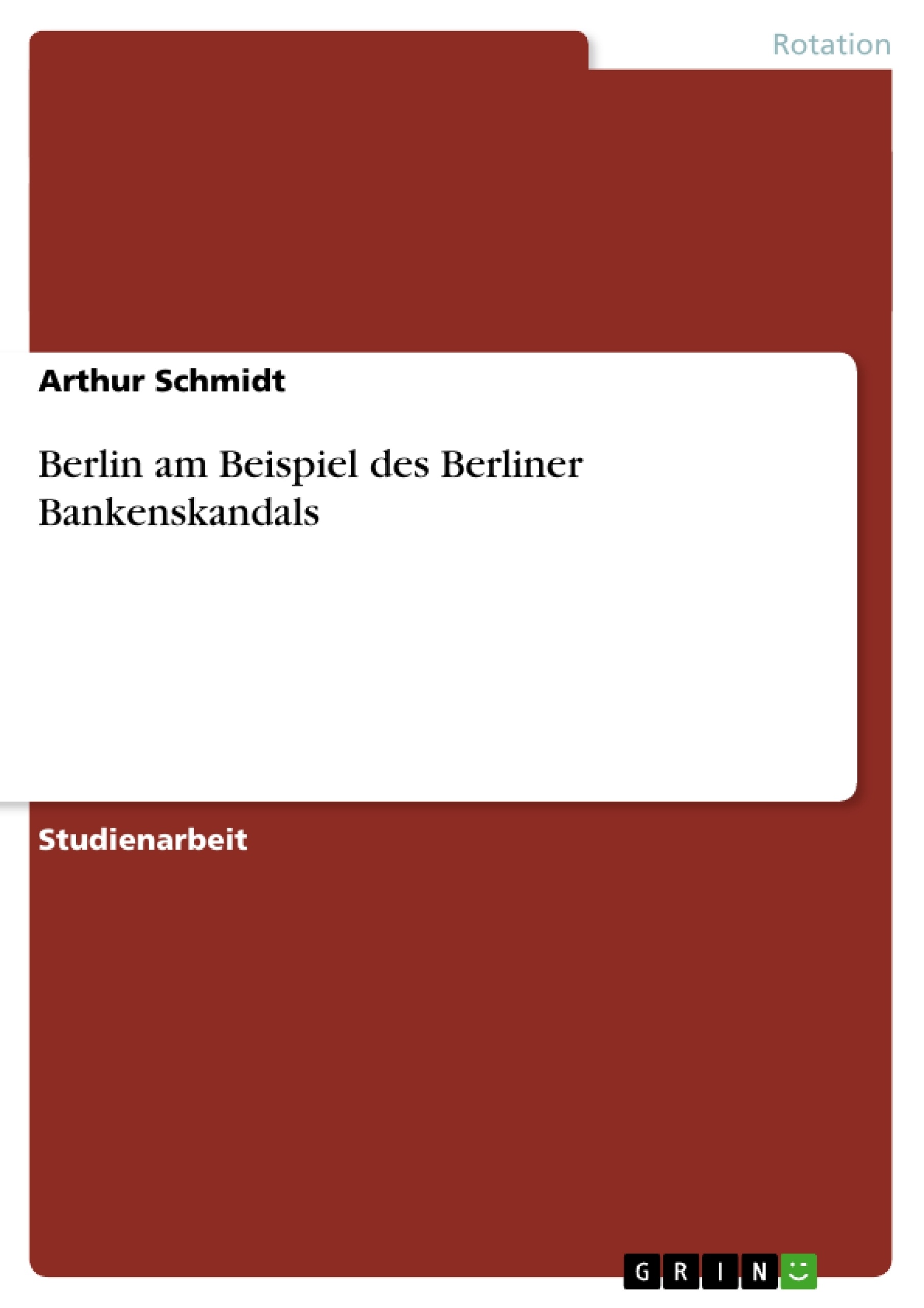„Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Klaus Landowsky, bekam von seinem Parteivorstand am Sonnabend einen „Verweis“ erteilt, weil er 40000 Mark in bar von zwei Immobilienspekulanten angenommen hatte, die er als Parteispende bezeichnete. Das Leckere an der für Berlin typischen Geschichte war, dass beide Immobilienfritzen, ehemals einflussreiche CDU-Mitglieder, von der BerlinHyp zuvor ein riesiges Darlehen von mehreren hundert Millionen Mark gewährt bekommen hatten. Chef der Bank war Landowsky, Zusammenhang angeblich keiner.“
„Diskret hat die Bankgesellschaft Berlin einen Verlust von 1,5 Milliarden Mark bei ihrer Immobilientochter IBG wegbilanziert: Die Firma wurde dazu quasi neu gegründet - und soll an die Börse.“
Januar 2001 veröffentlicht DER SPIEGEL einen Bericht über Bilanztricks innerhalb der Berliner Bankgesellschaft zur Vertuschung eines Verlustes der IBG GmbH 3 von rund 1,5 Mrd. DM. Damit startet das Magazin die Dossierreihe: „Bankgesellschaft Berlin - Mitten im Milliardenloch“, die zahlreiche Enthüllungen über Machenschaften innerhalb der Berliner Bankgesellschaft protokolliert. Zahlreiche Medien ziehen nach, jedoch beschränken sich viele darauf die entsprechenden Berichte nicht zu veröffentlichen. Man traut sich nicht. Auch die Politik und die Staatsanwaltschaft halten sich zurück. Zu tief liegen die Wurzeln des Skandals. Tief genug, um stillschweigend den Prozess aus dem Abseits zu beobachten, um nicht selbst mit hineingezogen zu werden.
Wie konnte es nur zu solch einem Desaster kommen, welches als der größte Bankenskandal des Nachkriegsdeutschland in die Geschichte eingegangen ist? Von den Anfängen des Skandals in den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts bis zum Jahr 2003 soll festgehalten werden, was passiert ist und welche Auswirkungen es gehabt hat bzw. haben wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Bankgesellschaft Berlin
- 1. Strukturdaten
- 2. Gründung
- 3. Besonderheiten (im negativen Sinne) und Folgen
- 4. Das Immobiliengeschäft der Bankgesellschaft Berlin
- 4.1 BerlinHyp
- 4.2 Landesbank Berlin - Girozentrale
- 4.3 IBAG
- 4.3.1 Die Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft mbH (IBV)
- 4.3.2 Die BAVARIA Objekt- und Baubetreuung GmbH
- 4.3.3 ARWOBAU Apartment- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
- 4.3.4 IBG
- 4.3.5 LPFV Finanzbeteiligungs- und verwaltungs GmbH
- 4.3.6 IBI Real Estate - Immobilien und Beteiligungen International GmbH
- 4.4 Wie aus der IBG die IBAG wurde
- III. Die Immobilienfonds
- IV. Die „Lex Landowsky“
- V. Was ist passiert?
- 1. Teil: „Das Schneeballsystem“
- 2. Teil: Der AUBIS - Skandal
- 3. Teil: Die Quellen der Verschuldung
- 3.1 Fehler in der wirtschaftlichen Fondskonstruktion
- 3.2 Der Berliner Filz
- 4. Teil: Die Risikoabschirmung
- 4.1 Das Gesetz
- 4.2 Die Detailvereinbarung
- VI. Was nun?
- 1. Die Untersuchungsausschüsse
- 2. Was passiert mit der Bank?
- 2.1 Insolvenz?
- 2.2 Verkauf?
- 2.3 Sanierung!
- 3. Rechtliche Maßnahmen – Was wird eigentlich unternommen?
- VII. Mögliche Wege aus der Bankenkrise
- VIII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Berliner Bankenskandal, einen der größten Bankenskandale der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Ziel ist es, die Ereignisse von den Anfängen in den frühen 1990er Jahren bis 2003 nachzuvollziehen und die Ursachen sowie die Folgen des Skandals zu analysieren.
- Die Gründung und Struktur der Bankgesellschaft Berlin (BGB)
- Das Immobiliengeschäft der BGB und die damit verbundenen Risiken
- Die Rolle politischer Einflussnahme und Korruption ("Berliner Filz")
- Die Entstehung und der Verlauf des Skandals, inklusive Bilanzmanipulationen
- Die Folgen des Skandals und mögliche Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Berliner Bankenskandal als einen der größten in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands und skizziert den zeitlichen Rahmen der Untersuchung (Anfänge in den frühen 1990ern bis 2003). Sie hebt die Bedeutung der Enthüllungen des SPIEGEL hervor und betont den politischen und medialen Umgang mit dem Skandal, der durch Schweigen und Zurückhaltung geprägt war. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage nach den Ursachen und Folgen des Desasters.
II. Die Bankgesellschaft Berlin: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung der Bankgesellschaft Berlin (BGB) im Jahr 1994 und ihre komplexe Struktur als Holding mit zahlreichen Tochtergesellschaften. Es werden Strukturdaten präsentiert, die die Größe und die Beteiligung des Landes Berlin als Hauptaktionär verdeutlichen. Die Gründung wird im Kontext der damaligen politischen Situation und der Absicht, eine wettbewerbsfähige Hauptstadtbank zu schaffen, erläutert. Kritische Stimmen, die bereits frühzeitig auf mögliche Risiken hinwiesen, werden ebenfalls berücksichtigt. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Beteiligungsstrukturen, die später eine zentrale Rolle im Skandal spielen.
III. Die Immobilienfonds: (Eine Zusammenfassung zu diesem Kapitel fehlt im bereitgestellten Text. Es müsste eine Zusammenfassung erstellt werden, die die wesentlichen Aspekte der Immobilienfonds im Kontext des Berliner Bankenskandals darstellt, mindestens 75 Wörter umfassend.)
IV. Die „Lex Landowsky“: (Eine Zusammenfassung zu diesem Kapitel fehlt im bereitgestellten Text. Es müsste eine Zusammenfassung erstellt werden, die die wesentlichen Aspekte des "Lex Landowsky" im Kontext des Berliner Bankenskandals darstellt, mindestens 75 Wörter umfassend.)
V. Was ist passiert?: Dieses Kapitel, gegliedert in vier Teile, beschreibt den Verlauf des Bankenskandals. Der erste Teil beleuchtet das „Schneeballsystem“, der zweite den AUBIS-Skandal. Der dritte Teil analysiert die Quellen der Verschuldung, insbesondere Fehler in der wirtschaftlichen Fondskonstruktion und die Rolle des "Berliner Filz". Der vierte Teil fokussiert auf die Risikoabschirmung und die relevanten gesetzlichen Regelungen. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Facetten des Skandals, von den ersten Anzeichen bis zu den komplexen Mechanismen der Verschleierung.
VI. Was nun?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen des Skandals und den daraufhin eingeleiteten Maßnahmen. Es beschreibt die Arbeit der Untersuchungsausschüsse und diskutiert die verschiedenen Optionen für die Zukunft der Bank (Insolvenz, Verkauf, Sanierung). Zusätzlich werden die rechtlichen Schritte beleuchtet, die eingeleitet wurden, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Reaktionen auf den Skandal und den Bemühungen, die Krise zu bewältigen.
VII. Mögliche Wege aus der Bankenkrise: (Eine Zusammenfassung zu diesem Kapitel fehlt im bereitgestellten Text. Es müsste eine Zusammenfassung erstellt werden, die mindestens 75 Wörter umfasst und die möglichen Lösungsansätze zur Bewältigung der Bankenkrise im Detail analysiert.)
Schlüsselwörter
Berliner Bankenskandal, Bankgesellschaft Berlin (BGB), Immobiliengeschäft, Immobilienfonds, BerlinHyp, Landesbank Berlin, Korruption, „Berliner Filz“, Bilanzmanipulation, Risikoabschirmung, politische Einflussnahme, Untersuchungsausschüsse, Insolvenz, Sanierung.
Häufig gestellte Fragen zum Berliner Bankenskandal
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Berliner Bankenskandal, einen der größten Bankenskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie untersucht die Ereignisse von den frühen 1990er Jahren bis 2003, um die Ursachen und Folgen des Skandals aufzudecken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gründung und Struktur der Bankgesellschaft Berlin (BGB), ihr Immobiliengeschäft und die damit verbundenen Risiken, die Rolle politischer Einflussnahme und Korruption ("Berliner Filz"), die Entstehung und den Verlauf des Skandals inklusive Bilanzmanipulationen, sowie die Folgen des Skandals und mögliche Lösungsansätze. Die Analyse umfasst die Immobilienfonds, die „Lex Landowsky“, den AUBIS-Skandal und die verschiedenen Reaktionen auf die Krise (Untersuchungsausschüsse, Insolvenz, Sanierung etc.).
Welche Akteure spielen eine Rolle?
Zentrale Akteure sind die Bankgesellschaft Berlin (BGB) mit ihren Tochtergesellschaften wie BerlinHyp, Landesbank Berlin und IBAG (inkl. ihrer Tochtergesellschaften IBV, BAVARIA, ARWOBAU, IBG, LPFV und IBI Real Estate). Der "Berliner Filz", also politische Einflussnahme und Korruption, spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle, ebenso wie die beteiligten Untersuchungsausschüsse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Die Bankgesellschaft Berlin, Die Immobilienfonds, Die „Lex Landowsky“, Was ist passiert? (gegliedert in vier Teile: Schneeballsystem, AUBIS-Skandal, Quellen der Verschuldung, Risikoabschirmung), Was nun?, Mögliche Wege aus der Bankenkrise und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte des Bankenskandals.
Was sind die zentralen Erkenntnisse?
Die zentralen Erkenntnisse werden im Fazit zusammengefasst und beinhalten eine Analyse der Ursachen des Skandals (komplexe Strukturen, mangelnde Kontrolle, politische Einflussnahme, Fehler in der wirtschaftlichen Fondskonstruktion) und seiner Folgen (hohe Schulden, Imageschaden für Berlin, politische Konsequenzen). Die Arbeit beleuchtet verschiedene Lösungsansätze zur Bewältigung der Bankenkrise.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Berliner Bankenskandal, Bankgesellschaft Berlin (BGB), Immobiliengeschäft, Immobilienfonds, BerlinHyp, Landesbank Berlin, Korruption, „Berliner Filz“, Bilanzmanipulation, Risikoabschirmung, politische Einflussnahme, Untersuchungsausschüsse, Insolvenz, Sanierung.
Welche Kapitel enthalten noch keine Zusammenfassung?
Die Kapitel "III. Die Immobilienfonds", "IV. Die „Lex Landowsky“" und "VII. Mögliche Wege aus der Bankenkrise" enthalten im bereitgestellten Text keine Zusammenfassung. Diese benötigen jeweils mindestens 75 Wörter, um die relevanten Aspekte des Berliner Bankenskandals darzustellen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen könnten in den originalen Dokumenten zum Berliner Bankenskandal, Berichten der Untersuchungsausschüsse und zeitgenössischen Presseberichten (z.B. SPIEGEL-Artikel) gefunden werden.
- Arbeit zitieren
- Arthur Schmidt (Autor:in), 2003, Berlin am Beispiel des Berliner Bankenskandals, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18343