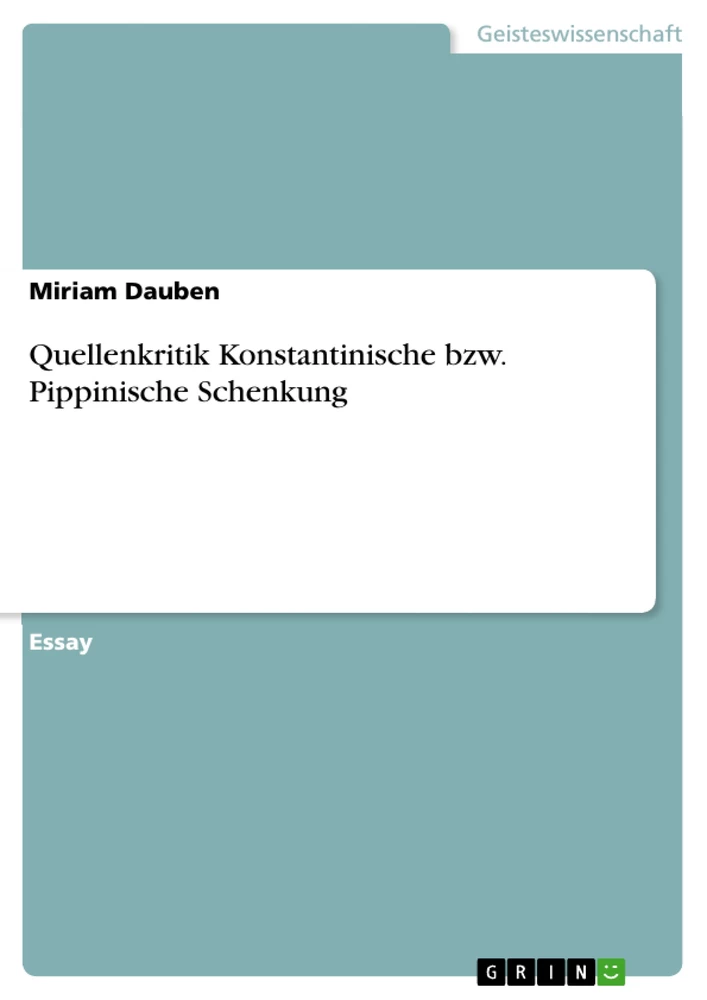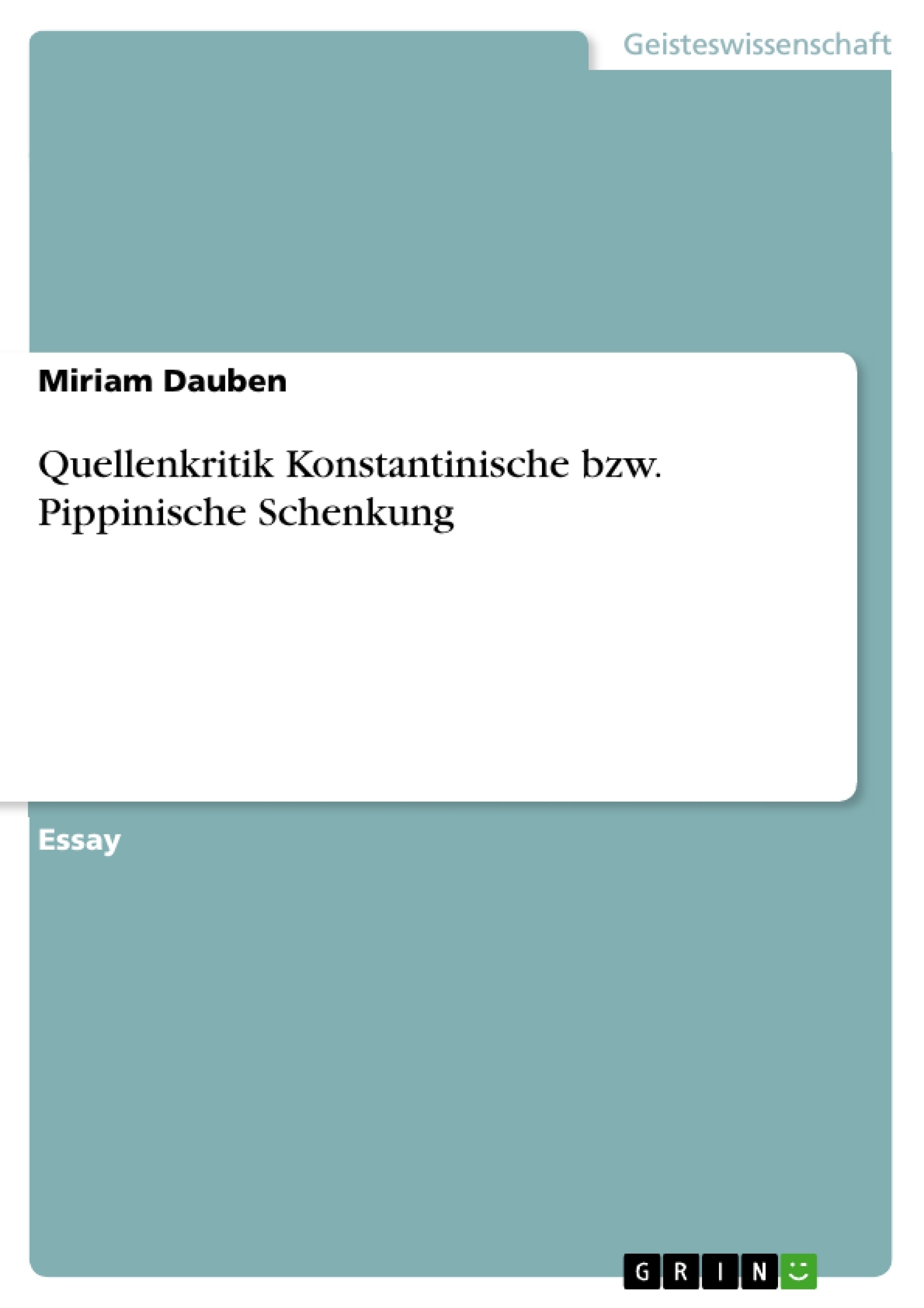Die Kirche hat sich lange auf die Konstantinische Schenkung berufen, während deren Authentizität schon bereits seit dem 15. Jahrhundert durch einige Humanisten (z.B. N. Cusanus, L. Valla und U. v. Hutten ) in Frage gestellt wurde.
Die „Konstantinische Schenkung“ ist eine Schenkungsurkunde, die in Briefform an Papst Silvester gerichtet ist. Sie wird als Schreiben des Kaisers Konstantin I. ausgegeben, mittels dessen er bei seinem Aufbruch Richtung Byzanz den gesamten westlichen Teil des Imperium Romanum an Papst Silvester übereignet haben soll. Des Weiteren wird Papst Silvester in der „Konstantinischen Schenkung“ der gleiche Rang zugesprochen, wie ihn ein Kaiser Roms hat. Das geistliche Haupt wird also dem weltlichen gleich- und gar über diese gestellt. So steht in der Konstantinischen Schenkung in etwa, dass der Verfasser, also vermeintlich Konstantin I., sich dem Papst als „unserem Vater Silvester“ unterstellt .
Da es sich um eine Form von Urkunde handelt, also um „ein in bestimmten Formen abgefasstes, beglaubigtes und daher verbindliches Schriftstück“ handelt, welches ein Rechtsgeschäft dokumentiert , kann man von der Quelle eigentlich erwarten, dass sie authentisch ist, jedoch lohnt sich auch bei solchen Quellen eine kritische Hinterfragung, wie später noch zu sehen ist. Im Allgemeinen beschreibt eine Urkunde „jede in Schriftzeichen verkörperte Gedankenerklärung, die eine rechtserhebliche Tatsache beweisen kann“.
Inhaltsverzeichnis
- Quellenkritik zur Konstantinischen und Pippinischen Schenkung
- Die Konstantinische Schenkung
- Aufbau der Konstantinischen Schenkung
- Der erste Teil: Silvesterlegende und Glaubensbekenntnis
- Der zweite Teil: Die Schenkung (Donatio)
- Hinweise auf eine Fälschung
- Die Pippinische Schenkung
- Der geschichtliche Kontext der Pippinischen Schenkung
- Die Beziehung zwischen der Konstantinischen und Pippinischen Schenkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Authentizität der Konstantinischen und Pippinischen Schenkungen. Ziel ist es, die historischen Hintergründe und die kritische Bewertung dieser wichtigen Dokumente der Kirchengeschichte zu beleuchten.
- Quellenkritik und Authentizitätsprüfung historischer Dokumente
- Die Konstantinische Schenkung als Fälschung
- Der historische Kontext der Pippinischen Schenkung
- Der Zusammenhang zwischen beiden Schenkungen
- Die Rolle des Papsttums im frühen Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Quellenkritik am Beispiel der Konstantinischen Schenkung, deren Authentizität bereits im 15. Jahrhundert angezweifelt wurde. Die Arbeit beschreibt den Aufbau und Inhalt der Urkunde, welche aus Glaubensbekenntnis und Schenkung besteht. Im Detail werden die Widersprüche und Anzeichen einer Fälschung analysiert, wie z.B. die späte Taufe Konstantins und die erst später entstandene rituelle Bedeutung des Stratordienstes. Der zweite Teil behandelt die Pippinische Schenkung und ihren geschichtlichen Kontext, insbesondere die Bedrohung Roms durch die Langobarden und die daraus resultierende Allianz zwischen Papst Stephan II. und König Pippin. Der Text beleuchtet die mögliche Verwendung der Konstantinischen Schenkung als Legitimationsgrundlage für den päpstlichen Landbesitzanspruch.
Schlüsselwörter
Konstantinische Schenkung, Pippinische Schenkung, Quellenkritik, Fälschung, Papsttum, fränkisches Königreich, Langobarden, mittelalterliche Geschichte, Authentizität, Legitimation, Herrschaftsanspruch.
- Quote paper
- Miriam Dauben (Author), 2010, Quellenkritik Konstantinische bzw. Pippinische Schenkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183280