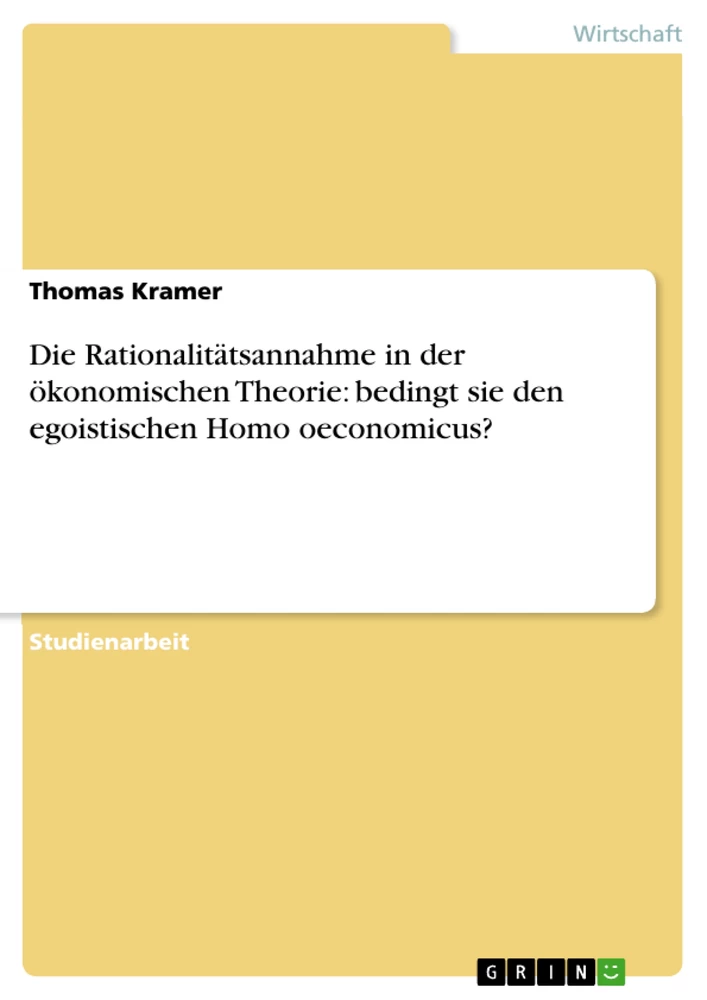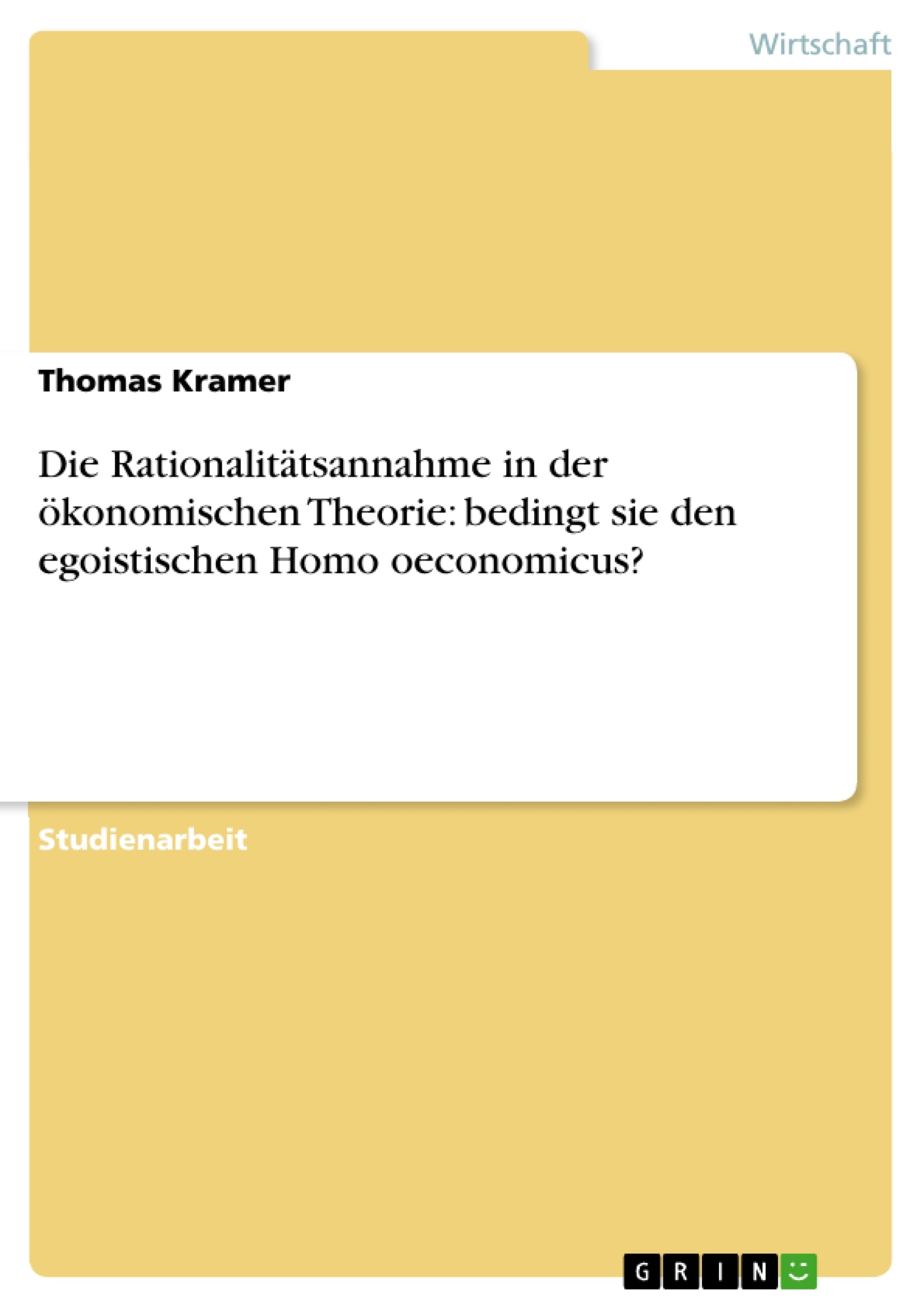Oft fragt man sich, warum die Leute überhaupt Lotto spielen, obwohl sie genau wissen, dass ihre Aussichten auf Gewinn marginal sind, oder warum jemand an Protestaktionen teilnimmt, obwohl er nur eine von unzähligen vielen Personen ist und es eigentlich gar nichts ausmachen würde, wenn er sich nicht daran beteiligt. Wäre es dann nicht rational, lieber zuhause zu bleiben, anstatt den (Zeit-)Aufwand in Kauf zu nehmen ?
In der vorliegenden Arbeit soll der Status des Egoismusprinzips innerhalb des ökonomischen Modells rationalen Verhaltens, repräsentiert durch das Menschenbild des homo oeconomicus, analysiert werden. Es geht vor allem darum zu zeigen, ob das Eigeninteresse eines Menschen Grundlage all seiner Entscheidungen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Einführung in das ökonomische Verhaltensmodell
- Das Egoismusprinzip in der Rationalitätsannahme
- Die Stellung des Eigennutzes in der Rational-Choice-Theorie
- Altruismus als Konsequenz individueller Rationalität
- Die Problematik des kollektiven Handelns
- Die Bewältigung der Unzulänglichkeiten des Verhaltensmodells
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle des Egoismusprinzips im ökonomischen Modell rationalen Verhaltens, insbesondere hinsichtlich des Menschenbildes des homo oeconomicus. Es soll geklärt werden, ob Eigeninteresse tatsächlich die Grundlage aller menschlichen Entscheidungen bildet.
- Die Rationalitätsannahme und ihre Prämissen in der ökonomischen Theorie
- Das Konzept des homo oeconomicus und seine Kritik
- Die Bedeutung des Eigennutzes in der Rational-Choice-Theorie
- Die Rolle von Altruismus und kollektivem Handeln im Kontext individueller Rationalität
- Die Grenzen und Unzulänglichkeiten des ökonomischen Verhaltensmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor, indem sie die Frage nach der Rationalität von Handlungen wie Lottospielen oder Protestbeteiligung aufwirft. Der erste Teil der Arbeit führt in das ökonomische Verhaltensmodell ein und beleuchtet die Kontroverse zwischen mikro- und makroökonomischen Perspektiven. Es wird der methodologische Individualismus als Grundlage des Verhaltensmodells erläutert und die Restriktionen im Entscheidungsspielraum des homo oeconomicus aufgezeigt.
Im zweiten Teil wird das Egoismusprinzip innerhalb der Rationalitätsannahme analysiert. Die Grenzen der Theorie und die Stabilität des Eigennutzaxioms werden diskutiert, sowie die Schwierigkeiten bei der Erklärung sozialer Phänomene. Verschiedene Interpretationsansätze der Wissenschaftler werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Rationalitätsannahme, homo oeconomicus, Egoismusprinzip, Eigennutz, Altruismus, Rational-Choice-Theorie, kollektives Handeln, methodologischer Individualismus, Restriktionen, Entscheidungsraum, Präferenzen.
- Quote paper
- Thomas Kramer (Author), 2000, Die Rationalitätsannahme in der ökonomischen Theorie: bedingt sie den egoistischen Homo oeconomicus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1828