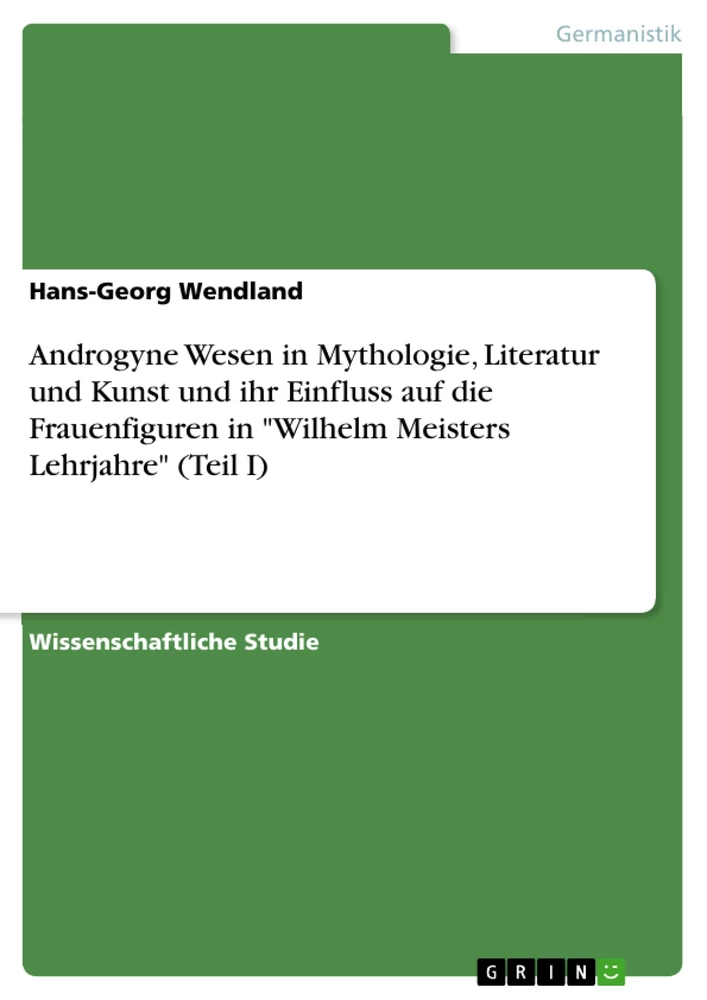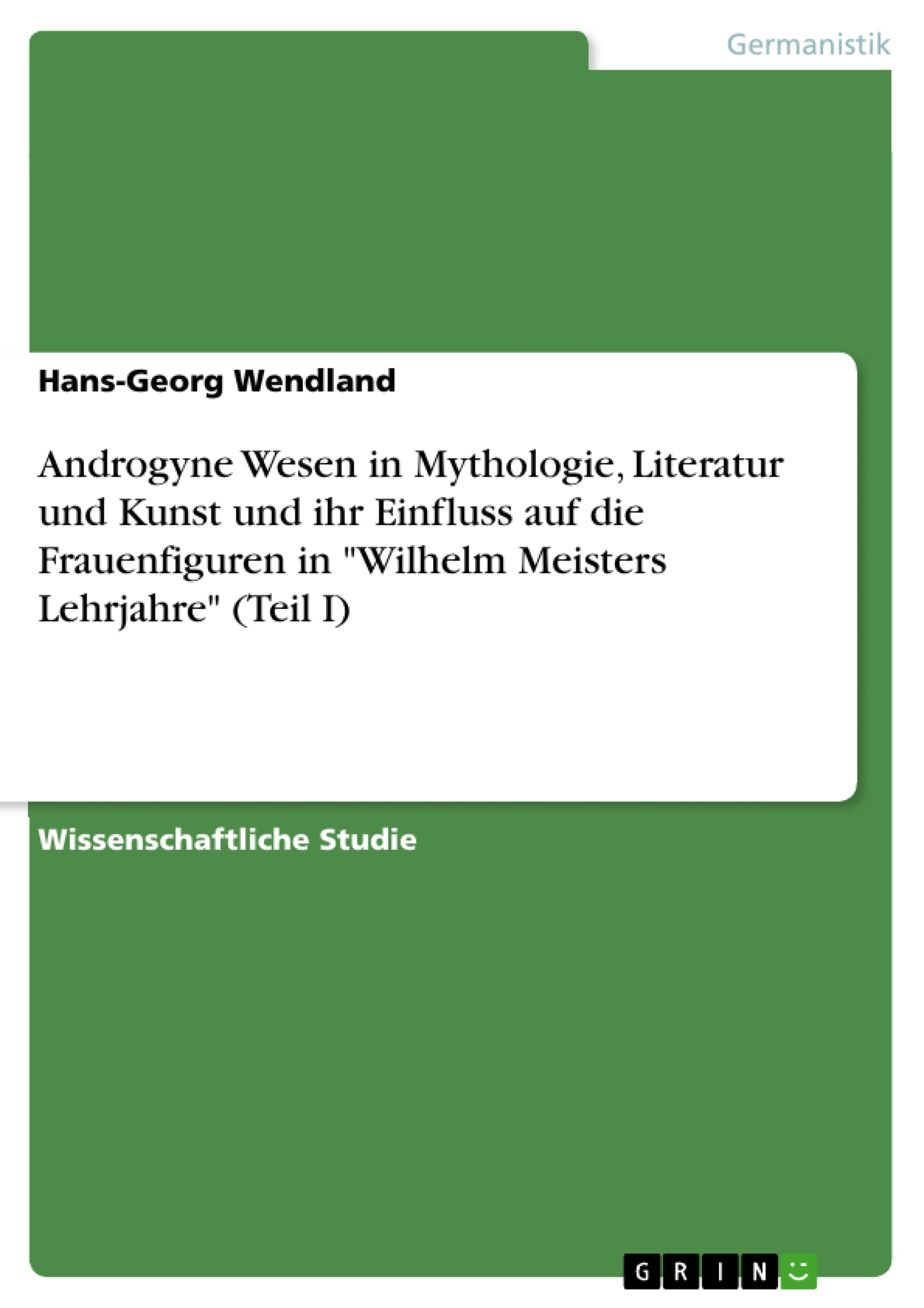Gegenstand dieser Untersuchung ist es herauszufinden, von welchen Ideen Goethe sich hat anregen und inspirieren lassen, aus welchen Quellen er geschöpft und welche Wege er eingeschlagen hat, um die androgynen Frauenfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre zu
gestalten. Es ist bezeichnend, dass Goethe diesen Figuren bestimmte Attribute zuordnet und sie mit besonderen Merkmalen ausstattet, sowohl ihr äußeres Erscheinungsbild als auch ihr inneres Wesen betreffend. Ferner ist von Interesse, wie diese Figuren miteinander
verbunden und verflochten sind und wie sie interagieren. Es wird sich zeigen, dass zwischen ihnen Ähnlichkeiten, Parallelen, Analogien und Gemeinsamkeiten bestehen, sie sich in wichtigen Aspekten aber auch voneinander unterscheiden und gegeneinander abgrenzen.
Konkret geht es darum, Goethes Auffassung des Androgyniebegriffs und das Verhältnis dieser Figuren zu mythologischen, literarischen und künstlerischen Bezugsgrößen und Vorbildern zu untersuchen. Kultur- und geistesgeschichtlich betrachtet steht Goethe in einer
langen Tradition, die bis in die Antike zurückreicht, und dies findet seinen Niederschlag in der Gestaltung der androgynen Frauenfiguren seines Romans.
In bestimmten Zusammenhängen bietet es sich an, einen Vergleich zwischen der ursprünglichen Version des Romans, Wilhelm Meisters Theatralische Sendung, und der endgültigen Fassung der Lehrjahre vorzunehmen und Verbindungslinien zwischen beiden Versionen zu ziehen, um nachzuweisen, dass Goethe die Darstellung diese Figuren in mancher Hinsicht verändert hat, und herauszufinden, welcher Gesinnungswandel sich dahinter verbirgt. Durch seine Italienreise (1786 - 1788) hatte sich Goethes Welt- und Menschenbild
bedeutend erweitert. Unter dem Einfluss Friedrich Schillers und Wilhelm von Humboldts entwickelte er eine Konzeption, in der Wilhelms Theater- und Shakespearebegeisterung aus einem neuen Blickwinkel gesehen wird, autobiographische Elemente zurückgedrängt werden und eine stärkere Typisierung und Idealisierung der Figuren im Sinne eines klassischen Humanitätsgedankens vorgenommen wird.
Die Betrachtung wird ergänzt und abgerundet durch die Einbeziehung einiger Kontrastfiguren, um die androgynen Merkmale der hier behandelten Frauenfiguren deutlicher herauszuarbeiten und sie stärker zu profilieren, z. B. durch die männliche Figur des Narciß,
die ebenfalls androgyne Züge aufweist, vor allem aber durch Philine, die sich von den androgyn geprägten weiblichen Figuren deutlich abhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Androgynie und verwandte Begriffe
- Androgynie - Hermaphroditismus - Bisexualität und Intersexualität
- Androgynie in der griechischen Mythologie
- Androgyne Gottheiten
- Androgyne Wesen in Menschengestalt: Schöpfungsmythen
- Exkurs: Goethes Urworte Orphisch
- Die Entwicklung des Androgyniebegriffes bei Goethe
- Androgyne Frauen und ihre Kontrastfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Mariane, der junge Offizier, Wilhelms erste Liebe
- Chlorinde in Tassos Das Befreite Jerusalem
- Stratonike und Der Kranke Königssohn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung erforscht Goethes Inspirationen und Quellen für die Gestaltung androgynischer Frauenfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre. Im Fokus steht die Analyse der von Goethe diesen Figuren zugeschriebenen Attribute, sowohl äußerlich als auch innerlich, sowie deren Verbindungen und Interaktionen. Es werden Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Figuren untersucht, sowie Goethes Androgyniebegriff und dessen Bezug zu mythologischen, literarischen und künstlerischen Vorbildern. Die Entwicklung von Goethes Sichtweise im Kontext seiner Italienreise und unter dem Einfluss von Schiller und Humboldt wird ebenfalls beleuchtet.
- Goethes Androgyniebegriff und seine Darstellung in Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Die Analyse androgynischer Frauenfiguren in Goethe's Werk und ihre Beziehungen zueinander
- Der Einfluss griechischer Mythologie und Literatur auf Goethes Figuren
- Vergleich der Figuren mit Kontrastfiguren (z.B. Philine)
- Die Entwicklung von Goethes Konzeption im Kontext seiner persönlichen Entwicklung und seines intellektuellen Umfelds
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Untersuchung: die Analyse der Quellen und Inspirationen Goethes für die Gestaltung androgynischer Frauenfiguren in "Wilhelm Meisters Lehrjahre". Es wird die Bedeutung der von Goethe gewählten Attribute und die Verbindungen zwischen den Figuren hervorgehoben. Der Einfluss der griechischen Antike auf Goethes Werk und die Bedeutung der Vergleichsanalyse mit Kontrastfiguren werden ebenfalls angesprochen. Die Arbeit betont auch die Grenzen des gewählten Interpretationsansatzes und die Möglichkeit anderer Deutungsansätze.
Der Begriff der Androgynie und verwandte Begriffe: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Androgynie und seine Ambivalenz, die sich in positiven und negativen Konnotationen zeigt. Es wird ein Vergleich mit verwandten Begriffen wie Hermaphroditismus, Bisexualität und Intersexualität gezogen und deren unterschiedliche Bedeutungen und Interpretationen im historischen Kontext herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Begriffe in Bezug auf ihren mythologischen Ursprung und deren Relevanz für die Figuren in Goethes Werk.
Androgynie in der griechischen Mythologie: Hier wird die Bedeutung der Androgynie in der griechischen Mythologie dargestellt. Es werden androgyne Gottheiten und Schöpfungsmythen analysiert, um den historischen und kulturellen Kontext für Goethes Androgynieverständnis zu beleuchten. Besonders die Ambivalenz der Androgynie, sowohl als abwertendes als auch als ideales Bild, wird herausgestellt, ebenso wie die Rolle der Mutter Erde (Gaia) und die Entwicklung von einem matriarchalischen zu einem patriarchalischen System. Das Beispiel von Hermaphroditos und Salmakis illustriert die Verschmelzung von männlichen und weiblichen Prinzipien.
Androgyne Wesen in Menschengestalt: Schöpfungsmythen: Das Kapitel analysiert Schöpfungsmythen, die von einem ursprünglichen, doppelgeschlechtlichen Wesen ausgehen, wie Platons Beschreibung im Symposion. Es wird die Verbindung zwischen dem kosmischen und dem menschlichen Aspekt des Eros untersucht und die ambivalente Haltung gegenüber dem Androgynen beleuchtet. Die Geschichte der Trennung des ursprünglichen Wesens in zwei Hälften und das damit verbundene Streben nach Vereinigung wird als zentrale Metapher für das menschliche Verlangen nach Ganzheit interpretiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Eros als heilender Kraft und seiner Wiederkehr in Goethes Werk.
Schlüsselwörter
Androgynie, Hermaphroditismus, Bisexualität, Intersexualität, griechische Mythologie, Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Frauenfiguren, Kontrastfiguren, Eros, Schöpfungsmythos, Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schiller, klassischer Humanismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Goethes Androgyniebegriff und seine Darstellung in Wilhelm Meisters Lehrjahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Goethes Inspirationen und Quellen für die Gestaltung androgynischer Frauenfiguren in seinem Werk "Wilhelm Meisters Lehrjahre". Im Mittelpunkt steht die Analyse der von Goethe diesen Figuren zugeschriebenen Attribute (äußerlich und innerlich), ihrer Beziehungen und Interaktionen, sowie die Entwicklung seines Androgyniebegriffs im Kontext seiner Biographie und seines intellektuellen Umfelds (Schiller, Humboldt, Italienreise).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Goethes Androgyniebegriff und dessen Darstellung in "Wilhelm Meisters Lehrjahre", die Analyse androgynischer Frauenfiguren und ihrer Beziehungen zueinander, der Einfluss der griechischen Mythologie und Literatur auf Goethes Figuren, ein Vergleich der Figuren mit Kontrastfiguren (z.B. Philine), und die Entwicklung von Goethes Konzeption im Kontext seiner persönlichen und intellektuellen Entwicklung.
Welche Figuren werden analysiert?
Im Fokus stehen androgyne Frauenfiguren aus "Wilhelm Meisters Lehrjahre", wie beispielsweise Mariane, und deren Vergleich mit Kontrastfiguren. Die Arbeit bezieht sich auch auf Chlorinde aus Tassos "Das befreite Jerusalem" und Stratonike aus "Der Kranke Königssohn". Die Analyse der Figuren beinhaltet die Untersuchung ihrer äußeren und inneren Attribute und deren Verbindungen.
Welche Rolle spielt die griechische Mythologie?
Die griechische Mythologie spielt eine zentrale Rolle, da sie als wichtige Inspirationsquelle für Goethes Androgynieverständnis betrachtet wird. Die Arbeit analysiert androgyne Gottheiten und Schöpfungsmythen der griechischen Mythologie, um den historischen und kulturellen Kontext für Goethes Werk zu beleuchten. Besonders die Ambivalenz der Androgynie (als abwertendes und ideales Bild) und die Rolle der Mutter Erde (Gaia) werden untersucht.
Wie wird der Begriff "Androgynie" definiert?
Das Kapitel "Der Begriff der Androgynie und verwandte Begriffe" definiert den Begriff und seine Ambivalenz (positive und negative Konnotationen). Es werden Vergleiche mit verwandten Begriffen wie Hermaphroditismus, Bisexualität und Intersexualität gezogen, und deren unterschiedliche Bedeutungen und Interpretationen im historischen Kontext herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Begriffe im Hinblick auf ihren mythologischen Ursprung und ihre Relevanz für die Figuren in Goethes Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Begriff der Androgynie und verwandte Begriffe, Androgynie in der griechischen Mythologie (inkl. Androgyne Gottheiten und Schöpfungsmythen), Exkurs: Goethes Urworte Orphisch, Die Entwicklung des Androgyniebegriffes bei Goethe, Androgyne Frauen und ihre Kontrastfiguren in Wilhelm Meisters Lehrjahre (inkl. Mariane, Chlorinde, Stratonike).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Androgynie, Hermaphroditismus, Bisexualität, Intersexualität, griechische Mythologie, Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Frauenfiguren, Kontrastfiguren, Eros, Schöpfungsmythos, Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schiller, klassischer Humanismus.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über Goethes Inspirationen und die Entwicklung seines Androgyniebegriffs. Sie analysiert die Beziehungen zwischen den androgynen Frauenfiguren und ihren Kontrastfiguren und beleuchtet den Einfluss der griechischen Mythologie und Goethes intellektuelles Umfeld auf seine literarische Gestaltung. Die Einleitung erwähnt auch die Grenzen des gewählten Interpretationsansatzes und die Möglichkeit anderer Deutungsansätze.
- Quote paper
- Hans-Georg Wendland (Author), 2011, Androgyne Wesen in Mythologie, Literatur und Kunst und ihr Einfluss auf die Frauenfiguren in "Wilhelm Meisters Lehrjahre" (Teil I), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182896