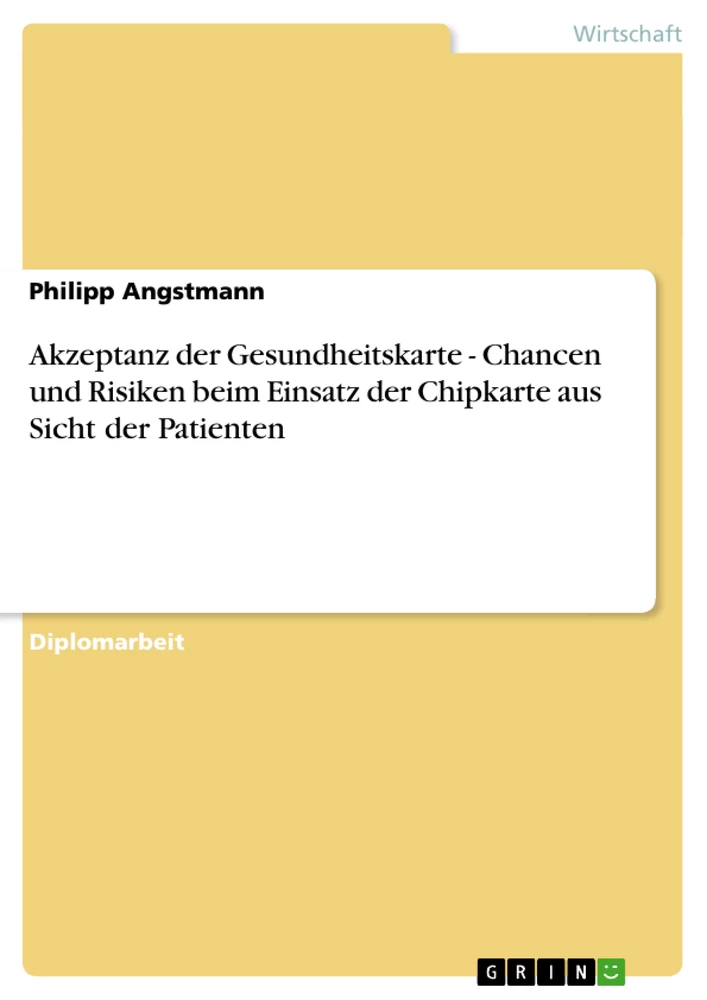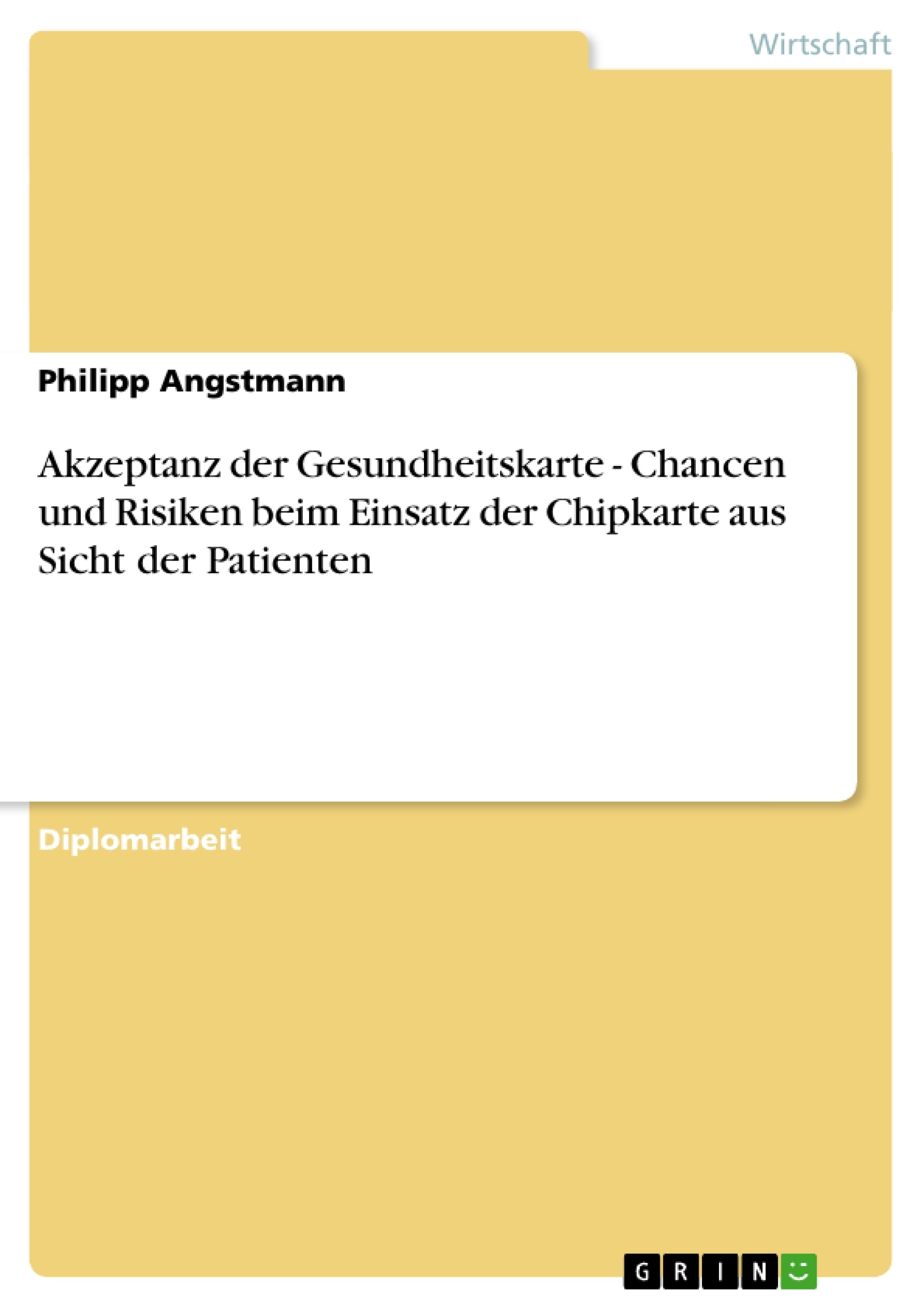Eine Arbeit über öffentliches Trustmanagement (Vertrauensbildende Massnahmen) für Informatikprodukte mit sehr sensitiven, persönlichen Daten.
In dieser Arbeiten werden Problembilder analysiert, Lösungsvorschläge diskutiert und Killerfaktoren aufgezeigt.
Management Summary
Beschreibung des Projektes Gesundheitskarte
Die Gesundheitskarte erlaubt den Patienten den Zugriff auf die persönlichen
Computerbasierten Patientendossiers. Dadurch können die Patienten nicht nur
mehr Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen sondern auch
Diplomarbeit Angstmann – Management Summary 2
die Zugriffsberechtigung auf ihre Dossiers steuern. Dies erleichtert die Koordination
unter den Leistungserbringern erheblich. Durch die ebenfalls entstehende
Leistungstransparenz und der damit möglichen Kontrolle ist es für die Leistungserbringer
unumgänglich jegliche medizinischen Handlungen und Untersuche zu
protokollieren. So können zudem Fehlbehandlungen vermindert und unangemessene
Therapien und Doppelspurigkeiten verhindert werden, wodurch wiederum
Kosten gesenkt werden können. Weiter kann aufgrund der Abrechnungsautomation
und dadurch, dass keine Formulare mehr ausgefüllt, verarbeitet sowie aufbewahrt
werden müssen weitgehend auf administrative Arbeiten verzichtet werden.
Dies erlaubt bei mehreren Anspruchsgruppen nochmals Geld einzusparen.
Polarisiert ausgedrückt ergeben sich für die Patienten folgenden Nutzen:
• Qualitätsverbesserung
• Prämiensenkung
• Zeiteinsparung
• Empowerment
Inhaltsverzeichnis
- Management Summary
- Ausgangslage
- Beschreibung des Projektes Gesundheitskarte
- Problembilder
- Lösungsvorschlag
- Killerfaktoren für das Projekt Gesundheitskarte
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Akzeptanz der Gesundheitskarte Schweiz aus der Perspektive der Patienten. Die Arbeit beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit dem Einsatz der Karte verbunden sind, und analysiert die Faktoren, die die Akzeptanz der Patienten beeinflussen können.
- Bewertung der Chancen und Risiken der Gesundheitskarte
- Analyse der Akzeptanzfaktoren aus Patientensicht
- Identifizierung von Killerfaktoren, die die Akzeptanz gefährden
- Entwicklung von Lösungsvorschlägen zur Steigerung der Akzeptanz
- Bewertung der Rolle der Gesundheitskarte im Schweizer Gesundheitssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Management Summary
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Ausgangslage, die Beschreibung des Projekts Gesundheitskarte, die Problemfelder, die Lösungsvorschläge und die möglichen Killerfaktoren. Es wird ein kurzer Einblick in die Schlussbetrachtung gegeben.
Ausgangslage
Die Gesundheitskosten in der Schweiz steigen seit Jahren stark an. Der Bundesrat hat beschlossen, eine Gesundheitskarte einzuführen, um das Gesundheitssystem zu sanieren und Kosteneinsparungen zu erzielen. Die relevanten Anspruchsgruppen rund um die Gesundheitskarte sind Krankenkassen, Patienten, Leistungserbringer und Lösungsanbieter.
Beschreibung des Projektes Gesundheitskarte
Die Gesundheitskarte soll den Patienten den Zugriff auf ihre persönlichen, computerbasierten Patientendossiers ermöglichen. Dies soll die Eigenverantwortung der Patienten fördern, die Koordination zwischen Leistungserbringern verbessern und durch Leistungstransparenz und Abrechnungsautomation Kosten senken.
Problembilder
Die Einführung der Gesundheitskarte ist nicht einfach. Der Bund steht sich aufgrund des Föderalismus und der damit verbundenen Kantonsautonomie im Weg. Auch die unterschiedlichen Interessen der Anspruchsgruppen erschweren die gemeinsame Lösungsfindung. Aus Patientensicht bestehen Herausforderungen wie die Dringlichkeit des Mitführens der Karte, die Informationsdefizite und die Gewährleistung des Datenschutzes.
Lösungsvorschlag
Um die Akzeptanz der Patienten zu gewinnen, ist eine flächendeckende Anwendbarkeit der Karte, sowie intensive Öffentlichkeitsarbeit und Werbeaktionen notwendig. Zudem ist eine individuelle Beratung der Patienten unerlässlich.
Killerfaktoren für das Projekt Gesundheitskarte
Faktoren, die die Akzeptanz der Patienten gefährden können, sind Datendiebstahl, Datenmissbrauch, fehlende gesetzliche Grundlagen, unzureichende Koordination und Zusammenarbeit der Anspruchsgruppen.
Schlüsselwörter
Gesundheitskarte Schweiz, Akzeptanz, Patienten, Chancen, Risiken, Kosten, Datensicherheit, Föderalismus, Anspruchsgruppen, Kommunikation, Marketing, Killerfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Nutzen bietet die Gesundheitskarte für Patienten?
Patienten profitieren von einer Qualitätsverbesserung der Behandlung, möglichen Prämiensenkungen, Zeiteinsparungen und einem größeren „Empowerment“ über ihre Daten.
Was sind die größten Risiken aus Patientensicht?
Zentral sind Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, der Gefahr von Datendiebstahl und des möglichen Missbrauchs sensibler medizinischer Informationen.
Warum erschwert der Föderalismus die Einführung in der Schweiz?
Die Kantonsautonomie führt zu unterschiedlichen Zuständigkeiten und erschwert eine einheitliche, flächendeckende technische Lösung.
Was sind „Killerfaktoren“ für das Projekt Gesundheitskarte?
Dazu zählen fehlende gesetzliche Grundlagen, mangelnde Koordination zwischen den Akteuren und ein Vertrauensverlust durch Sicherheitslücken.
Wie kann die Akzeptanz der Patienten gesteigert werden?
Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit, transparente Information zum Datenschutz und eine individuelle Beratung der Versicherten.
- Quote paper
- Philipp Angstmann (Author), 2003, Akzeptanz der Gesundheitskarte - Chancen und Risiken beim Einsatz der Chipkarte aus Sicht der Patienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18283