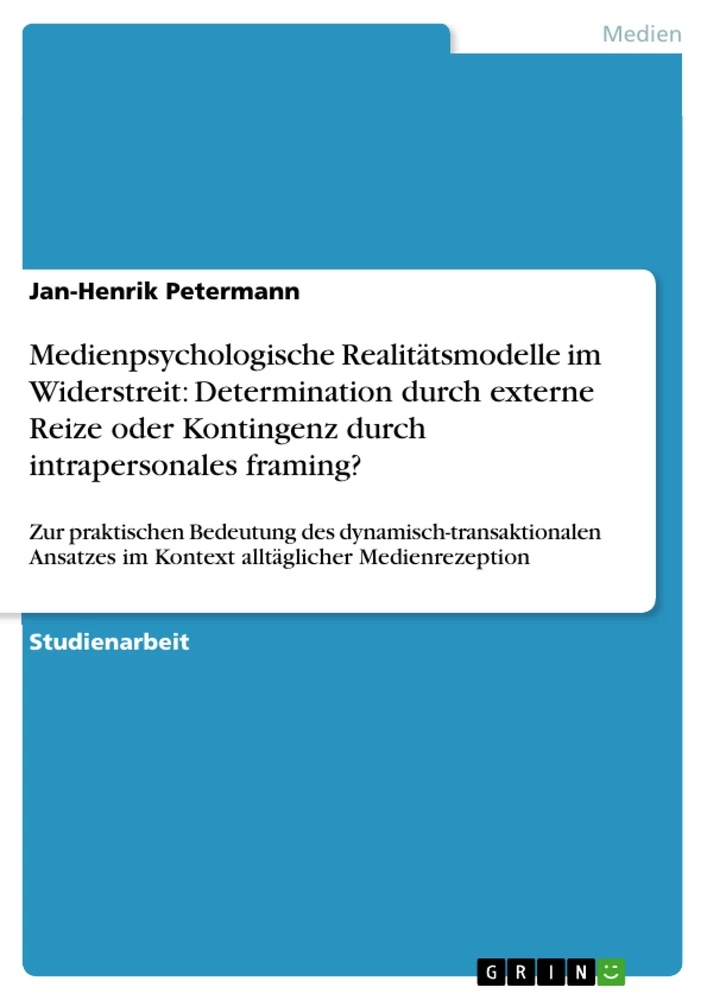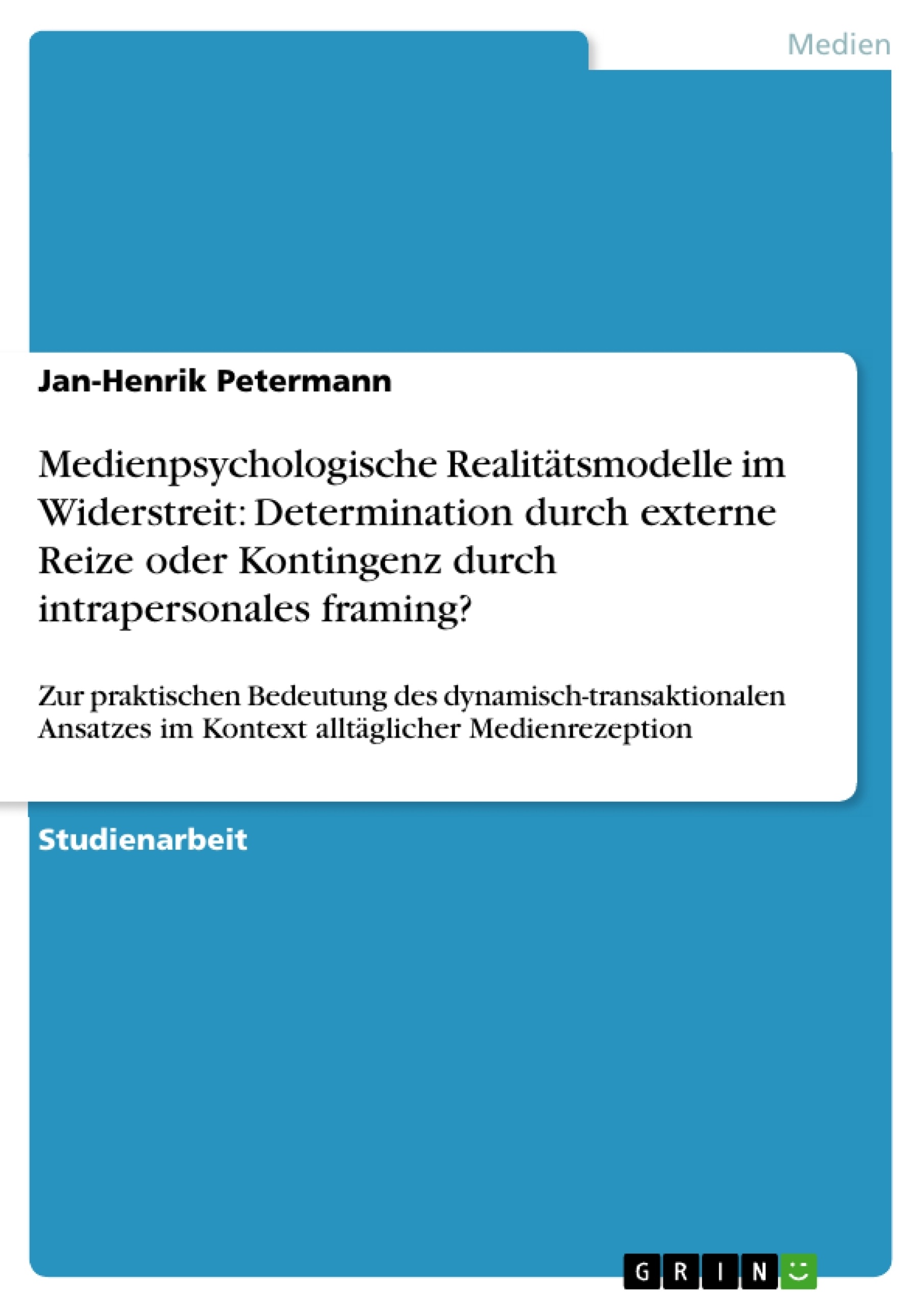Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten und Hypothesen zur individuellen und gesamtgesellschaftlichen Wirkung von Massenmedien gilt als eine der inhaltlich fruchtbarsten, jedoch zugleich am kontroversesten diskutierten Teildisziplinen der Kommunikationswissenschaft. Mehrere Jahrzehnte nach der Formulierung des Stimulus-Response-Modells, welches eine direkte, lineare und einseitige Beeinflussung der "hilflosen" Medienkonsumenten durch die "allmächtigen" Medienproduzenten vermutete, herrscht heute weitgehend Übereinstimmung darüber, dass die ausschließliche Annahme kausaler Wirkungsbeziehungen zwischen Medienbotschaft und Rezipientenwahrnehmung kaum noch haltbar ist.
Doch selbst solche Forscher, die den Großteil des Steuerungsvermögens auf Seiten des Publikums vermuten, legen ein Zwei-Stufen-Konzept des medialen Bedeutungstransfers zu Grunde: Auf die Transformation "äußerer Realität" in eine medialen Symboliken genügende "Medienrealität" folgt schließlich deren Übersetzung in eine "Publikumsrealität". Der vor allem durch den Leipziger Kommunikationswissenschaftler Werner Früh vertretene dynamisch-transaktionale Ansatz (DTA) bietet hierzu ein auch unter wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten besonders erklärungskräftiges Modell an.
Welche fundamentalen Vorstellungen von Medienrealität liegen dieser Modellintegration zugrunde? Und anhand welcher Anwendungs- und Fallbeispiele aus der Alltagsrezeption massenmedialer Kommunikationsangebote lässt sich die besondere Erklärungskraft des DTA veranschaulichen?
Zunächst werden die Grundzüge und Prämissen der Haupttheoriestränge psychologischer Medienwirkungsmodelle aus den vergangenen Jahrzehnten dargestellt. Der darauf folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Kernvorstellungen des DTA, der die zuvor tonangebenden Mainstream-Ansätze der Medienwirkung in ein theoretisch konsistentes Gesamtbild zu überführen versuchte. Es folgen ein Vergleich zwischen dynamisch-transaktionalen und traditionellen Hypothesen der Medienwirkung sowie ein wissenschaftstheoretischer Exkurs, der aufzeigt, weshalb der DTA durchaus als kommunikationswissenschaftliche Spielart eines fächerübergreifenden Paradigmas zur Beschreibung von "Realität" gelten kann, das hinsichtlich seiner wesentlichen Argumentationsstrukturen auch in anderen Teildisziplinen als epistemologisches Konzept zur Anwendung kommt. Anschließend wird die praktische Relevanz des DTA mit Blick auf die alltäglichen Routinen massenmedialer Rezeption untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 Entwicklung der Fragestellung und Ausgrenzung des Themas
- 1.2 Prämissen, Methodik und Gang der Untersuchung
- Medienwirkungsmodelle im Wandel
- 2.1 Linear-kausale Ansätze in der Tradition des Stimulus-Response-Modells
- 2.2 Das „aktive Publikum“ als grundlegender Perspektivenwechsel
- 2.3 Von der Mono- zur Multikausalität: die Untersuchung komplexerer Beeinflussungsmuster vor dem Hintergrund reflexiver Medienrezeption
- Der dynamische Transaktionalismus als integratives Erklärungsmodell: In welcher Wechselbeziehung stehen externe Stimulanz und interne Reinterpretation medialer Botschaften?
- 3.1 Zu den Vorzügen nicht-deterministischer Modelle von Massenkommunikation
- 3.2 Modellvergleich zwischen dynamisch-transaktionalen und „traditionellen“ Hypothesen der Medienwirkung
- 3.2.1 Ähnlichkeiten
- 3.2.2 Unterschiede
- 3.3 Exkurs: die Dynamisierung von Beziehungsmustern als ontologisches und wissenschaftstheoretisches Paradigma
- Zur praktischen Relevanz des dynamisch-transaktionalen Ansatzes: Mächtigkeit der Kommunikatoren versus konstruktivistische Erzeugung individueller „Realität(en)“
- Fazit: Argumente gegen die mediale Konditionierung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Abkürzungen
- Anhang: Zur formalen Modellierung dynamischer Systeme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Bedeutung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes in der Medienwirkungsforschung. Sie analysiert die verschiedenen Konzepte und Modelle, die die Wirkung von Massenmedien auf Individuen und Gesellschaft beschreiben, und zeigt die Grenzen linear-kausalen Denkens auf. Die Arbeit argumentiert für eine integrative Sichtweise, die sowohl die Rolle der Kommunikatoren als auch die aktive Rezeption durch das Publikum berücksichtigt.
- Entwicklung und Kritik linear-kausalen Denkens in der Medienwirkungsforschung
- Das Konzept des „aktiven Publikums“ und die Bedeutung der Rezipientenaktivität
- Der dynamisch-transaktionale Ansatz als integratives Modell der Medienwirkung
- Die praktische Relevanz des dynamisch-transaktionalen Ansatzes im Kontext alltäglicher Medienrezeption
- Argumente gegen die mediale Konditionierung und die Bedeutung individueller Interpretationsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Medienwirkungsforschung ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie lässt sich die Wirkung von Massenmedien vor dem Hintergrund der komplexen Wechselbeziehung zwischen Kommunikatoren und Rezipienten erklären?
Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der Medienwirkungsmodelle vom linearen Stimulus-Response-Modell hin zu komplexeren Ansätzen, die die aktive Rolle des Publikums und die Bedeutung individueller Interpretationsprozesse berücksichtigen.
Kapitel 3 stellt den dynamisch-transaktionalen Ansatz (DTA) als integratives Erklärungsmodell vor. Der DTA betont die dynamische Wechselwirkung zwischen externen Stimuli und internen Reinterpretationsprozessen und bietet eine umfassendere Perspektive auf die Medienwirkung.
Kapitel 4 untersucht die praktische Relevanz des DTA im Kontext alltäglicher Medienrezeption. Es werden Beispiele aus der Medienlandschaft aufgezeigt, die die Bedeutung individueller Interpretationen und die Grenzen der medialen Konditionierung verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Medienwirkungsforschung, dynamisch-transaktionaler Ansatz, Medienrezeption, Rezipientenaktivität, Kommunikatoren, Medienrealität, individuelle Interpretation, framing, Konditionierung, Alltagskommunikation, Informationsgesellschaft.
- Quote paper
- Dipl.-Pol., MSc (IR) Jan-Henrik Petermann (Author), 2004, Medienpsychologische Realitätsmodelle im Widerstreit: Determination durch externe Reize oder Kontingenz durch intrapersonales framing?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182604