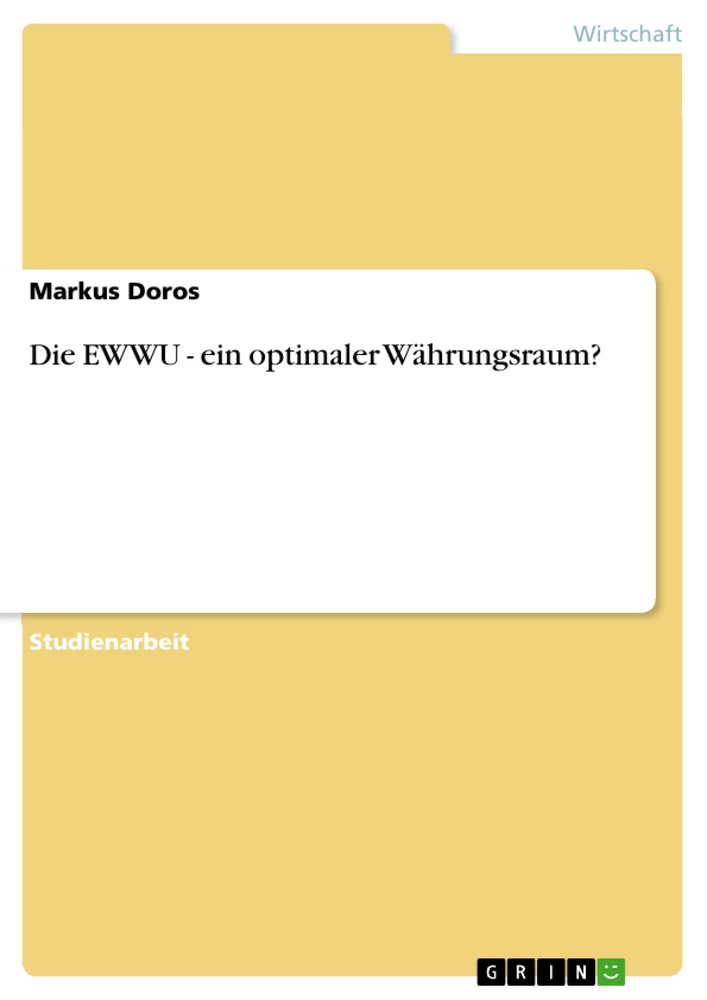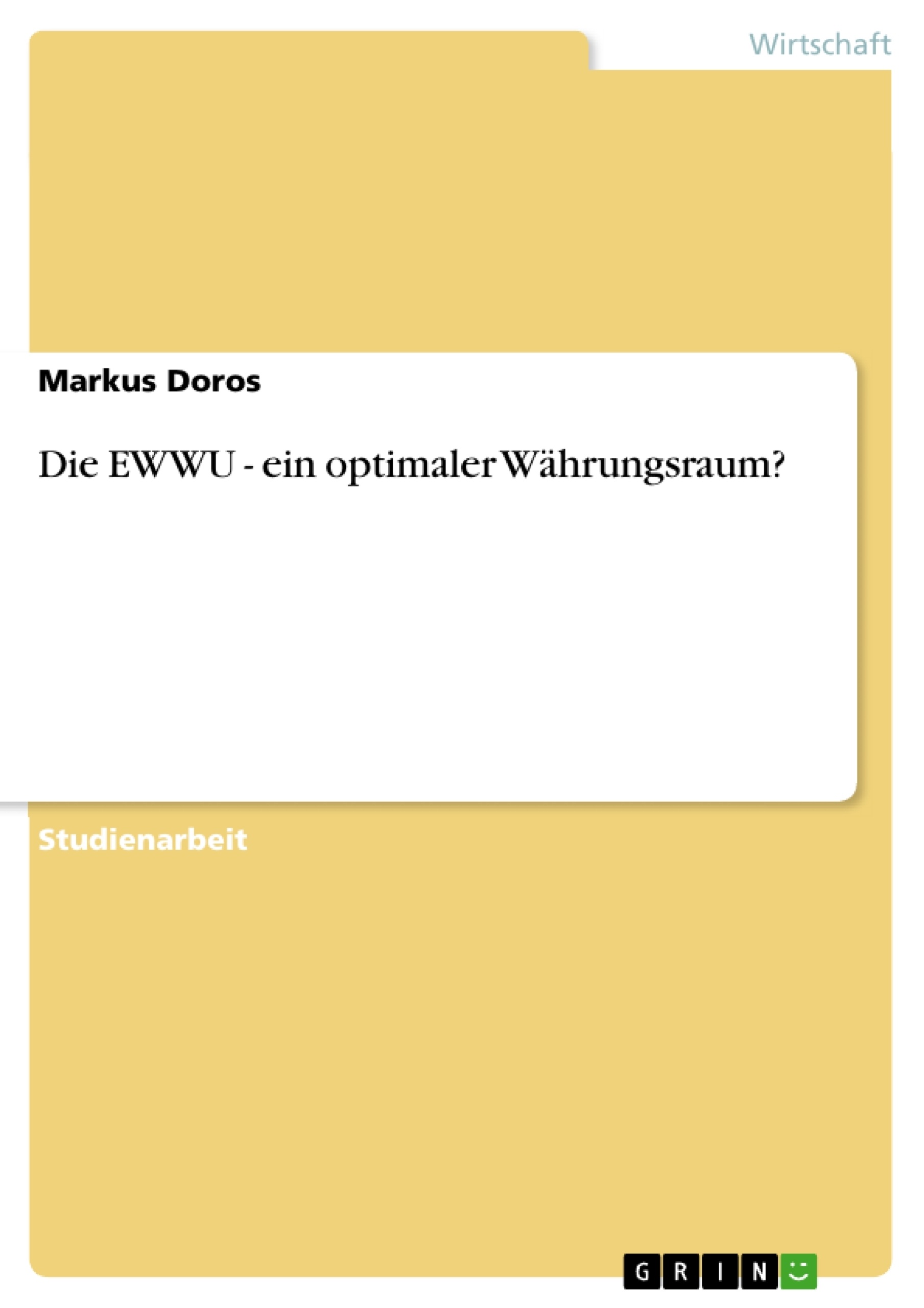Der Abschluss des Drei-Stufen-Plans im Jahr 1999 zur Schaffung der Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) mit der unwiderruflichen Festlegung der Wechselkurse und der Einführung des Euro als offizieller Gemeinschaftswährung im Jahr 2002 in
elf der damaligen 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) stellt einen wesentlichen Meilenstein in der Europäischen Integration seit Unterzeichnung der Römischen
Verträge im Jahr 1957 dar. Der Wille zu einem Europäischen Integrationsprozess entspringt der Geschichte Europas, die von zwei Weltkriegen geprägt ist. Parallel zu dieser
politischen Entwicklung zeichnete sich in akademischen Kreisen die Frage nach der Optimalität von Währungsunionen ab. In diesem Zusammenhang wurde in den 1960er Jahren
die traditionelle Theorie optimaler Währungsräume (engl. optimum currency area theory,
OCA-Theorie) generiert, die Kriterien zur Beurteilung der Optimalität von Währungsräumen definiert. Mangels geeigneten Forschungsobjektes und Praxisrelevanz blieb dieser
Forschungszweig jedoch lange Zeit auf rein theoretischer Ebene und war „[...]for years
consigned to intellectual limbo.“. Erst im Zuge konkreter politischer Pläne zur Gründung
einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erhielt dieser Forschungsbereich frischen Aufwind und führte so zu tiefergehenden Erforschungen der Kriterien sowie deren
Wechselwirkung zur Bewertung optimaler Währungsräume und führte somit zur Weiterentwicklung der traditionellen OCA-Theorie. Im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses und insbesondere der damit einhergehenden Einführung des Euros 2002 stellt
sich die Frage ob die EWWU einen optimalen Währungsraum bildet. Ausgelöst durch die
Weltwirtschaftskrise und der übermäßigen Verschuldung vieler EWWU-Mitgliedsstaaten
findet gerade aktuell eine kontroverse Diskussion über die Vor- und Nachteile der EWWU
statt und gewinnt auch in Zukunft zunehmend an Bedeutung. In dieser Seminararbeit werden die wichtigsten Entwicklungen der Theorie optimaler Währungsräume dargestellt und
anhand dieser, analysiert, ob es sich bei der EWWU um einen optimalen Währungsraum
handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff des optimalen Währungsraums
- Die Theorie optimaler Währungsräume
- Die traditionelle Theorie optimaler Währungsräume
- Der Grad an Faktormobilität
- Der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft
- Die Diversifikation von Produktion
- Weiterentwicklungen der Theorie optimaler Währungsräume
- Der alternative Ansatz einer Kosten-Nutzen-Analyse
- Zukunftsorientierte Ansätze der Theorie optimaler Währungsräume
- Die Endogenitätshypothese
- Die Spezialisierungshypothese
- Kritische Betrachtung der Theorie optimaler Währungsräume
- Die EWWU im Hinblick der Theorie optimaler Währungsräume
- Untersuchung der EWWU anhand der traditionellen Kriterien
- Kosten-Nutzen-Analyse einer EWWU-Teilnahme
- Der Nutzen
- Die Kosten
- Bewertung der Ergebnisse
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- A. Anhang
- Die traditionelle Theorie optimaler Währungsräume
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) einen optimalen Währungsraum bildet. Dazu werden die wichtigsten Entwicklungen der Theorie optimaler Währungsräume dargestellt und anhand dieser analysiert, ob die EWWU die Kriterien für einen optimalen Währungsraum erfüllt.
- Die traditionelle Theorie optimaler Währungsräume und ihre Kriterien
- Weiterentwicklungen der Theorie optimaler Währungsräume, insbesondere der Kosten-Nutzen-Ansatz
- Anwendung der Theorie auf die EWWU, insbesondere die Analyse der Faktormobilität, des Offenheitsgrades und der Diversifikation der Produktion
- Bewertung der EWWU im Hinblick auf die Kriterien optimaler Währungsräume
- Diskussion der Vor- und Nachteile der EWWU im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der EWWU und die Entstehung der Theorie optimaler Währungsräume dar. Sie führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz der Fragestellung, ob die EWWU einen optimalen Währungsraum bildet.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff des optimalen Währungsraums und erläutert die verschiedenen Kriterien, die zur Beurteilung der Optimalität von Währungsräumen herangezogen werden können.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Theorie optimaler Währungsräume. Es werden die traditionellen Kriterien der Theorie vorgestellt und kritisch betrachtet. Darüber hinaus werden Weiterentwicklungen der Theorie, insbesondere der Kosten-Nutzen-Ansatz, erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert die EWWU im Hinblick auf die Theorie optimaler Währungsräume. Es werden die traditionellen Kriterien auf die EWWU angewendet und eine Kosten-Nutzen-Analyse der EWWU-Teilnahme durchgeführt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), die Theorie optimaler Währungsräume (OCA-Theorie), die Kriterien für einen optimalen Währungsraum, die Faktormobilität, der Offenheitsgrad, die Diversifikation der Produktion, die Kosten-Nutzen-Analyse, die Vor- und Nachteile der EWWU sowie die aktuelle Wirtschaftskrise.
- Quote paper
- Markus Doros (Author), 2010, Die EWWU - ein optimaler Währungsraum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182476