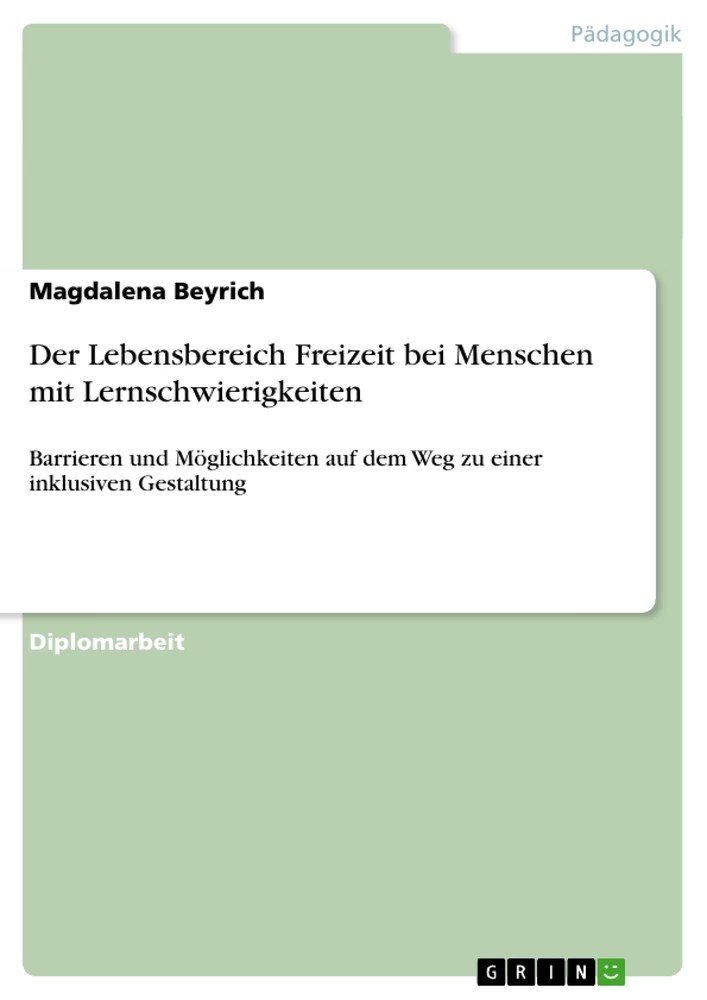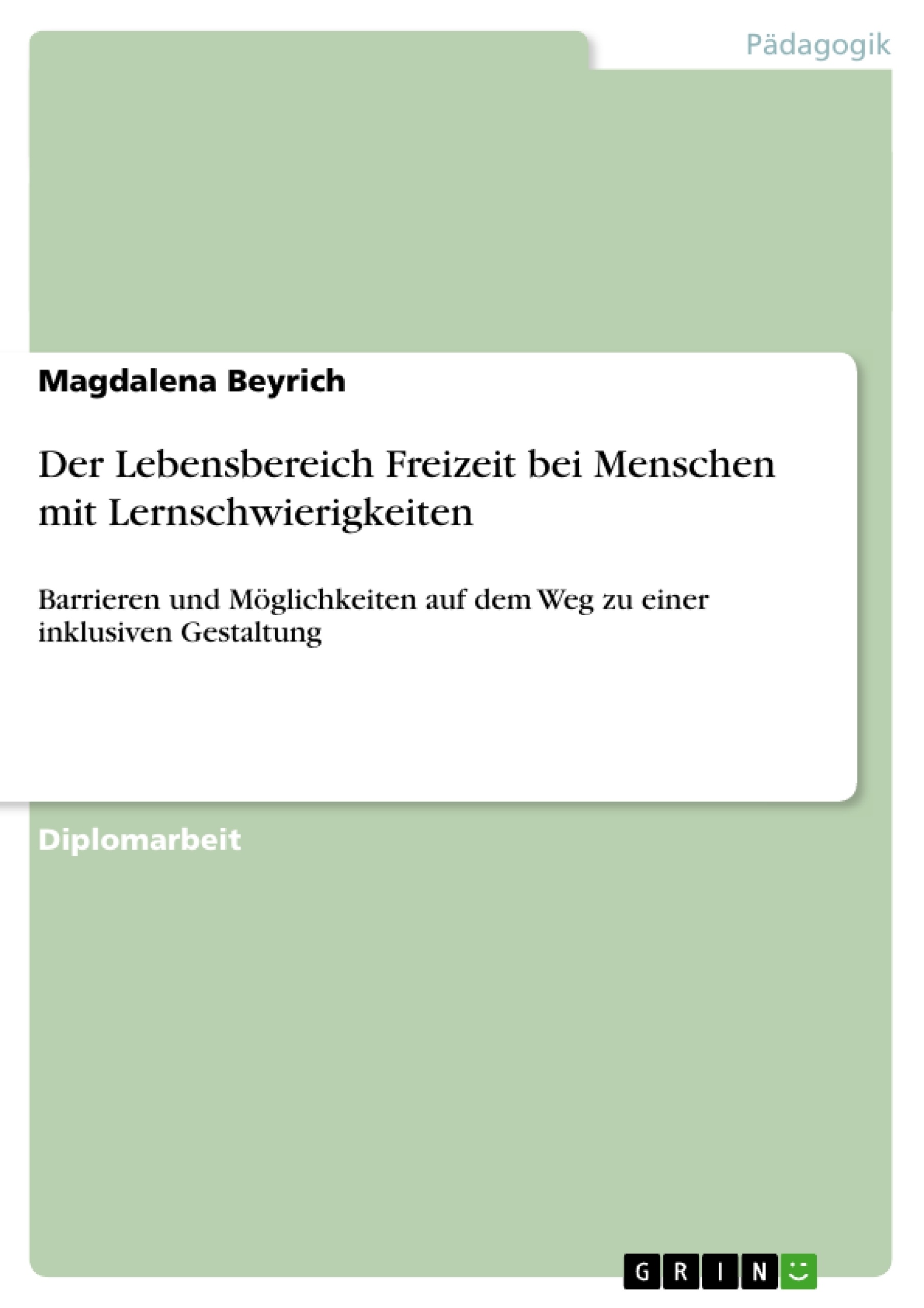Einleitung
Sehr oft gibt es ausführliche und
vertiefende Gedanken zu Modellen und aktuellen Entwicklungen in den
Bereichen Wohnen und Arbeiten für Menschen mit spezifischen Lebenserschwernissen. Solch tiefgreifende Überlegungen wurden im Bereich der Freizeitgestaltung bisher seltener vorgenommen, auch wenn dieser Lebensbereich immer mehr in die Diskussion kommt.
In der vorliegenden Arbeit werde ich mich kritisch-konstruktiv mit der Fragestellung auseinandersetzen, inwieweit die Heilpädagogik durch die Umsetzung neuerer Konzepte einen wesentlichen Beitrag zur inklusiven Freizeitgestaltung von Menschen mit Lernschwierigkeiten beitragen kann. Dabei soll eine Antwort darauf gefunden werden, welche Barrieren für die Teilhabe aktuell existieren. Weiterhin wird beleuchtet, welche Voraussetzungen auf gesellschaftlicher und individueller Ebene geschaffen werden müssen, um eine aktive Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen
mit speziellen Bedürfnissen, konkret im Lebensbereich Freizeit zu
gewährleisten. Letztendlich ist zu resümieren, welche Zukunftsperspektiven sich daraus für Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen eröffnen.
Nach einer kurzen Einführung des Personenkreises wird dargelegt, welche Bedeutung Freizeit im täglichen Leben von Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten hat. Außerdem soll hervorgehoben werden, welche Besonderheiten bzw. Einschränkungen sich für den Personenkreis ergeben, und ein kurzer Abriss der momentanen Freizeitsituation von Menschen mit Lernschwierigkeiten gegeben werden. Danach wird das Wesen des Inklusionsgedankens dargelegt und davon ausgehend erörtert, was eine inklusive Gestaltung von
Freizeitangeboten für alle bedeutet. Unter anderem wird auch darauf eingegangen, welche strukturellen Voraussetzungen damit verbunden sind, der Vision einer inklusiven Bürgergesellschaft ein Stück näher zu kommen. In dem Zusammenhang werden aktuelle Barrieren für die Teilhabe aller an Freizeitangeboten im Gemeinwesen deutlich. Exemplarisch folgt die Erörterung
einer Möglichkeit und den damit verbundenen Voraussetzungen, wie
durch die Freizeitassistenz als ein angemessenes Angebot und Begleitungsmodell ein Beitrag in Richtung Inklusion geleistet werden kann. Im Abschluss der Arbeit werden
Schlussfolgerungen für die Heilpädagogik und Handlungsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Personenkreis
- Definitionen
- Behinderung laut WHO
- Geistige Behinderung
- Diskussion der Begrifflichkeit
- Definitionen
- Der Lebensbereich Freizeit
- Erklärungsansätze und Definition
- Historische Entwicklung des Freizeitverständnisses
- Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert
- Aktuelle Sichtweisen
- Freizeitverhalten von Menschen mit Lernschwierigkeiten im historischen Kontext
- Formen der Freizeitgestaltung
- Der Lebensbereich Freizeit bei Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Einfluss des Freizeiterlebens auf die Lebensqualität
- Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung
- Exkurs: Freizeitkompetenz als Voraussetzung
- Determinanten der Freizeitgestaltung
- Erschwernisse für die Freizeitgestaltung
- Zur Situation der Freizeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Empirische Studien in Deutschland
- Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse
- Inklusion
- Definition
- Wurzeln und Entwicklung des Inklusionsgedankens
- Entstehung des Begriffs
- Von der Exklusion zur Inklusion in Deutschland
- Reflexion zur begrifflichen Verwendung
- Aktuelle inklusive Tendenzen
- International
- National
- Gesetzliche Regelungen
- Entwicklungen in der Heilpädagogik
- Voraussetzungen und Bedingungen
- Zusammenfassung wesentlicher Aspekte
- Der Inklusionsprozess im Lebensbereich Freizeit
- Bedeutung heilpädagogischer Leitprinzipien
- Selbstbestimmung
- Partizipation und Teilhabe
- Empowerment
- Fazit
- Gestaltungsmöglichkeiten auf verschiedenen Handlungsebenen
- Subjektzentrierte Ebene
- Gruppenbezogene Ebene
- Institutionelle Ebene
- Sozialpolitische Ebene
- Fazit
- Heilpädagogische Handlungsmöglichkeiten
- Prozessgestaltung im Sinne heilpädagogischen Handelns
- Reflexion – Chancen und Grenzen erfolgreicher Inklusion
- Das Assistenzmodell als Handlungskonzept der Heilpädagogik
- Assistenz als Dienstleistungsmodell
- Hintergrund des Assistenzgedankens
- Kritische Reflexion und Rolle des Heilpädagogen
- Umsetzung im Lebensbereich Freizeit
- Freizeitassistenz in der Praxis: IDEAL e. V.
- Die Arbeit des Vereins
- Zusammenfassende Bemerkungen zu IDEAL e. V.
- Zusammenfassung und Reflexion
- Assistenz als Dienstleistungsmodell
- Bedeutung heilpädagogischer Leitprinzipien
- Resümee und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Gesprächsprotokoll
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Lebensbereich Freizeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten und analysiert die Barrieren und Möglichkeiten auf dem Weg zu einer inklusiven Gestaltung. Ziel ist es, die aktuelle Situation der Freizeitgestaltung für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu beleuchten, die Herausforderungen und Chancen der Inklusion im Freizeitbereich zu diskutieren und Handlungsempfehlungen für eine inklusive Gestaltung des Lebensbereichs Freizeit zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Lernschwierigkeiten"
- Entwicklung und aktuelle Sichtweisen des Freizeitverständnisses
- Bedürfnisse und Determinanten der Freizeitgestaltung von Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Inklusionskonzepte und ihre Bedeutung für die Freizeitgestaltung
- Handlungsmöglichkeiten und -konzepte für eine inklusive Gestaltung des Lebensbereichs Freizeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in die Thematik ein. Sie beschreibt die Situation eines jungen Mannes mit Lernschwierigkeiten, der Schwierigkeiten hat, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Dies verdeutlicht die Problematik, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oft nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung haben. Die Einleitung dient als Motivation für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Personenkreis der Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden verschiedene Definitionen von Behinderung, insbesondere die Definition der WHO, sowie der Begriff der geistigen Behinderung erläutert. Die Diskussion der Begrifflichkeit soll zu einem besseren Verständnis des Personenkreises beitragen.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Lebensbereich Freizeit. Es werden verschiedene Erklärungsansätze und Definitionen von Freizeit vorgestellt, sowie die historische Entwicklung des Freizeitverständnisses beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Freizeitverhalten von Menschen mit Lernschwierigkeiten im historischen Kontext. Es werden verschiedene Formen der Freizeitgestaltung aufgezeigt und die Bedeutung des Freizeiterlebens für die Lebensqualität von Menschen mit Lernschwierigkeiten hervorgehoben. Des Weiteren werden die Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung, die Determinanten der Freizeitgestaltung sowie die Erschwernisse für die Freizeitgestaltung von Menschen mit Lernschwierigkeiten analysiert. Die Situation der Freizeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten wird anhand von empirischen Studien in Deutschland beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Thema Inklusion. Es wird eine Definition von Inklusion gegeben und die Wurzeln und Entwicklung des Inklusionsgedankens erläutert. Die Entstehung des Begriffs, die Entwicklung von der Exklusion zur Inklusion in Deutschland und die Reflexion zur begrifflichen Verwendung werden beleuchtet. Aktuelle inklusive Tendenzen auf internationaler und nationaler Ebene werden vorgestellt, sowie die gesetzlichen Regelungen und Entwicklungen in der Heilpädagogik im Kontext der Inklusion. Die Voraussetzungen und Bedingungen für eine gelingende Inklusion werden diskutiert.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Inklusionsprozess im Lebensbereich Freizeit. Es werden die Bedeutung heilpädagogischer Leitprinzipien wie Selbstbestimmung, Partizipation und Teilhabe sowie Empowerment für die inklusive Gestaltung des Lebensbereichs Freizeit erläutert. Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Handlungsebenen werden vorgestellt, sowie heilpädagogische Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer prozessorientierten Gestaltung des Inklusionsprozesses im Freizeitbereich. Die Chancen und Grenzen erfolgreicher Inklusion werden reflektiert. Das Assistenzmodell als Handlungskonzept der Heilpädagogik wird vorgestellt und seine Umsetzung im Lebensbereich Freizeit anhand des Beispiels des Vereins IDEAL e. V. erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Lebensbereich Freizeit, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Barrieren und Möglichkeiten, Inklusion, Selbstbestimmung, Partizipation, Empowerment, Assistenzmodell, Heilpädagogik und empirische Forschung. Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Situation der Freizeitgestaltung für Menschen mit Lernschwierigkeiten, analysiert die Herausforderungen und Chancen der Inklusion im Freizeitbereich und entwickelt Handlungsempfehlungen für eine inklusive Gestaltung des Lebensbereichs Freizeit.
- Quote paper
- Magdalena Beyrich (Author), 2010, Der Lebensbereich Freizeit bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182412