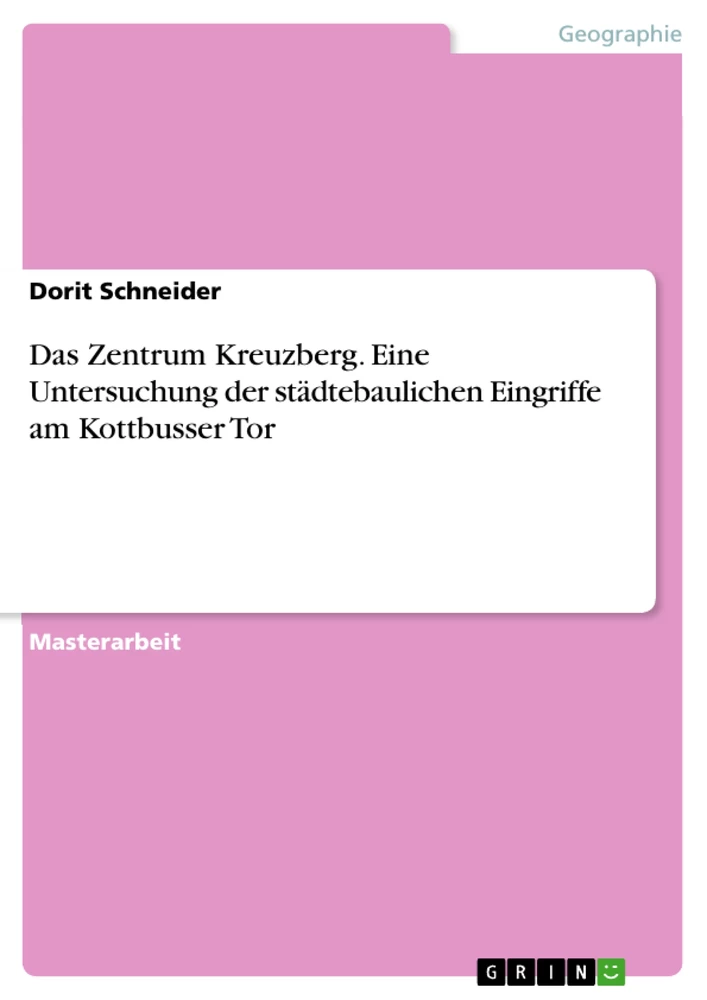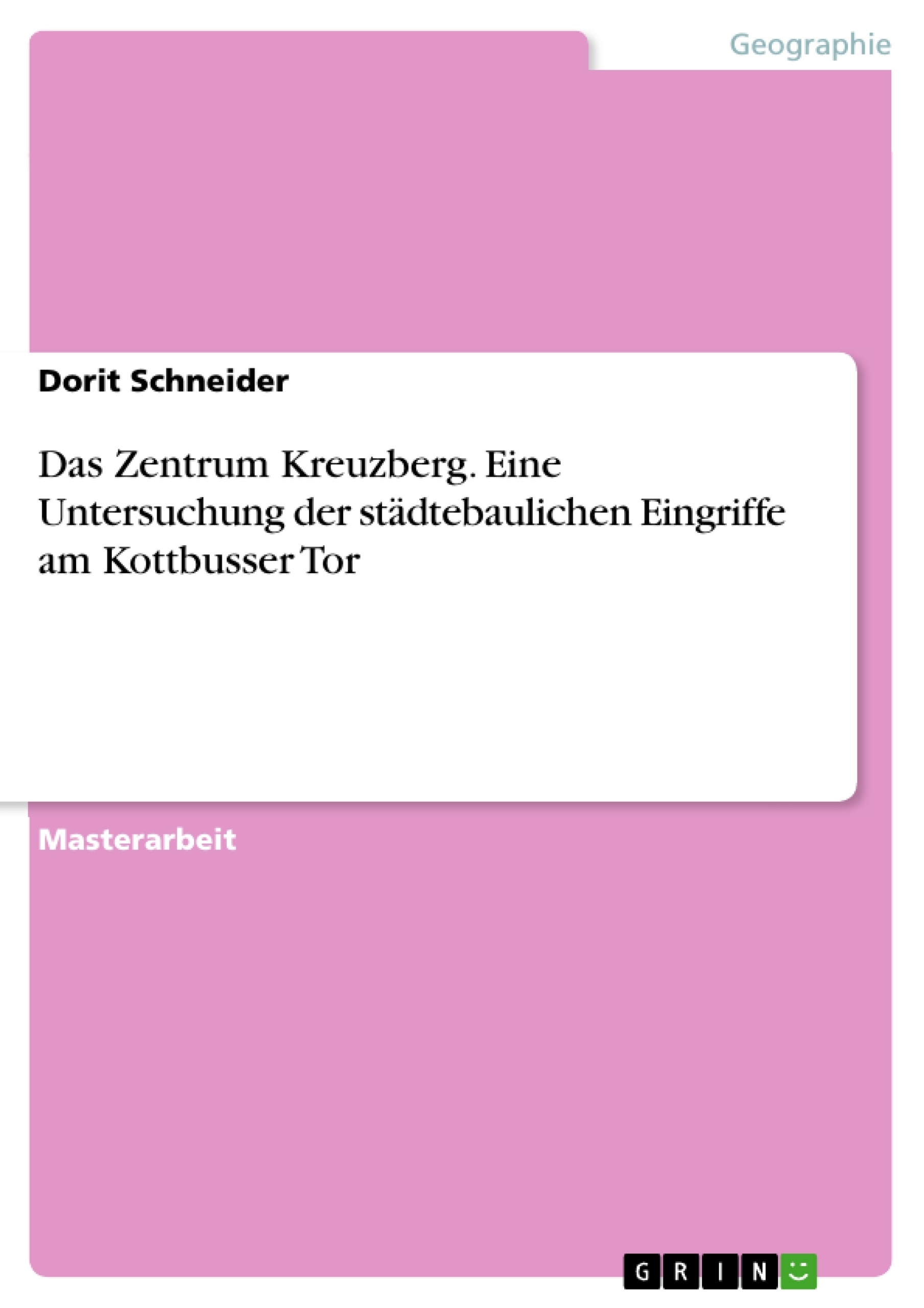"Die Formen einer Stadt verändern sich im Wandel der Zeit". Charles Baudelaire kommentiert in diesem Zitat die Entwicklung der Stadt Paris im 19. Jahrhundert, deren Formveränderungen für den bekannten Flaneur kaum noch nachvollziehbar waren, da sie sich im "Rhythmus des Herzschlags eines Sterblichen" neu gestalteten. Baudelaire könnte mit der sich unablässig verändernden Form der Stadt zweierlei gemeint haben: Erstens, die materielle Form, sprich die gebaute Substanz. Er könnte auf die äußeren Strukturen der Stadt angespielt haben, die fortwährend neu entstehen oder sich auflösen. Raumbeziehungen werden dabei immer wieder aufs Neue definiert und auf unterschiedliche Art und Weise bewertet, da sich deren materielle Form verändert. Zweitens könnte damit jedoch auch den Inhalt dieser äußeren Hülle gemeint haben, die "immaterielle Form". Damit ist der Raum gemeint, der sich aus den gelebten Strukturen zusammensetzt, aus sozialen sowie gesellschaftlichen Beziehungen und Entwicklungen. Auch dieser Raum gestaltet sich in seinen Strukturen kontinuierlich neu und wird in seiner Form verschiedenartig wahrgenommen.
Diese Arbeit widmet sich den Veränderungen und unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser "immateriellen Form" und untersucht sie anhand einer konkreten Architektur. Für die Analyse wurde ein Gebäude ausgewählt, das in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart immer wieder neu bewertet wurde und in vielfältiger Form von äußeren, zeitlichen Gegebenheiten beeinflusst wurde und wird. Das Beispielgebäude "Zentrum Kreuzberg", das zwischen 1972 und 1974 entstand, befindet sich im heutigen Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg am Verkehrsknotenpunkt Kottbusser Tor und fällt dem Betrachter besonders ins Auge: Wie ein Fremdkörper überspannt der Riegel aus Beton und Fertigteilen die Adalbertstraße, blockiert damit die Sichtachse vom Kottbusser Tor aus und degradiert ein komplettes Viertel zum Hinterhof, in dem abgesehen von den Bauten im großen Maßstab am Kottbusser Tor eher kleinteilige Mischstrukturen mit Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert vorzufinden sind. Verglichen mit der restlichen Bebauung erscheint das Zentrum Kreuzberg monströs und bizarr, seine Architektur grau und aggressiv.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Fragestellung und Hypothese
- I.2 Methode und Forschungsstand
- II. Historische Entwicklung des Stadtbezirks Kreuzberg
- II.1 Von der ländlich geprägten Luisenstadt zur steinernen Mietskasernenstadt
- II.2 Zerstörung, Wiederaufbau und Sanierung
- II.2.1 Massenwohnungsbau und Kahlschlagsanierung
- II.2.2 Die kulturelle Entwertung der Mietskaserne als Legitimation für die Stadt von Morgen
- II.2.3 Wiederaufbau in Kreuzberg
- II.2.4 Sanierungspolitik in (West-)Berlin
- II.2.5 Festlegung des Sanierungsgebiets Kreuzberg
- II.3 Fazit
- III. Das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor (SKKT)
- III.1 Planungseinheit PIII und Planung des Neuen Kreuzberger Zentrums (NKZ)
- III.1.1 Positive Wahrnehmung des Bauvorhabens
- III.1.3 Negativ-Image des NKZ vor seinem Bau
- III.2 Fazit
- III.1 Planungseinheit PIII und Planung des Neuen Kreuzberger Zentrums (NKZ)
- IV. Das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor nach dem Bau des NKZs
- IV.1 Veränderung der städtebaulichen Leitbilder
- IV.1.1 Widerstandsbewegungen gegen die autoritäre Planungspolitik
- IV.1.2 Proteste und Veränderung der Stadtplanungspolitik in West-Berlin
- IV.1.3 „Strategien für Kreuzberg“
- IV.1.4 Die IBA Berlin GmbH
- IV.2 Die negative Wahrnehmung und Bewertung des NKZ
- IV.3 Fazit
- IV.1 Veränderung der städtebaulichen Leitbilder
- V. Das positive Image des Neuen Kreuzberger Zentrums
- V.1 Das Zentrum Kreuzberg im Kontext der neueren Stadtentwicklung
- V.2 Das Programm Soziale Stadt und das Projekt Quartiersmanagement
- V.2.1 Das Modellgebiet Kottbusser Tor
- V.3 Kreuzberg und Gentrifizierung
- V.4 Tourismus in Kreuzberg
- V.5 Das positive Image des Neuen Kreuzberger Zentrums
- V.6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Wahrnehmung des „Zentrum Kreuzberg“, eines Gebäudes am Kottbusser Tor, im Laufe der Zeit. Ziel ist es, die unterschiedlichen Beurteilungen und die damit verbundenen Imageveränderungen zu analysieren und in einen historischen Kontext einzuordnen.
- Die historische Entwicklung des Stadtbezirks Kreuzberg und seine städtebauliche Transformation.
- Die Planung und die anfängliche positive Rezeption des „Zentrum Kreuzberg“.
- Die Entstehung und Festigung des negativen Images des Gebäudes in den 1980er und 1990er Jahren.
- Die jüngere Entwicklung und die zunehmende Wiederaufwertung des Gebäudes.
- Der Einfluss von Medienberichten und öffentlichen Diskursen auf die Wahrnehmung von Architektur und Stadtplanung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Fragestellung der Arbeit, die sich mit dem Wandel der Wahrnehmung des „Zentrum Kreuzberg“ befasst. Sie benennt die Methode und den Forschungsstand und führt in die Thematik der sich verändernden Wahrnehmungsformen von städtebaulichen Objekten ein, unter Bezugnahme auf Baudelaire und dessen Sicht auf die Transformation von Paris. Der Fokus liegt auf der „immateriellen Form“ des Raumes, die sich aus sozialen und gesellschaftlichen Beziehungen zusammensetzt. Das „Zentrum Kreuzberg“ wird als Fallbeispiel vorgestellt, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen gebauter Umwelt und sozialer Wahrnehmung zu untersuchen.
II. Historische Entwicklung des Stadtbezirks Kreuzberg: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung Kreuzbergs, von einer ländlich geprägten Struktur bis hin zur steinernen Mietskasernenstadt. Es analysiert die Auswirkungen von Zerstörung, Wiederaufbau und Sanierung, insbesondere den Massenwohnungsbau und die Kahlschlagsanierung. Die Kapitel thematisieren die kulturelle Entwertung der Mietskasernen und die daraus resultierende Legitimation für die „Stadt von Morgen“. Die Sanierungspolitik in West-Berlin und die Festlegung des Sanierungsgebiets Kreuzberg werden im Detail untersucht und liefern den Kontext für die spätere Entwicklung des „Zentrum Kreuzberg“.
III. Das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor (SKKT): Der Fokus liegt auf der Planungseinheit PIII und der Planung des Neuen Kreuzberger Zentrums (NKZ). Das Kapitel analysiert sowohl die anfänglich positive Wahrnehmung des Bauvorhabens als auch das sich entwickelnde Negativ-Image, bevor der Bau überhaupt abgeschlossen war. Es wird untersucht, wie die Erwartungen und die damalige Vorstellung von modernem Wohnungsbau das Bild des NKZ prägten und schon im Vorfeld zu kontroversen Diskussionen führten.
IV. Das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor nach dem Bau des NKZs: Dieses Kapitel befasst sich mit den Veränderungen der städtebaulichen Leitbilder nach dem Bau des NKZ. Es analysiert die Widerstandsbewegungen gegen die autoritäre Planungspolitik, die Proteste, und die resultierende Veränderung der Stadtplanungspolitik in West-Berlin. Die Rolle von Initiativen wie „Strategien für Kreuzberg“ und der IBA Berlin GmbH wird untersucht, sowie die anhaltende negative Wahrnehmung und Bewertung des NKZ.
V. Das positive Image des Neuen Kreuzberger Zentrums: Hier wird die Entwicklung eines positiven Images im Laufe der Zeit beleuchtet. Der Kontext der neueren Stadtentwicklung, das Programm „Soziale Stadt“ und das Projekt Quartiersmanagement, speziell das Modellgebiet Kottbusser Tor, werden analysiert. Die Themen Gentrifizierung und Tourismus in Kreuzberg werden in Bezug auf die veränderte Wahrnehmung des „Zentrum Kreuzberg“ untersucht. Schließlich wird der Prozess der Wiederaufwertung und das heutige, teilweise positive Image des Gebäudes erklärt.
Schlüsselwörter
Zentrum Kreuzberg, Kottbusser Tor, Stadtentwicklung, Architektur, Imagewandel, Wahrnehmung, Sanierung, Gentrifizierung, Medienrezeption, Stadtplanung, West-Berlin, Soziale Stadt, Quartiersmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wandel der Wahrnehmung des „Zentrum Kreuzberg“
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der Wahrnehmung des „Zentrum Kreuzberg“, eines Gebäudes am Kottbusser Tor, über die Zeit. Sie analysiert unterschiedliche Beurteilungen und die damit verbundenen Imageveränderungen und ordnet diese in einen historischen Kontext ein.
Welche Aspekte der historischen Entwicklung Kreuzbergs werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung Kreuzbergs von ländlicher Struktur zur Mietskasernenstadt, die Auswirkungen von Zerstörung, Wiederaufbau und Sanierung, den Massenwohnungsbau und die Kahlschlagsanierung, die kulturelle Entwertung der Mietskasernen und die Sanierungspolitik in West-Berlin, speziell die Festlegung des Sanierungsgebiets Kreuzberg.
Wie wird die Planung und anfängliche Rezeption des „Zentrum Kreuzberg“ dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Planungseinheit PIII und die Planung des Neuen Kreuzberger Zentrums (NKZ), die anfänglich positive Wahrnehmung des Bauvorhabens und das sich entwickelnde Negativ-Image vor Bauabschluss. Sie untersucht, wie Erwartungen und Vorstellungen modernen Wohnungsbaus das Bild des NKZ prägten und zu Kontroversen führten.
Welche Widerstände und Veränderungen der Stadtplanungspolitik werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Widerstandsbewegungen gegen autoritäre Planungspolitik, Proteste und die daraus resultierende Veränderung der Stadtplanungspolitik in West-Berlin. Sie untersucht die Rolle von Initiativen wie „Strategien für Kreuzberg“ und der IBA Berlin GmbH und die anhaltende negative Wahrnehmung des NKZ.
Wie wird die Entwicklung eines positiven Images des „Zentrum Kreuzberg“ erklärt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung eines positiven Images, den Kontext der neueren Stadtentwicklung, das Programm „Soziale Stadt“, das Projekt Quartiersmanagement (Modellgebiet Kottbusser Tor), Gentrifizierung, Tourismus in Kreuzberg und den Prozess der Wiederaufwertung des Gebäudes.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit benennt die Methode in der Einleitung. Der genaue methodische Ansatz wird im Hauptteil der Arbeit detailliert beschrieben (nicht in diesem Auszug).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zentrum Kreuzberg, Kottbusser Tor, Stadtentwicklung, Architektur, Imagewandel, Wahrnehmung, Sanierung, Gentrifizierung, Medienrezeption, Stadtplanung, West-Berlin, Soziale Stadt, Quartiersmanagement.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Historische Entwicklung des Stadtbezirks Kreuzberg, Das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor (SKKT), Das Sanierungsgebiet Kottbusser Tor nach dem Bau des NKZs, Das positive Image des Neuen Kreuzberger Zentrums. Jedes Kapitel hat mehrere Unterkapitel.
Wie wird die Wahrnehmung des „Zentrum Kreuzberg“ im Laufe der Zeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt einen Wandel von anfänglich positiver zu negativer und später wieder zu teilweise positiver Wahrnehmung. Dieser Wandel wird durch verschiedene soziale, politische und städtebauliche Faktoren erklärt.
Welche Rolle spielen Medien und öffentlicher Diskurs?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Medienberichten und öffentlichen Diskursen auf die Wahrnehmung von Architektur und Stadtplanung im Kontext des „Zentrum Kreuzberg“.
- Quote paper
- Dorit Schneider (Author), 2010, Das Zentrum Kreuzberg. Eine Untersuchung der städtebaulichen Eingriffe am Kottbusser Tor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182385