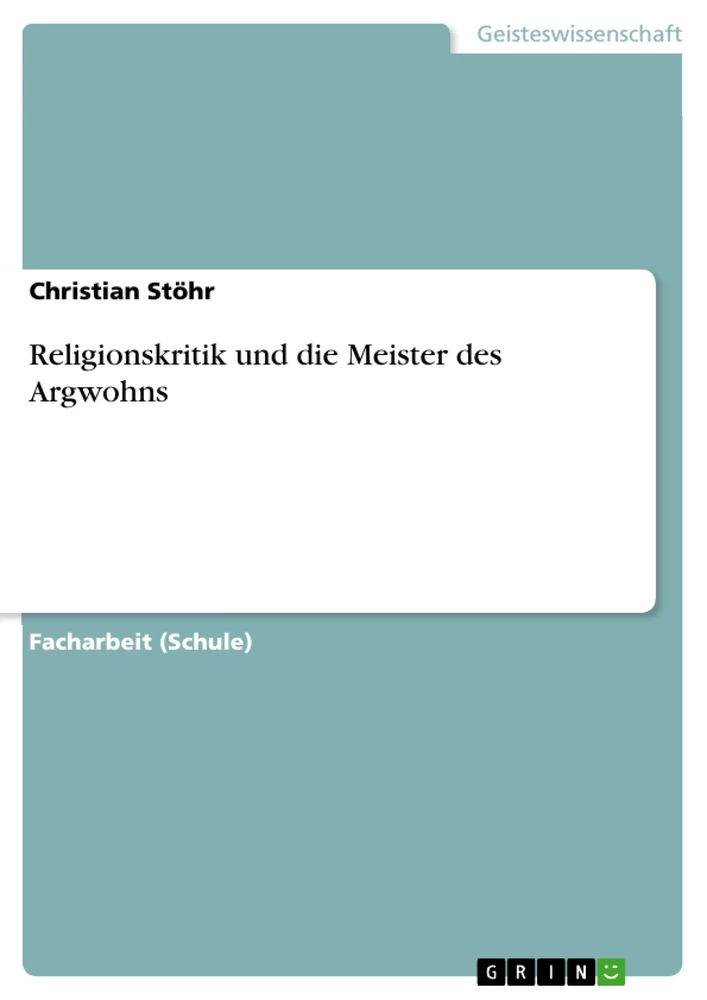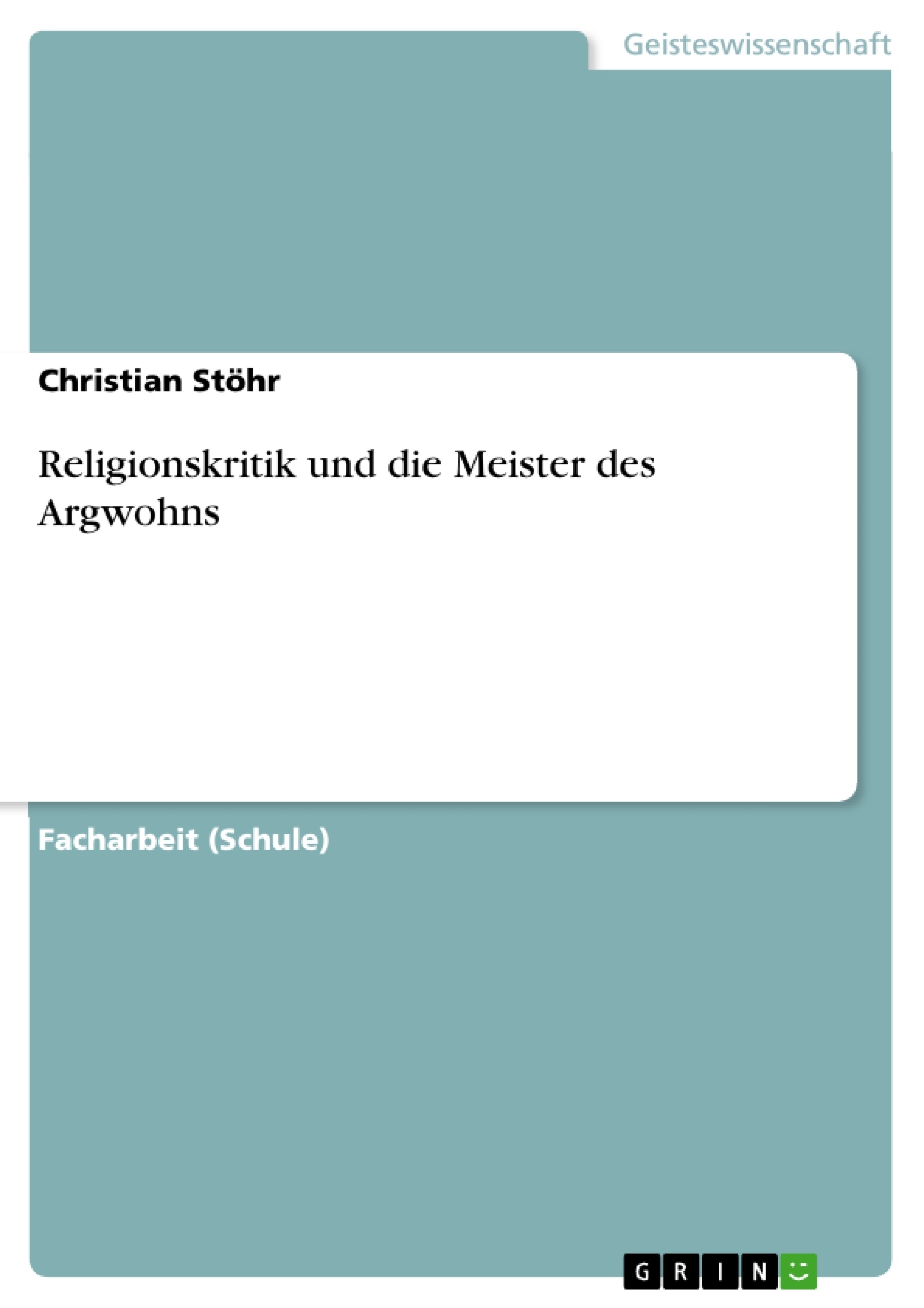Über viele Jahrhunderte hinweg erscheint die Religionskritik als sich immer weiterentwickelnde Beseitigung der Götter aus Natur, Welt und Gesellschaft. Dieser Prozess der Säkularisierung schließt Gott und Religion immer weiter aus unserem gesellschaftlichen Leben aus. Als Menschen in der Vergangenheit begannen ihre Vernunft im mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Religion zu nutzen, wurde diesen klar, dass Götter und Geister für die Welterklärung hinfällig sind. Die Griechen bezeichneten bereits vor ca. 400 Jahren v. Chr. die Angst der Menschen vor der Peinigung nach dem Tod in der Hölle bzw. die Furcht vor Naturkatastrophen als Ursprung des Götterglaubens. Dieser Verlauf sollte während der Aufklärung, eine Bewegung Ende des 17. Jahrhunderts, nach Kant „Licht in das Dunkel der Unwissenheit bringen“. Lange bevor Menschen sich mit Themen der Religionskritik auseinandersetzten, waren Ereignisse mit natürlicher und wissenschaftlich belegter Erklärung mit Kräften oder Mächten von Geistern und Göttern begründet. Später wird der Religion eine soziale Ordnungsfunktion zugeschrieben. Diese Ordnungsfunktion kulminiert mit dem Satz von Karl Marx (1818-1883), Religion sei „Opium des Volkes“ und in den Aufruf sich von dieser Ordnung zu befreien, da Marx die Religion aus Ausdruck des „gesellschaftlichen Elends“ sieht.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Religionskritik?
- die immanente Religionskritik
- die interreligiöse Religionskritik
- die externe Religionskritik
- Entwicklung der Religionskritik
- Die „Meister des Argwohns“
- Ludwig Feuerbach
- Feuerbachs Projektionstheorie
- Karl Marx
- Marx' Religionskritik
- Friedrich Nietzsche
- Nietzsches Religionskritik
- Sigmund Freud
- Freuds Religionskritik
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Begriff der Religionskritik und beleuchtet die Beiträge bedeutender Denker, die als „Meister des Argwohns“ bezeichnet werden. Die Arbeit analysiert verschiedene Arten der Religionskritik und deren Entwicklung.
- Definition und Kategorisierung von Religionskritik (immanent, interreligiös, extern)
- Entwicklung der Religionskritik im historischen Kontext
- Analyse der Religionskritik bei Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Arten der Religionskritik
- Die Rolle des Atheismus in der externen Religionskritik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert Religionskritik und differenziert zwischen allgemeiner und spezieller sowie immanenter, interreligiöser und externer Kritik. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen der Kritiker erläutert. Das zweite Kapitel behandelt die historische Entwicklung der Religionskritik. Das dritte Kapitel widmet sich den „Meistern des Argwohns“, indem es die religionskritischen Ansätze von Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud im Detail analysiert. Die Kapitel beschreiben die jeweiligen Methoden und Argumente dieser Denker ohne auf deren Schlussfolgerungen im Detail einzugehen.
Schlüsselwörter
Religionskritik, immanente Religionskritik, interreligiöse Religionskritik, externe Religionskritik, Atheismus, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Projektionstheorie, Religionsgeschichte, Weltanschauung.
- Quote paper
- Christian Stöhr (Author), 2011, Religionskritik und die Meister des Argwohns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182149