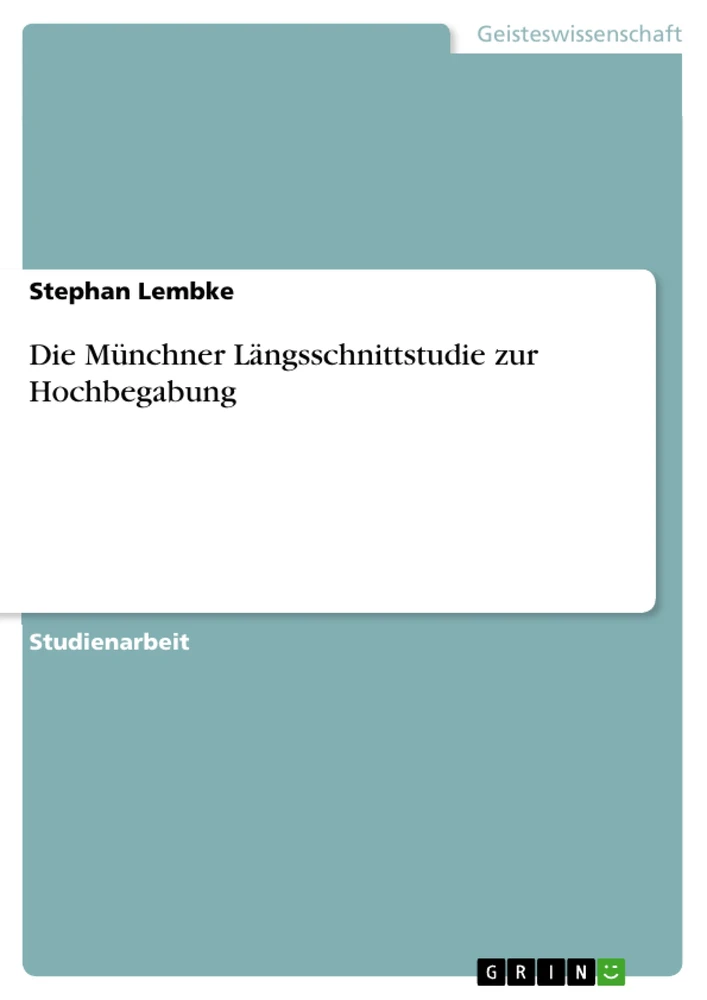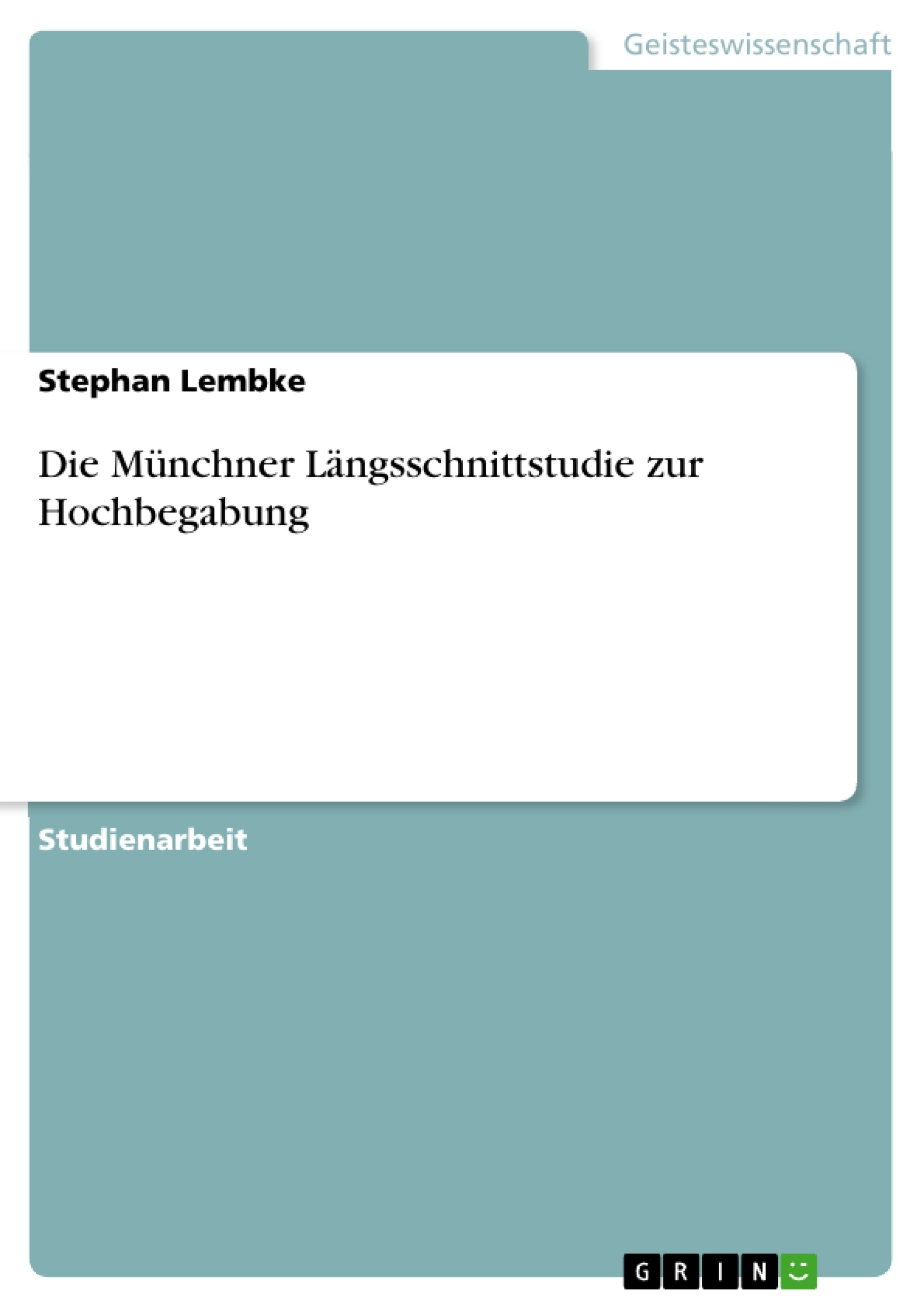Die Entwicklungspsychologie befasst sich mit der systematischen Erforschung von Veränderungs- und Umformungsprozessen in den Motiven und den Verhaltensweisen von Menschen. Sie will wissen, welche Verläufe kontinuierlich bzw. diskontinuierlich sind und unter welchen Bedingungen. Verhaltensveränderungen ereignen sich über die gesamte Lebensspanne. Die Entwicklungspsychologie will vor allem erforschen, welche Zusammenhänge zwischen Bedingungsfaktoren, genetischer oder sozialer Art und dem tatsächlichen Verhalten eines Menschen bestehen. Entwicklung ist immer zweiseitig bestimmt, von der Natur (Anlage) und der Umgebung. So suchen wir beispielsweise Freunde und Freizeitaktivitäten, die mit unseren eigenen Neigungen übereinstimmen und unabhängig vom Kalenderalter sind. Das Kalenderalter ist als soziale Richtschnur gerade für hochbegabte Kinder oft ein Entwicklungshindernis und gerade intellektuell hochbegabte Kinder sind auf Grund ihres Entwicklungsvorsprunges nicht nach chronologischem Alter einzuteilen. So dürfen intellektuell frühreife Kinder erst ab sechs Jahren zur Grundschule zugelassen werden. Warum aber sollten Schulgesetze, die sich am Durchschnitt orientieren, auch für Kinder gelten, die einen deutlichen Entwicklungsvorsprung haben? Diese und andere Umgebungsvariablen können die individuelle Entwicklung im positiven, aber auch im negativen Sinne beeinflussen. So ist im Grunde die Kreativität und Anstrengungsbereitschaft von Eltern und anderen Erziehern oft entscheidend dafür, ob sich beispielsweise ein musikalisch oder intellektuell hoch begabtes Kind so entwickelt, dass es entsprechende Leistungen (Leistungsexzellenz) zustande bringt. Eltern müssen gute Lehrer finden, geeignete Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stellen, und sie müssen vor allem das Kind so erziehen, dass es motiviert bleibt, sich anzustrengen und Leistungen zu erbringen. Entscheidend ist nämlich, dass das Kind von sich aus keine Anstrengungen scheut und auch Entbehrungen nicht aus dem Wege geht. Diese Zielerreichung muss dann oft gegen Widerstände oder entgegen ungünstigen Bedingungen durchgesetzt werden. Wenn das Motiv innerlich stark genug ist, sind Ziele auch erreichbar. Jede Begabung braucht fördernde und stimulierende Entwicklungshilfe! Diese allgemeine Feststellung stimmt natürlich immer und für alle Kinder.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten: Querschnittstudie, Längsschnittstudie, Reliabilität, Validität, Signifikanz, Underachiever
- Die Münchener Hochbegabtenstudie
- Definition: Hochbegabung
- Grundlagen, Zeitraum, Durchführung
- Ziele und Ergebnisse der ersten Testphase (1986/87)
- Ziele und Ergebnisse der zweiten Testphase (1987/88)
- Ziele
- Allgemeine Ergebnisse
- Ergebnisse bei Underachievern
- Geschlechtsspezifische Ergebnisse
- Thesen und Kritik
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Münchener Hochbegabtenstudie von Heller und Perleth und analysiert, wie sie die sozial-emotionalen Bedürfnisse hochbegabter Kinder im Vergleich zu durchschnittlich begabten Kindern beleuchtet.
- Definition und Charakteristika von Hochbegabung
- Entwicklungspsychologische Aspekte der Hochbegabung
- Methoden und Ergebnisse der Münchener Hochbegabtenstudie
- Herausforderungen und Förderung von Underachievern
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Hochbegabung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Entwicklungspsychologie und des Konzepts der Hochbegabung ein. Sie betont die Bedeutung von Umweltfaktoren und die Notwendigkeit, die Bedürfnisse hochbegabter Kinder zu berücksichtigen.
- Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel erläutert wichtige Forschungsbegriffe wie Querschnittstudie, Längsschnittstudie, Reliabilität, Validität, Signifikanz und Underachiever, die im Kontext der Hochbegabtenforschung relevant sind.
- Die Münchener Hochbegabtenstudie: Dieses Kapitel stellt die Münchener Hochbegabtenstudie vor, einschließlich ihrer Definition von Hochbegabung, ihrer Grundlagen, ihrer Durchführung und ihrer Ziele. Es gibt einen Überblick über die Ergebnisse der ersten und zweiten Testphase.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Hochbegabung, der Entwicklungspsychologie, der Münchener Hochbegabtenstudie, der Erkennung und Förderung von Underachievern, sowie den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Hochbegabung. Wichtige Forschungsmethoden und Konzepte, wie Querschnittstudie, Längsschnittstudie, Reliabilität und Validität, werden ebenfalls behandelt.
- Quote paper
- Stephan Lembke (Author), 2010, Die Münchner Längsschnittstudie zur Hochbegabung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182103