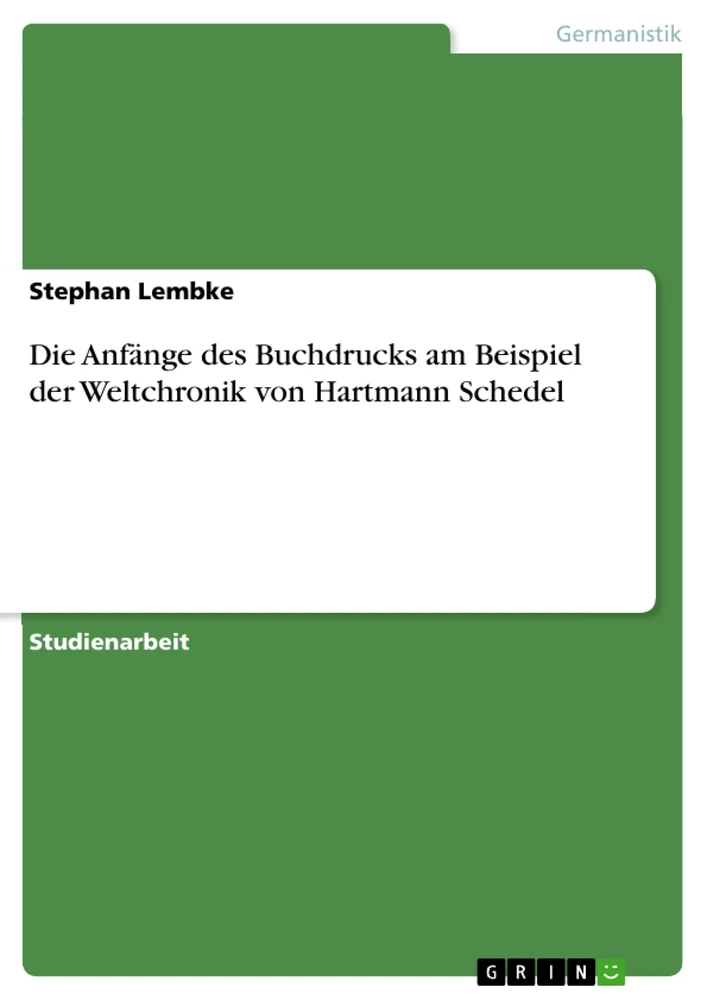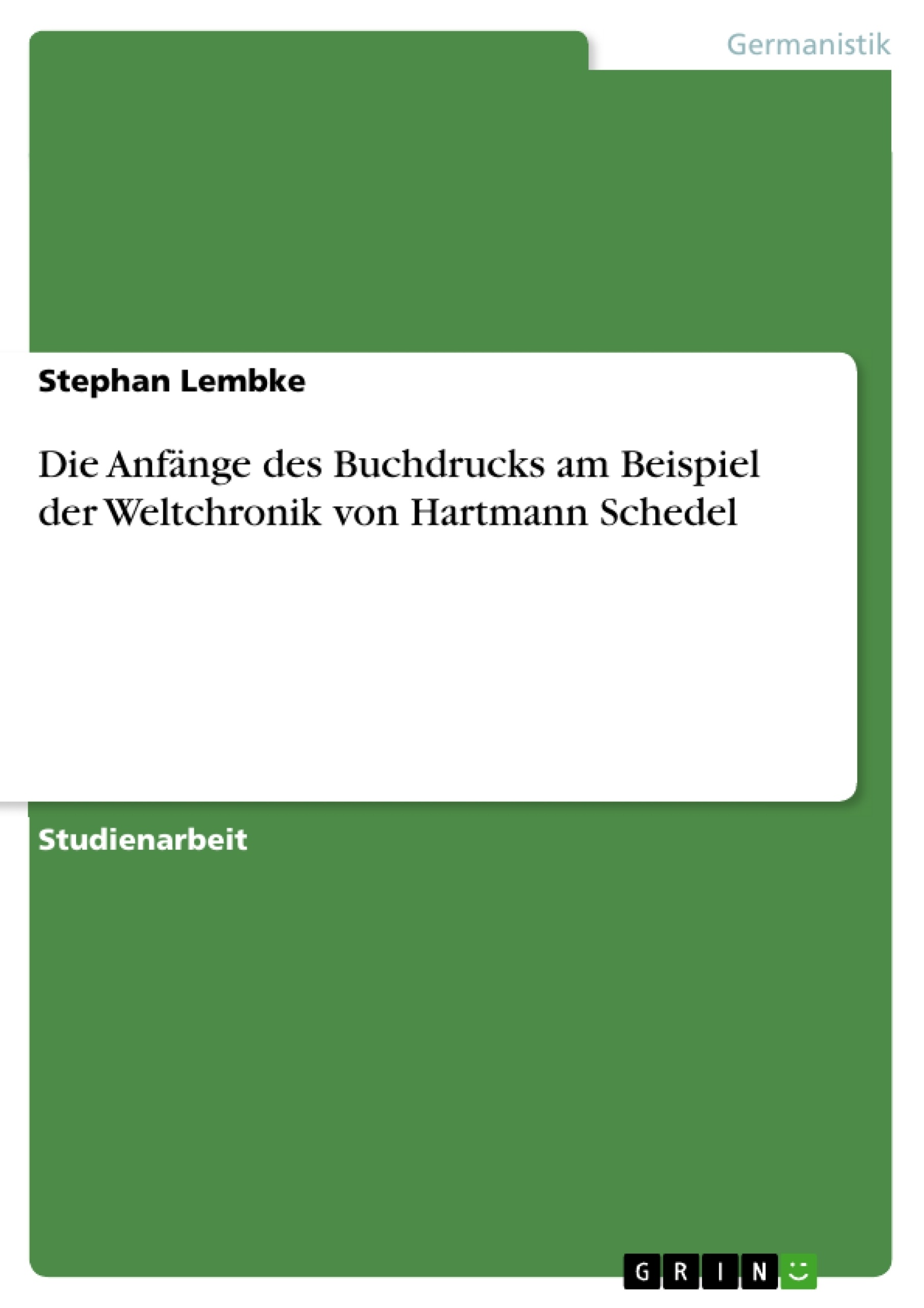Die aus dem Jahr 1493 stammende Schedelsche Weltchronik hat in der Forschung eine große Bedeutung und dadurch ein hohes Ansehen. Die Chronik gilt neben den Bibeldrucken als das bedeutendste Verlagserzeugnis dieser Zeit. Diese Sonderstellung liegt zum einen darin begründet, dass die Chronik das spätmittelalterliche Welt- und Geschichtsbild beinhaltet, aber auch daran, dass es sich wohl um die aufwändigste und kostenintensivste Verlagsproduktion der Inkunabelzeit handelt. Darüber hinaus gilt es als das bildreichste Werk des ausgehenden 15. Jahrhunderts.
Auf Grund der Detailfülle der Schedelsche Weltchronik wurde sie von zahlreichen Chronisten und Autoren nach ihrem Erscheinen als Quelle benutzt. Dies wird auf der einen Seite durch die explizite Nennung als Quelle, aber auch mit Hilfe durchgeführter Textvergleiche deutlich. Dabei scheinen vor allem die Städteansichten der Weltchronik eine besondere Bedeutung zu haben.
Allerdings lassen sich in der Literatur auch kritische Stimmen finden, die Schedels Werk neben allem Lob unter anderem ,,als eine imposante Ab-, Um- und Nachschreibe-Arbeit" bezeichnen. Nicht nur aus diesen weiter zu erörternden Vorwürfen sowie den Leistungen der
Weltchronik hat sich die Schedelsche Weltchronik als Forschungsfeld etabliert, sondern auch aufgrund der einmaligen Funde zu diesem Nürnberger Projekt. So sind z.B. die handschriftlichen Manuskript- und Bildvorlagen sowie fünf abgeschlossene Verträge aus den Jahren 1491 bis 1509 zu der Weltchronik erhalten geblieben. Darüber hinaus verfügt die Forschung auch über die Schedelsche Bibliothek, welche die Quellengrundlage zur Verfassung der Chronik darstellte und heute in weiten Teilen in der Bayrischen Staatsbibliothek in München aufbewahrt wird. In der vorliegenden Arbeit wird die Erfindung des Buchdrucks näher beschrieben und dabei besonders auf eines der bedeutendsten Werke seiner Zeit, der Schedelschen Weltchronik, eingegangen. Dabei werden das Werk sowie seine Bedeutung für die Folgezeit näher betrachtet. Somit dient die Arbeit eher als Übersichtswerk. Dennoch stellt sich bei der Betrachtung die Frage nach der Bedeutung der Weltchronik von Hartmann Schedel als wegweisendes Beispielwerk der Inkunabelzeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg von den Hieroglyphen zur Schrift von Heute
- Die Erfindung des Buchdrucks
- Johannes Gutenberg: Erfinder des Buchdrucks mit bewegten Lettern
- Erste gedruckte Werke
- Was sind Inkunabeln
- Die ,,Schedelsche Weltchronik"
- Der Auftraggeber Hartmann Schedel
- Der Drucker Anton Koberger
- Der Aufbau und die Daten der Weltchronik
- Die Weltchronik als Spiegel der zeitgenössischen Weltanschauung
- Die Bedeutung der Weltchronik bis in die heutige Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfindung des Buchdrucks und beleuchtet dabei insbesondere die "Schedelsche Weltchronik" als eines der bedeutendsten Werke dieser Zeit. Die Arbeit soll einen Überblick über die Entwicklung des Buchdrucks und die Bedeutung der "Schedelsche Weltchronik" für das Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit geben.
- Die Entwicklung der Schrift von den Hieroglyphen bis zum Buchdruck
- Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg
- Die "Schedelsche Weltchronik" als Beispiel für frühe Druckwerke
- Die Bedeutung der "Schedelsche Weltchronik" für die Verbreitung von Wissen und die gesellschaftliche Entwicklung
- Die "Schedelsche Weltchronik" als Spiegel der zeitgenössischen Weltanschauung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt die "Schedelsche Weltchronik" als wichtiges Werk der Inkunabelzeit vor. Das zweite Kapitel beleuchtet den langen Weg der Schriftentwicklung von den Hieroglyphen bis zum Buchdruck. Es beschreibt die Herausforderungen der Schriftübertragung und die Bedeutung des Buchdrucks als Meilenstein in der Geschichte der Kommunikation.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Erfindung des Buchdrucks und beleuchtet die Rolle Johannes Gutenbergs als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Es werden die ersten gedruckten Werke und der Begriff "Inkunabel" erklärt. Das vierte Kapitel analysiert die "Schedelsche Weltchronik" im Detail. Es beschreibt den Auftraggeber Hartmann Schedel, den Drucker Anton Koberger, den Aufbau und die Daten der Weltchronik. Es werden außerdem die Weltanschauung der Zeit und die Bedeutung des Werks bis in die heutige Zeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Buchdruck, Inkunabel, "Schedelsche Weltchronik", Hartmann Schedel, Anton Koberger, Schriftentwicklung, Hieroglyphen, Weltanschauung und Geschichte der Kommunikation. Die "Schedelsche Weltchronik" wird als Beispiel für ein wichtiges Werk der Inkunabelzeit und als Spiegel der spätmittelalterlichen Weltanschauung betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Buchdrucks für die Verbreitung von Wissen und die gesellschaftliche Entwicklung.
- Quote paper
- Stephan Lembke (Author), 2011, Die Anfänge des Buchdrucks am Beispiel der Weltchronik von Hartmann Schedel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182097