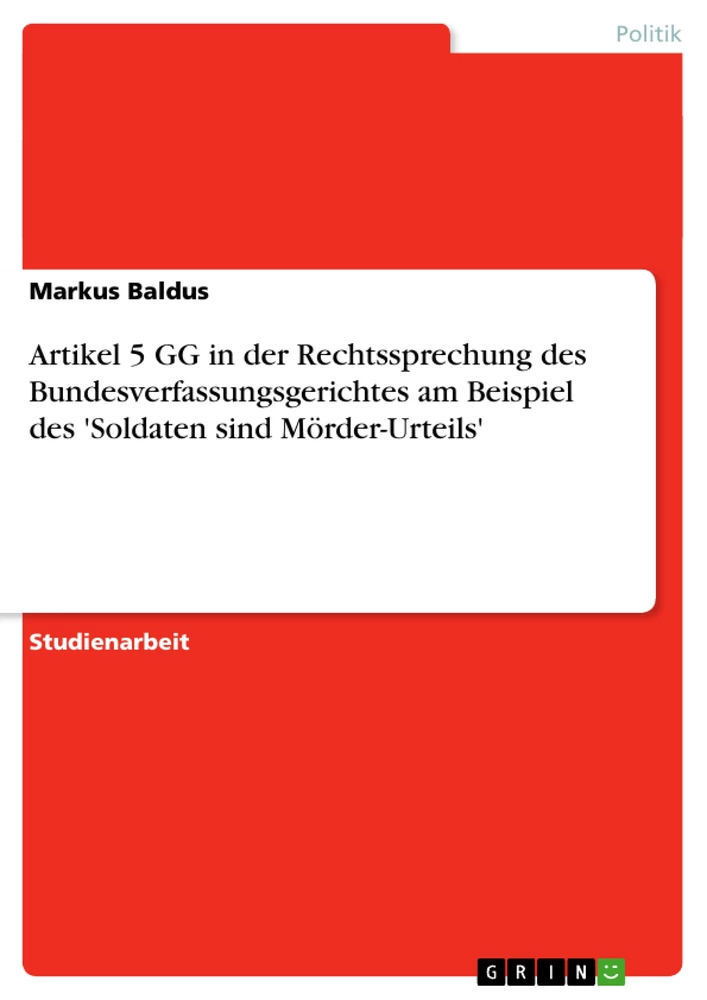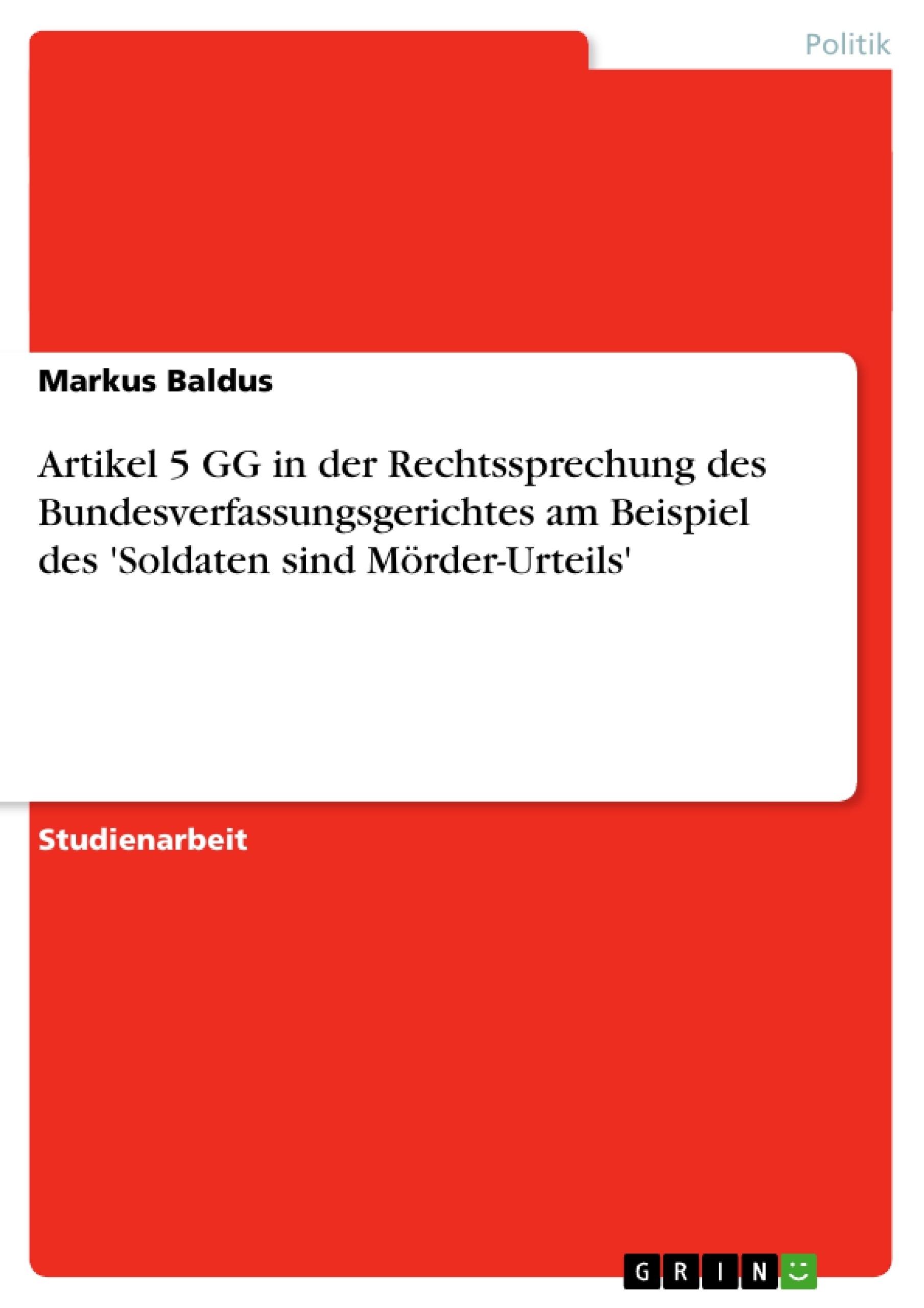Was für eine Zeit für das Bundesverfassungsgericht! Kaum jemals zuvor standen die Hüter der Verfassung so stark im Blickpunkt der Öffentlichkeit wie in den vergange-nen Monaten und Jahren. Seien es Auslandeinsätze der Bundeswehr oder die „Homo-Ehe“, es gab kaum eine gewichtiges Thema in der deutschen Politik, dass nicht in irgendeiner Form in den vergangenen Jahren Gegenstand von Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht war.
Dabei wurden die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes keineswegs immer zustimmend in der deutschen Öffentlichkeit aufgenommen. An Stammtischen aber auch unter Juristen und Wissenschaftlern waren viele Urteile des Bundesverfassungsgerichtes Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Paradebeispiele waren in der nicht allzu fernen Vergangenheit das Zuwanderungsgesetz oder einige Jahre zuvor das Sitzblockadenurteil.
Ein Thema aber beschäftigte die deutsche Gesellschaft über sechs Jahrzehnte und endete schließlich vor dem Bundesverfassungsgericht: Das berühmte Zitat von Kurt Tucholsky „Soldaten sind Mörder“. Nach diesem Urteil, das möchte ich an dieser Stelle bereits vorwegnehmen, endete die Diskussion über diesen Sachverhalt keineswegs, sondern heizte sich sogar zusätzlich an. Ansonsten ruhige Zeitgenossen warfen der Verfassungsjustiz ideologische Verblendung vor. Bezeichnend für die damalige Stimmung ist ein Kommentar des FDP-Verteidigungsexperten Jürgen Koppelin: „Wenn das Bundesverfassungsgericht es zulässt, dass Soldaten als Mörder bezeich-net werden können, dann muss es auch möglich sein, dass Soldaten Bundesrichter als Rufmörder bezeichnen können“ (Koppelin 1995, zit. n. Hepp / Otto 1996, S. 213).
Aber war diese Kritik wirklich gerechtfertigt oder war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eine logische Konsequenz der Interpretation des Artikel 5 GG und der bisherigen Rechtssprechung? Dieses Frage versuche ich in der hier vorliegenden Arbeit zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Der Artikel 5 GG
- Wortlaut
- Interpretation
- Beschränkungen
- Die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes
- Allgemeine Prinzipien
- Differenzierung zwischen Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung
- Der Begriff ,,allgemeine Gesetze“
- Der Jugendschutz
- Der Ehrenschutz
- Das ,,Soldaten sind Mörder-Urteil“
- Die Vorgeschichte
- Das Urteil
- Die Reaktionen
- Ist das ,,Soldaten sind Mörder-Urteil“ mit der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes vereinbar?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes im Kontext des Artikels 5 GG, insbesondere am Beispiel des sogenannten ,,Soldaten sind Mörder-Urteils“. Ziel ist es, die Vereinbarkeit dieses Urteils mit der bisherigen Interpretation des Artikels 5 GG zu analysieren.
- Die Interpretation des Artikels 5 GG
- Die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Artikel 5 GG
- Das ,,Soldaten sind Mörder-Urteil“ und seine Auswirkungen
- Die Bedeutung des Artikels 5 GG für die Meinungsfreiheit in Deutschland
- Die Grenzen der Meinungsfreiheit im Kontext von Beleidigung und Ehrenverletzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Darstellung des Wortlauts und der gängigen Interpretation des Artikels 5 GG. Anschließend wird die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Artikel 5 GG im Allgemeinen und im Hinblick auf die Differenzierung zwischen Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung, den Begriff ,,allgemeine Gesetze“, den Jugendschutz und den Ehrenschutz beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich ausführlich dem ,,Soldaten sind Mörder-Urteil“, indem es die Vorgeschichte, den Inhalt des Urteils und die Reaktionen auf dieses Urteil darstellt.
Schlüsselwörter
Artikel 5 GG, Meinungsfreiheit, Bundesverfassungsgericht, Rechtssprechung, ,,Soldaten sind Mörder-Urteil“, Tatsachenbehauptung, Jugendschutz, Ehrenschutz, Grenzen der Meinungsfreiheit, Beleidigung, Ehrenverletzung, Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Markus Baldus (Autor:in), 2003, Artikel 5 GG in der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes am Beispiel des 'Soldaten sind Mörder-Urteils', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18186