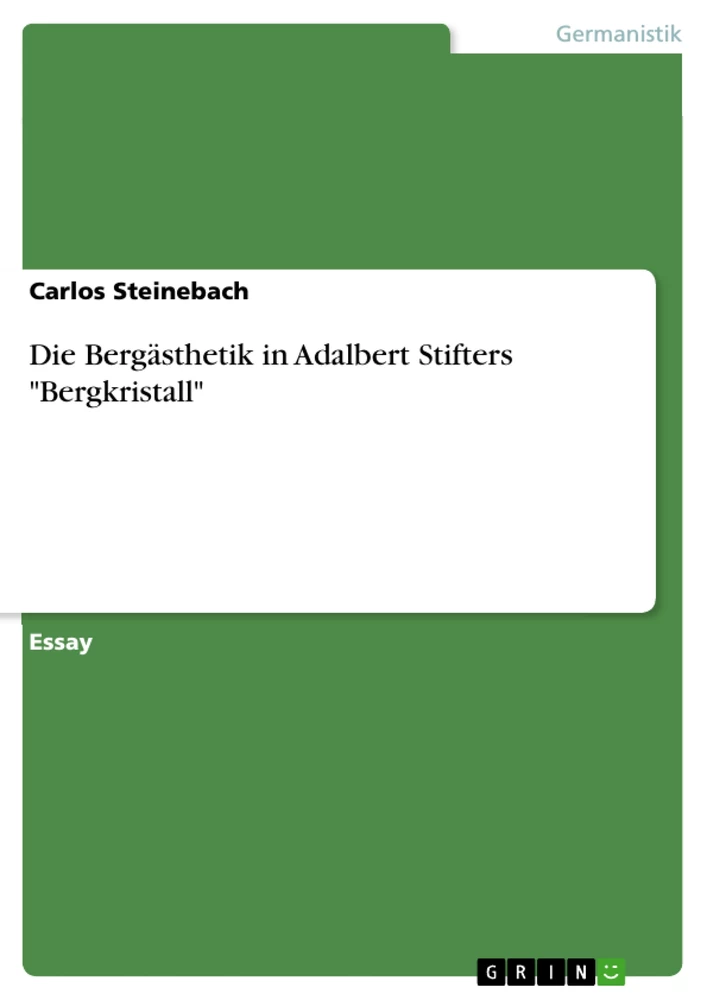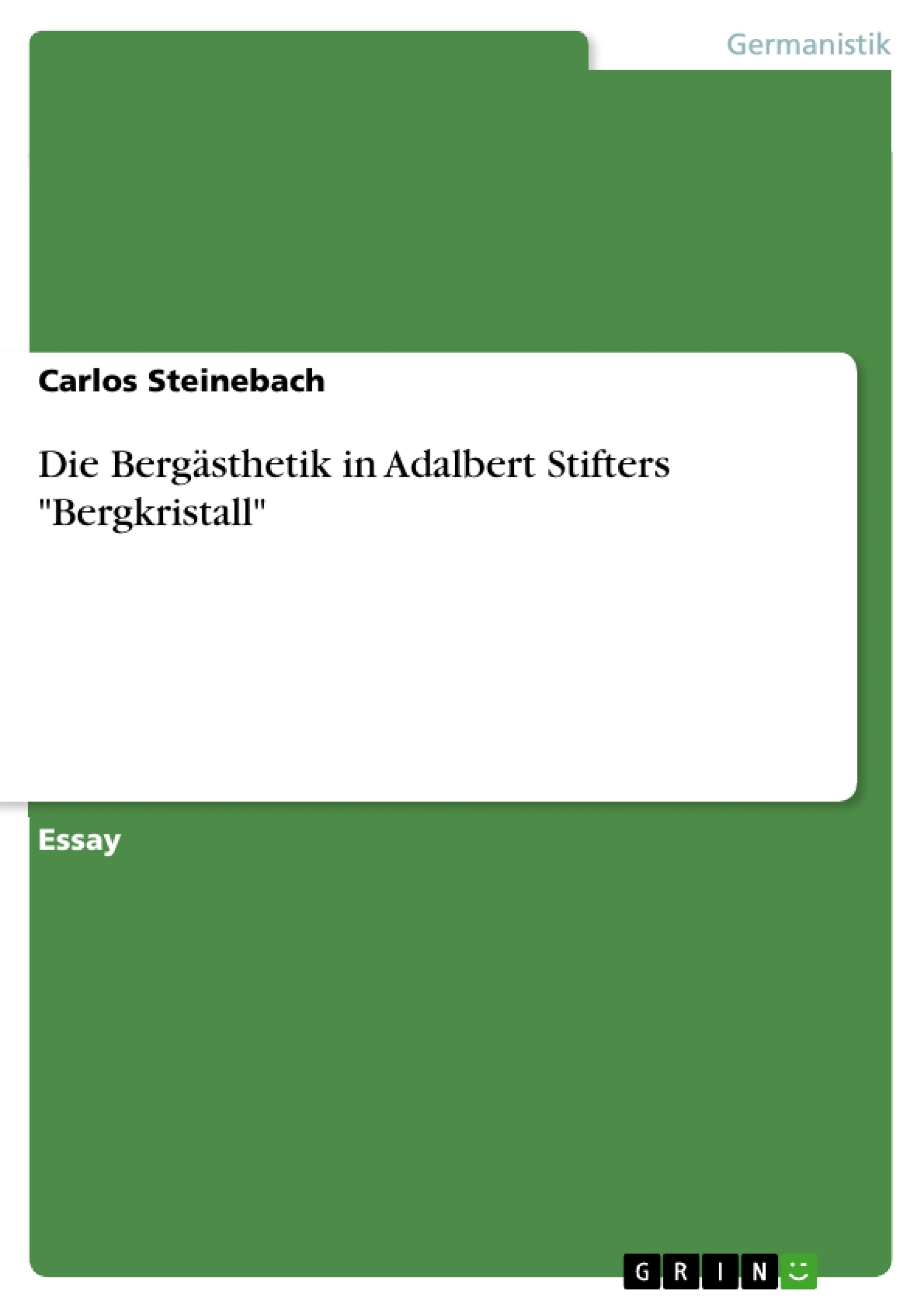Der Berg steht für eine ästhetische Begegnung, wirkt als Resonanzraum wechselnder Wahrnehmungen, als locus amoenus oder locus terribilis und als Stätte religiöser Erfahrungen. Die Aspekte der Bergbetrachtung sollen im Folgenden in Stifters Werk gefunden und analysiert werden, sodass am Ende die besondere Rolle des Berges in der Geschichte deutlich wird.
Inhaltsverzeichnis
- Die Erzählung „Bergkristall“ von Adalbert Stifter
- Der Berg als ästhetische Begegnung
- Der Berg als geographisches Element
- Der Berg als religiöses Element
- Der Berg als locus amoenus oder locus terribilis
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bergästhetik in Adalbert Stifters Erzählung „Bergkristall“. Ziel ist es, die besondere Rolle des Berges in der Geschichte aufzuzeigen und seine Bedeutung als ästhetisches, religiöses und soziales Element zu untersuchen.
- Der Berg als geographisches und soziales Element, das die Dörfer Gschaid und Millsdorf trennt und gleichzeitig eine Gemeinschaft in Gschaid fördert.
- Der Berg als Ort religiöser Erfahrung, der durch die Geschichte an Heiligabend und die Darstellung von Naturphänomenen wie dem Nordlicht eine sakrale Verbindung suggeriert.
- Die Ambivalenz des Berges als locus amoenus und locus terribilis, die sich in der Beschreibung der Schönheit und der Gefahren der Bergwelt widerspiegelt.
- Die Personifizierung des Berges und seine Rolle als „agens“ im Erzählgeschehen.
- Die Bedeutung des Berges für die Identität der Bewohner von Gschaid und die Integration der Protagonistin in die Dorfgemeinschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Erzählung „Bergkristall“ von Adalbert Stifter handelt von zwei Geschwistern, die am Heiligabend während der Rückkehr von ihren Großeltern in ihr Heimatdorf von einem Schneesturm überrascht werden, daraufhin die Orientierung verlieren und sich auf dem Berg Gars verlaufen. Der Berg spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte und wird als geographisches, religiöses und ästhetisches Element dargestellt.
Der Berg trennt die beiden Dörfer Gschaid und Millsdorf und bildet eine Barriere, die die Bewohner von Gschaid von der übrigen Zivilisation isoliert. Gleichzeitig fördert der Berg die Solidargemeinschaft im Dorf, da die Bewohner sich gegenseitig helfen, wenn jemand in Not ist. Der Berg wird auch als Ort religiöser Erfahrung dargestellt, da die Geschichte an Heiligabend spielt und die Kinder während ihres Abenteuers auf dem Berg ein seltsames Lichtspiel am Himmel beobachten, das als Nordlicht, Halluzination oder auch als Erscheinung des „heiligen Christ“ interpretiert werden kann.
Die Beschreibung des Berges als locus amoenus und locus terribilis wird durch die Darstellung der Schönheit und der Gefahren der Bergwelt deutlich. Die Kinder erleben den Berg als Ort der Gefahr, aber auch als Ort der Schönheit und der Ruhe. Die Personifizierung des Berges und seine Rolle als „agens“ im Erzählgeschehen werden durch die Beschreibung des Schneesturms und die Darstellung des Berges als lebendiger Organismus deutlich.
Der Berg spielt eine wichtige Rolle für die Identität der Bewohner von Gschaid und die Integration der Protagonistin in die Dorfgemeinschaft. Die Kinder werden durch ihr Abenteuer auf dem Berg zu „Eingeborenen“ von Gschaid und werden von der Dorfgemeinschaft als Teil der Gemeinschaft akzeptiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bergästhetik, die Erzählung „Bergkristall“ von Adalbert Stifter, die Rolle des Berges als geographisches, religiöses und soziales Element, die Darstellung des Berges als locus amoenus und locus terribilis, die Personifizierung des Berges und seine Rolle als „agens“ im Erzählgeschehen sowie die Bedeutung des Berges für die Identität der Bewohner von Gschaid.
- Arbeit zitieren
- Carlos Steinebach (Autor:in), 2011, Die Bergästhetik in Adalbert Stifters "Bergkristall", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181704