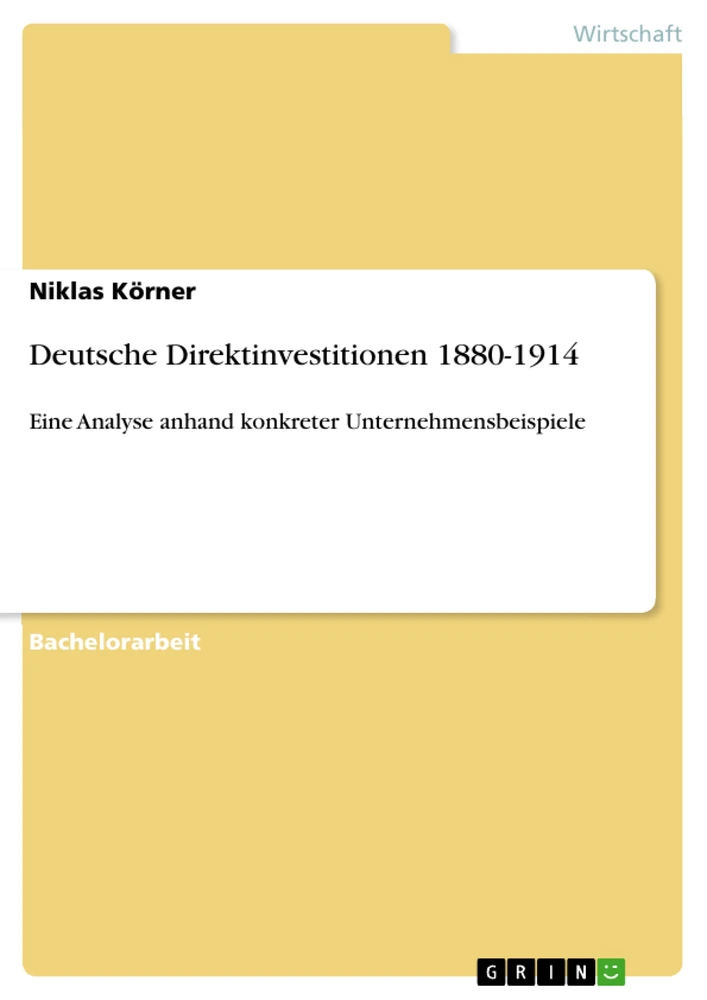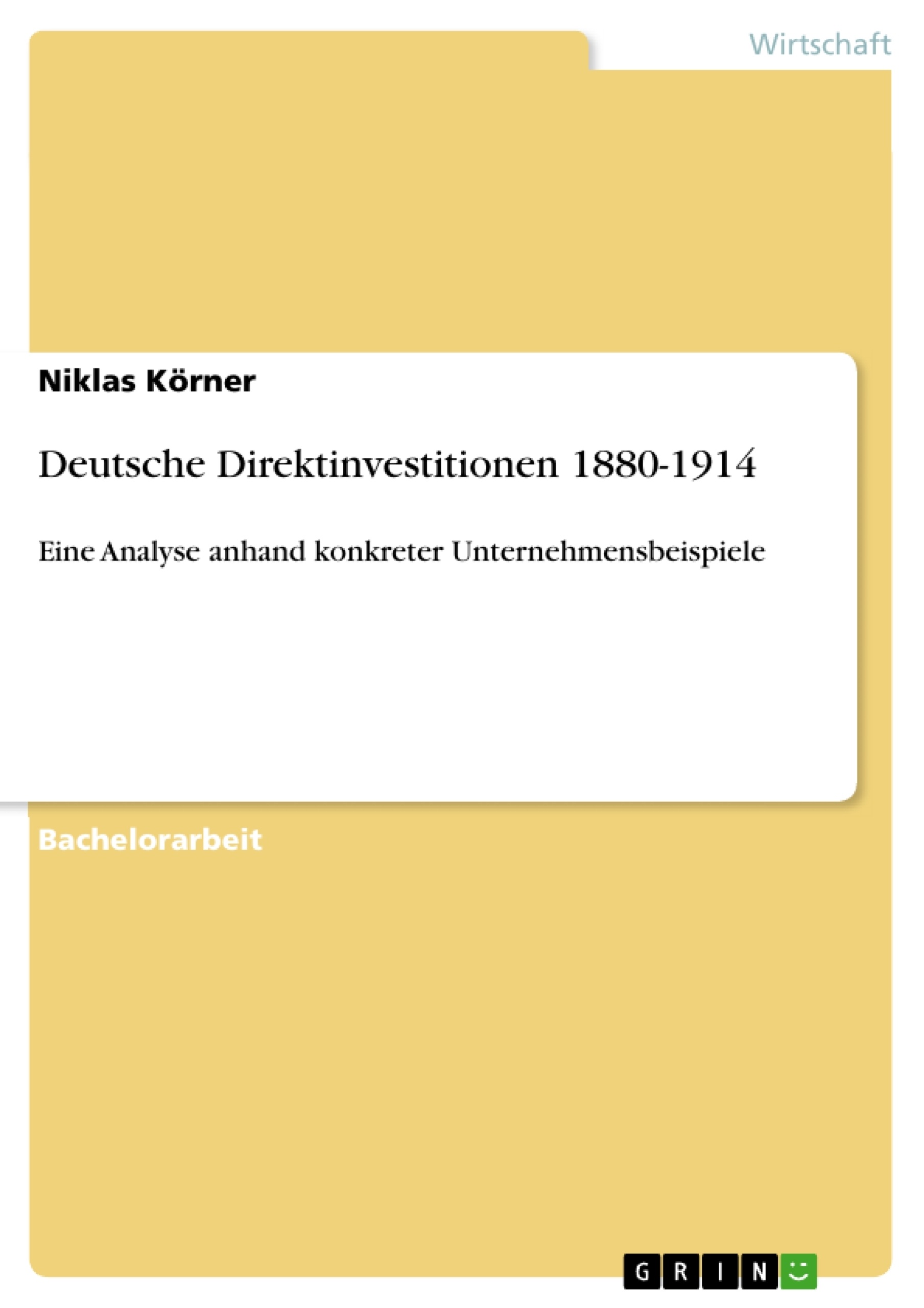Unternehmen tätigen heutzutage aus unterschiedlichen Gründen Direktinvestitionen, meist mit dem Ziel zu wachsen und einen höheren Gewinn zu erwirtschaften. Was heute zu den üblichen Methoden gehört, um im Ausland ein weiteres wirtschaftliches „Standbein“ aufzubauen, war zur Zeit des Kaiserreiches noch nicht entsprechend verbreitet.
Im 19. Jahrhundert begannen im Zuge der Industrialisierung und der ersten
Globalisierungswelle die ersten deutschen Unternehmen ins Ausland zu expandieren. Der reine Export von Gütern in Drittländer war diesen Unternehmen nicht genug, man wollte zunehmend auch vor Ort aktiv werden. Um dies zu ermöglichen, mussten die Unternehmen
Investitionen durchführen und Kapital ins Ausland transferieren. Dabei konnten sich die Firmen entweder für Portfolio-Investitionen oder Direktinvestitionen entscheiden. In dieser Abschlussarbeit wird die Aktivität deutscher multinationaler Unternehmen (MNU) im Bereich
der Direktinvestitionen analysiert. Es werden gezielt MNUs analysiert, da diese im betrachteten Zeitraum am ehesten Direktinvestitionen tätigten und die nötigen Kapazitäten bündeln konnten, um im Ausland aktiv zu werden. Der Zeitraum 1880 bis 1914 wird im folgenden betrachtet, da in diesem Zeitfenster erstmalig Direktinvestitionen großflächig
getätigt wurden. Die Industrialisierung in Deutschland war weit fortgeschritten, sodass die großen Konzerne Ausschau nach neuen Absatz- und Beschaffungsmärkten hielten. Die zentrale Fragestellung dieser Ausarbeitung ist die Suche nach den einzelnen Motiven für
ausgewählte Direktinvestitionen. Das Ziel dieser Arbeit ist zudem zu begründen, ob stets wirtschaftliche Interessen hinter den Direktinvestitionen standen oder ob auch andere Faktoren dazu führten. Dabei sollen besonders innen- und außenpolitische Einflüsse,
rechtliche Veränderungen und wirtschaftspolitische Maßnahmen in den Zielländern untersucht werden. Die im Zuge dieser Bachelorarbeit analysierten MNUs investierten weitreichend, um auf ausländischen Märkten aktiv zu werden. Dabei wurde gezielt mit Siemens ein
bedeutendes Unternehmen der elektrischen Industrie, die BASF als damals schon weltweit dominierender Chemiekonzern und die Deutsche Bank als Kreditgeber der Industrie im Ausland ausgewählt. Aufgrund der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Branchen unterscheiden sich die drei Unternehmen auch in der Art ihrer Motivation für die Durchführung von Direktinvestitionen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Multinationale Unternehmen
- 3 Direktinvestitionen
- 3.1 Foreign Direct Investment (FDI)
- 3.2 Historischer Hintergrund von FDI
- 3.3 John Dunnings Eklektisches Paradigma
- 3.3.1 Überblick über andere Theorieansätze
- 3.3.2 Theoretische Grundlage des Eklektischen Paradigmas
- 3.3.2.1 Ownership Advantages
- 3.3.2.2 Locational Advantages
- 3.3.2.3 Internalisation Advantages
- 3.3.3 Dynamische Ansätze des Eklektischen Paradigmas
- 3.3.4 Kritische Würdigung des Eklektischen Paradigmas
- 4 Siemens und die Expansion der elektrischen Industrie
- 4.1 Die Anfänge und der Aufstieg auf den Weltmärkten
- 4.2 Das Auslandsengagement von Siemens ab 1880
- 4.2.1 Russland
- 4.2.2 Großbritannien
- 4.2.3 Österreich
- 4.2.4 China
- 4.2.5 Vereinigte Staaten von Amerika
- 4.2.6 Frankreich, Italien und Spanien
- 5 Die Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF)
- 5.1 Die Expansion der BASF in die weite Welt
- 5.2 Auslandsdirektinvestitionen der BASF
- 5.2.1 Großbritannien
- 5.2.2 Russland
- 5.2.3 Frankreich
- 6 Die Deutsche Bank
- 6.1 Die Deutsche Bank und die Finanzierung des Außenhandels
- 6.2 Ausgewählte Auslandsengagements der Deutschen Bank
- 6.2.1 Großbritannien
- 6.2.2 China und Japan
- 6.2.3 Lateinamerika
- 6.2.4 Die Finanzierung des internationalen Eisenbahnbaus
- 6.2.5 Rumänien
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abschlussarbeit analysiert deutsche Direktinvestitionen im Zeitraum von 1880 bis 1914 anhand von Fallbeispielen der Unternehmen Siemens, BASF und der Deutschen Bank. Die zentrale Fragestellung untersucht die Motive hinter diesen Investitionen und hinterfragt, ob rein wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen oder auch politische und andere Faktoren eine Rolle spielten. Die Arbeit nutzt das eklektische Paradigma von John Dunning als analytisches Framework.
- Analyse der Motive für deutsche Direktinvestitionen im Zeitraum 1880-1914
- Untersuchung des Einflusses von innen- und außenpolitischen Faktoren auf Direktinvestitionen
- Anwendung des OLI-Paradigmas von Dunning auf die Fallbeispiele Siemens, BASF und Deutsche Bank
- Vergleich der Investitionsstrategien der drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen
- Bewertung der Rentabilität und des Erfolgs von Auslandsdirektinvestitionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Direktinvestitionen im Zeitraum 1880-1914 ein und definiert die zentrale Forschungsfrage nach den Motiven der Investitionen. Sie erläutert die Auswahl der Fallstudien (Siemens, BASF, Deutsche Bank) aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit und ihrer Bedeutung für die damalige Wirtschaft. Die Methode der Analyse, das eklektische Paradigma von Dunning, wird vorgestellt und die Forschungslücke in der bestehenden Literatur aufgezeigt.
2 Das Multinationale Unternehmen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des multinationalen Unternehmens (MNU) anhand verschiedener Definitionen aus der Literatur. Es beleuchtet die Entstehung und Entwicklung von MNUs im Kontext der ersten Globalisierungswelle und unterscheidet zwischen frühen Formen multinationaler Unternehmen und den im betrachteten Zeitraum relevanten Konzernstrukturen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Charakteristika und der historischen Entwicklung dieser Unternehmensform.
3 Direktinvestitionen: Das Kapitel erklärt das Konzept von Foreign Direct Investment (FDI) und seinen historischen Kontext. Es führt detailliert in das eklektische Paradigma von John Dunning ein, beschreibt dessen Komponenten (Ownership, Locational, Internalisation Advantages) und bewertet kritisch dessen Anwendbarkeit auf die Fallstudien. Die Kapitel legt den theoretischen Grundstein für die anschließende Fallstudienanalyse.
4 Siemens und die Expansion der elektrischen Industrie: Dieses Kapitel analysiert die Auslandsinvestitionen von Siemens im Zeitraum 1880-1914. Es beleuchtet die Anfänge und den Aufstieg des Unternehmens auf den Weltmärkten und beschreibt detailliert die Auslandsengagements in verschiedenen Ländern wie Russland, Großbritannien, Österreich, China, den USA und weiteren europäischen Ländern. Die Analyse konzentriert sich auf die Motive und die Erfolgsfaktoren dieser Investitionen im Kontext des OLI-Paradigmas.
5 Die Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF): Das Kapitel befasst sich mit der internationalen Expansion der BASF. Es beschreibt die globalen Auslandsdirektinvestitionen der BASF mit einem Fokus auf Großbritannien, Russland und Frankreich. Die Analyse konzentriert sich auf die spezifischen Strategien der BASF und die Faktoren, die ihren internationalen Erfolg beeinflussten, wobei der Bezug zum OLI-Paradigma hergestellt wird.
6 Die Deutsche Bank: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Deutschen Bank als Finanzier von Außenhandel und Direktinvestitionen. Es analysiert ausgewählte Auslandsengagements der Bank in verschiedenen Ländern, unter anderem in Großbritannien, China, Japan und Lateinamerika. Der Fokus liegt auf der Finanzierung internationaler Projekte, insbesondere im Eisenbahnsektor, und die Bedeutung der Bank für die internationale Expansion deutscher Unternehmen. Die Analyse integriert die Perspektive des OLI-Paradigmas.
Schlüsselwörter
Direktinvestitionen, Multinationale Unternehmen (MNU), 1880-1914, Siemens, BASF, Deutsche Bank, John Dunnings Eklektisches Paradigma (OLI-Paradigma), Ownership Advantages, Locational Advantages, Internalisation Advantages, Industrialisierung, Globalisierung, Außenhandel, Wirtschaftsgeschichte, Imperialismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Abschlussarbeit: Deutsche Direktinvestitionen 1880-1914
Was ist der Gegenstand dieser Abschlussarbeit?
Diese Arbeit analysiert deutsche Direktinvestitionen im Zeitraum von 1880 bis 1914. Sie untersucht die Motive hinter diesen Investitionen und hinterfragt, ob rein wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen oder auch politische und andere Faktoren eine Rolle spielten. Die Analyse fokussiert sich auf Fallbeispiele der Unternehmen Siemens, BASF und der Deutschen Bank.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Als analytisches Framework dient das eklektische Paradigma (OLI-Paradigma) von John Dunning. Dieses Paradigma berücksichtigt Eigentumsvorteile (Ownership Advantages), Standortvorteile (Locational Advantages) und Internalisierungsvorteile (Internalisation Advantages) um die Motive für Direktinvestitionen zu erklären.
Welche Unternehmen werden als Fallstudien untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auslandsinvestitionen von drei bedeutenden deutschen Unternehmen: Siemens (Elektrotechnik), BASF (Chemie) und der Deutschen Bank (Finanzdienstleistungen). Diese Auswahl ermöglicht einen Branchenvergleich und deckt verschiedene Aspekte deutscher Direktinvestitionen ab.
Welche Länder sind Gegenstand der Fallstudien?
Die Fallstudien analysieren Investitionen in diverse Länder, darunter Russland, Großbritannien, Österreich, China, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und Lateinamerika. Die Auswahl der Länder ist durch die jeweiligen Auslandsengagements der untersuchten Unternehmen bestimmt.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Motive für deutsche Direktinvestitionen im Zeitraum 1880-1914. Sie analysiert den Einfluss von innen- und außenpolitischen Faktoren und vergleicht die Investitionsstrategien der drei Unternehmen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewertung der Rentabilität und des Erfolgs der Auslandsdirektinvestitionen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Das Multinationale Unternehmen, Direktinvestitionen (inkl. detaillierter Erklärung des OLI-Paradigmas), Siemens und die Expansion der elektrischen Industrie, BASF und ihre internationale Expansion, Die Deutsche Bank und ihre Rolle im internationalen Finanzwesen, und schließlich ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Die einzelnen Kapitel behandeln folgende Themen: Kapitel 1 (Einleitung) stellt das Thema und die Forschungsfrage vor; Kapitel 2 (Multinationale Unternehmen) definiert den Begriff des MNU; Kapitel 3 (Direktinvestitionen) erklärt FDI und das OLI-Paradigma; die Kapitel 4-6 analysieren die Fallstudien Siemens, BASF und Deutsche Bank; Kapitel 7 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Direktinvestitionen, Multinationale Unternehmen, 1880-1914, Siemens, BASF, Deutsche Bank, John Dunnings Eklektisches Paradigma (OLI-Paradigma), Ownership Advantages, Locational Advantages, Internalisation Advantages, Industrialisierung, Globalisierung, Außenhandel, Wirtschaftsgeschichte und Imperialismus.
- Citar trabajo
- Niklas Körner (Autor), 2011, Deutsche Direktinvestitionen 1880-1914, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181639