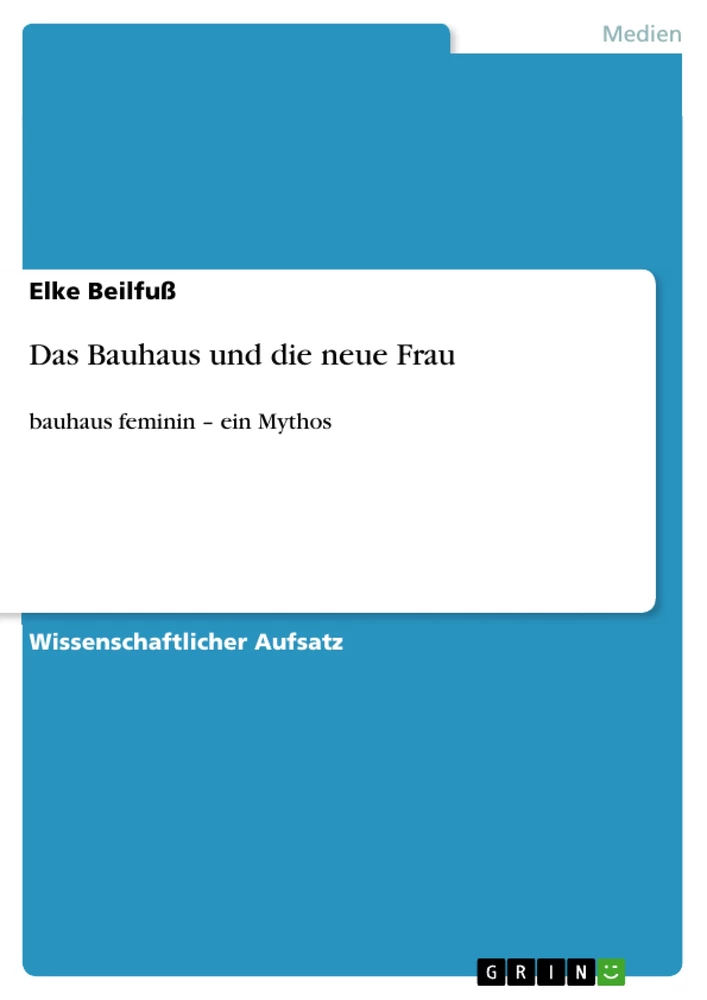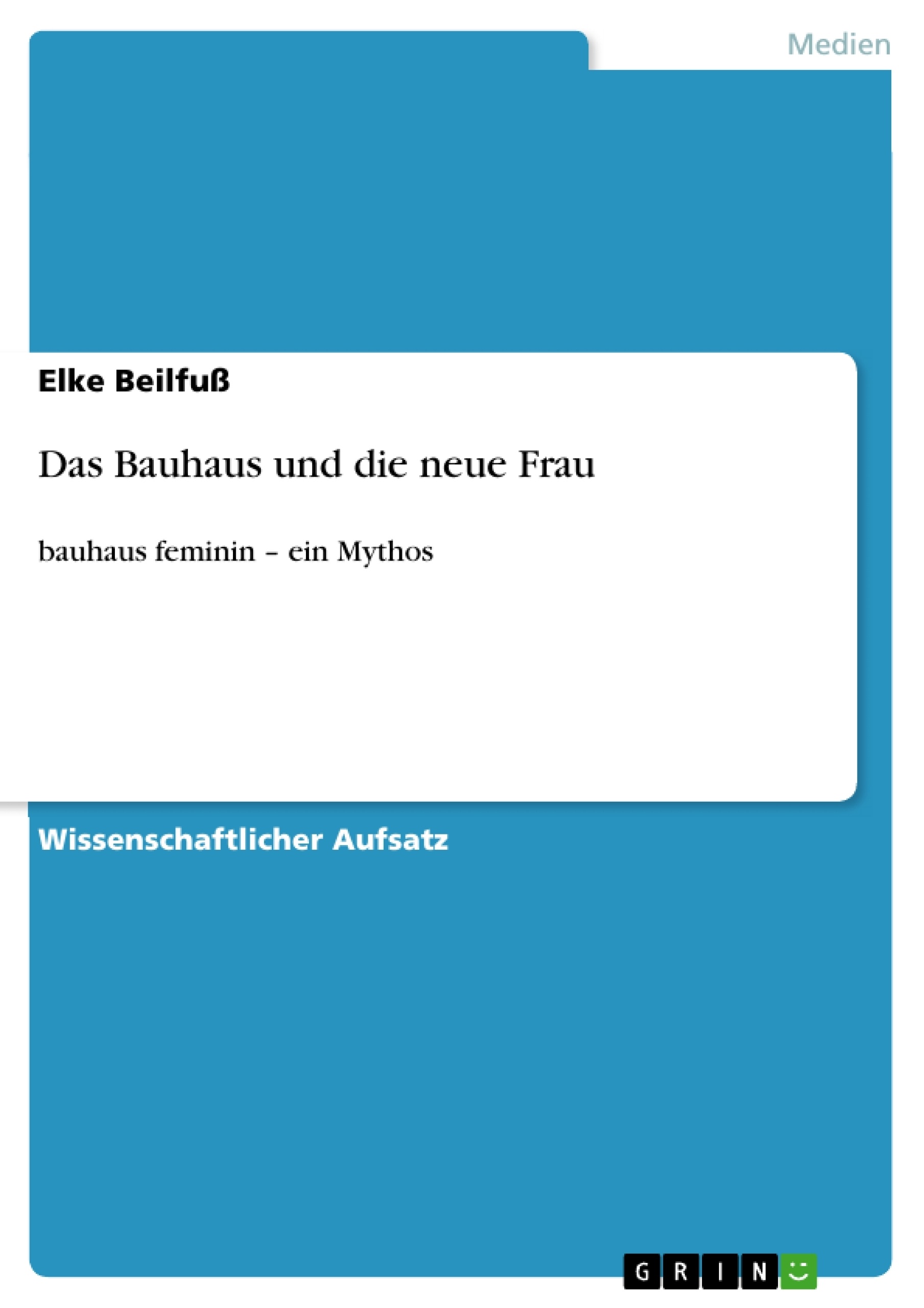»Die neue Frau ist da – sie existiert« schreibt 1918 die russische Schriftstellerin Alexandra Kollontai. Das Bild der Frauen in den Medien der 1920er Jahre bestimmen selbstbewusste, dynamische, experimentierfreudige Frauen: Die Autofahrerin, die Pilotin, die Sportlerin, die Lebenslustige und der Typ der androgynen Garçonne mit kurzem Haarschnitt und Hosen tragend. Sie alle prägen das Image der »Neuen Frau« und Zeitschriften wie »die neue linie« verbreiten es. Dies medial vermittelte Bild der Frau in den zwanziger Jahren stellt jedoch einen Mythos dar, der vor allem die Oberfläche und das Äußerliche meint.
Mädchen und junge Frauen träumten und hofften zwar auf das Erlernen und Ausüben eines eigenen Berufes, jedoch waren die Berufswünsche am Anfang des 20. Jahrhunderts oftmals verbunden mit tradierten weiblichen Tätigkeiten, wie weben, nähen, kochen und bügeln. Demgegenüber standen ganz neue Berufsbilder, auch gestalterische, wie die Fotografie, die einige Frauen für sich entdeckten.
Frauen kamen anfangs zahlreich an das staatliche Bauhaus in Weimar, annähernd zu gleichen Teilen wie Männer. 101 Frau und 106 Männer waren es 1919, so ist es zumindest in der neuen Dauerausstellung der Stiftung Bauhaus Dessau (seit 2007) zu lesen. In der Ausstellung sind auf einer einführenden Zeitleiste die Studierendenzahlen vermerkt. Dazu hier folgende Tendenzen: Von Jahr zu Jahr wurden insgesamt weniger Studenten aufgenommen, davon reduzieren sich aber insbesondere die Zahlen der weiblichen Studierenden. In Berlin fingen dann nur noch 5 Frauen und 14 Männer an zu studieren. Die geringe Zahl von Studienanfängern ist sicherlich mit der schwierigen politischen Situation des Bauhauses zu begründen. Dennoch hat sich das Zahlenverhältnis der Studienanfänger Frauen und Männer sehr verändert. War es anfänglich noch gleichmäßig (Hälfte, Hälfte), so wurden später nur noch etwa ein Drittel bzw. dann ein Viertel Frauen ans Bauhaus aufgenommen. Wer mehr über die Zahlen der Studierenden am Bauhaus erfahren möchte, der sei auf die Dissertation von Folke Dietzsch verwiesen. In einer umfassenden Studie hatte er bereits in den 1980er Jahren damit begonnen, die Studierendenzahlen genauer zu untersuchen. So ist ermittelt, dass insgesamt etwa 1240 Studierende und 100 Lehrende am Bauhaus gewirkt haben.
Inhaltsverzeichnis
- bauhaus feminin - ein Mythos
- Mädchen und junge Frauen träumten und hofften zwar auf das Erlernen und Ausüben eines eigenen Berufes
- Vor einigen Jahren ist das Thema »Frauen am Bauhaus« aus Richtung der Frauenbewegung aufgegriffen worden.
- 2,Zurück zu den Anfängen des Bauhauses 1919
- Die Einrichtung einer speziellen Klasse für Frauen ging auf die Initiative von Gunta Stölzl und einiger ihrer Mitschülerinnen zurück
- Anfangs wurde die Werkstatt für Weberei von der Werkkunstlehrerin Helene Börner zwar geführt
- Aber es gab durchaus auch andere Ansichten.
- Nachdem Gunta Stölzl 1931 das Bauhaus verließ
- Marianne Brandt und Gunta Stölzl - zwei Lebenswege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Frauen am Bauhaus, insbesondere im Kontext des Mythos der „Neuen Frau“ der 1920er Jahre. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge von Bauhaus-Studentinnen und -Mitarbeiterinnen, unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenswege und künstlerischen Leistungen.
- Der Mythos der „Neuen Frau“ und seine Widerspiegelung am Bauhaus
- Die Herausforderungen für Frauen am Bauhaus (geringe Wertschätzung weiblicher Leistungen, Beschränkungen in den Werkstätten)
- Die Rolle der Weberei als „Frauenwerkstatt“ und die unterschiedlichen Perspektiven darauf
- Die individuellen Lebenswege und künstlerischen Leistungen von Marianne Brandt und Gunta Stölzl
- Die Internationalität des Bauhauses und der Anteil ausländischer Studierender
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil beschreibt den Mythos der „Neuen Frau“ in den 1920er Jahren und setzt ihn in Bezug zum Bauhaus. Er beleuchtet die unterschiedlichen Erwartungen und Realitäten für Frauen, die am Bauhaus studierten und arbeiteten. Der zweite Teil fokussiert auf die Anfänge des Bauhauses und die Diskussion um die Aufnahme von Frauen. Die Einrichtung einer Frauenklasse in der Weberei wird detailliert beschrieben, inklusive der unterschiedlichen Meinungen über die Eignung der Weberei für Frauen. Der dritte Teil beleuchtet die unterschiedlichen Ansichten von Bauhaus-Studentinnen zur Weberei und deren Karrierewege. Der vierte Teil schließlich stellt die Lebenswege und künstlerischen Leistungen von Marianne Brandt und Gunta Stölzl vor, wobei Brandts poetische Lyrik und ihre fotografische Arbeit im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Bauhaus, Neue Frau, Frauen am Bauhaus, Weberei, Gunta Stölzl, Marianne Brandt, Genderforschung, Moderne, Textilgestaltung, Metallwerkstatt, Mythos Bauhaus, Internationale Studierende.
- Quote paper
- M.A. Elke Beilfuß (Author), 2009, Das Bauhaus und die neue Frau , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181550