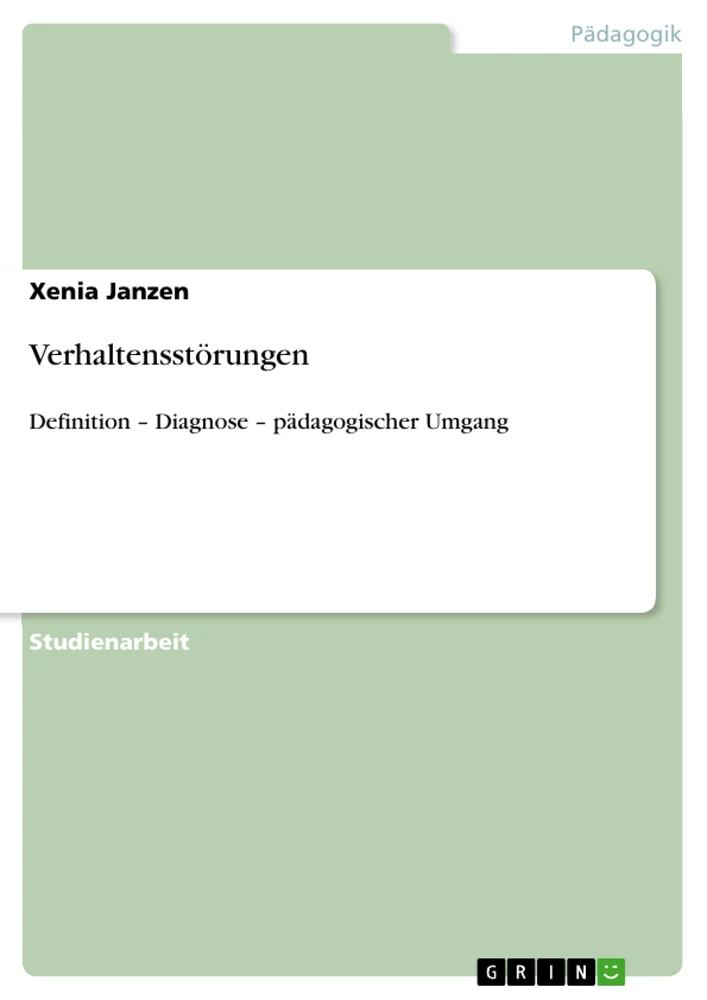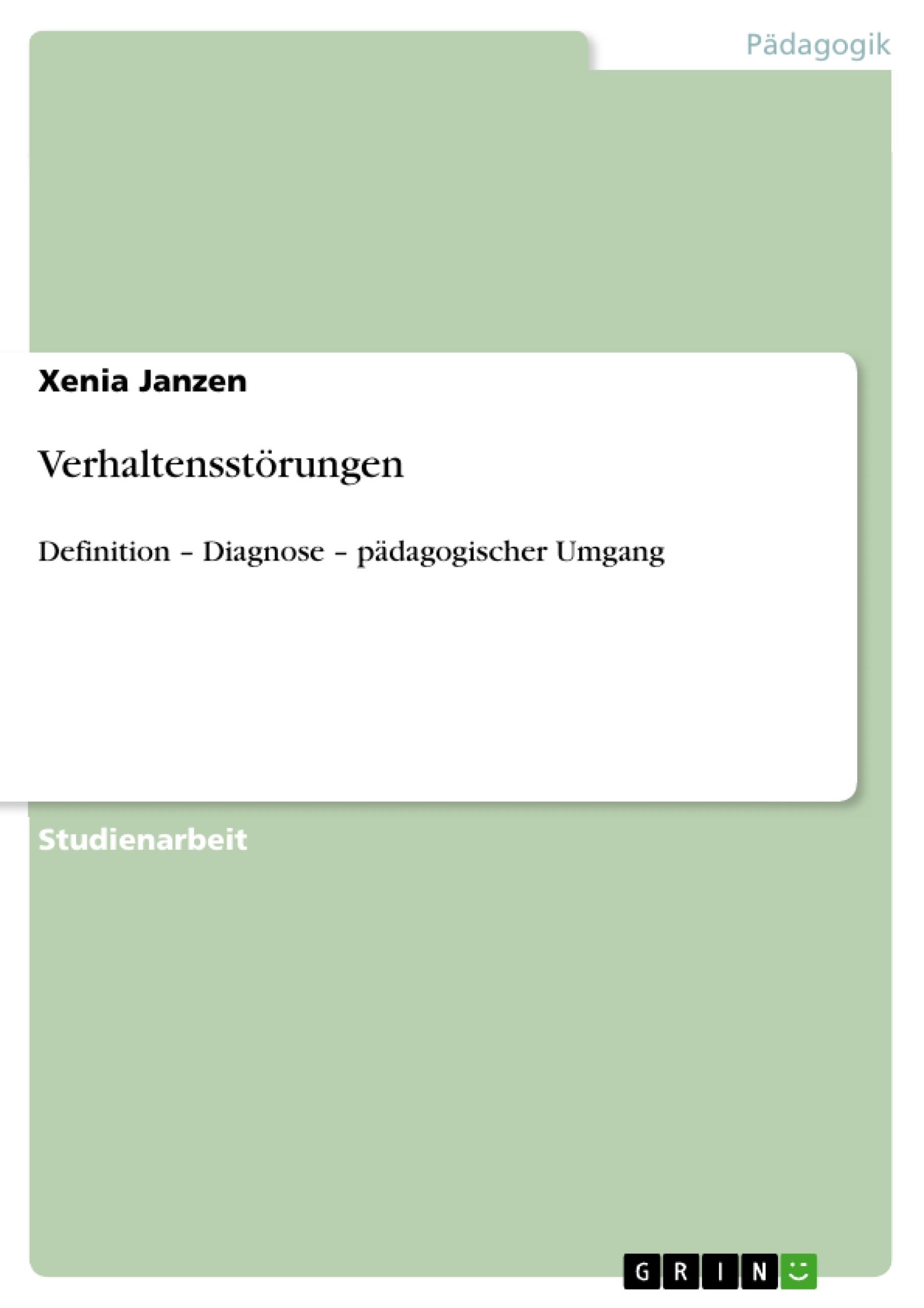In letzter Zeit scheint das Phänomen Verhaltensstörung im Kinder- und Jugendalter schlagartig an Dynamik zugenommen zu haben. Die in jüngster Zeit populären Erziehungs-Doku-Soaps, wie „Die Super Nanny“ oder „Teenager außer Kontrolle“, tragen dazu bei, diesen Eindruck zu verstärken. Und so schaut Deutschlands Gesellschaft – ratlos und erschüttert – den sich in den deutschen Haushalten, Kindergärten und Schulen abspielenden äußerst konflikthaften Szenen immer öfter aufs Neue zu. Dabei zeigen die Eltern, Erzieher und Lehrer oft Hilflosigkeit, Empörung, Enttäuschung und sind von dem Gefühl erfüllt, versagt zu haben, und trachten nach praktischen Ratgebern und Interventionsvorschlägen. Eine gesellschaftlich anerkannte Intervention stellt die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen in spezielle Sonderschulen, z. B. in „Schulen für Erziehungshilfe“, dar. Weniger als 1 % der Kinder und Jugendlichen eines schulpflichtigen Alters besuchen eine entsprechende Sonderschule (vgl. Langfeldt 2003: 191). Dagegen schätzen die Sonderpädagogen die Prävalenz von Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen deutlich höher ein. So schätzt Norbert Myschker nach einer Diskussion zahlreicher Studien den Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen auf 15 % (vgl. Myschker 2005: 79). Darüber hinaus besuchen die meisten hilfebedürftigen Kinder keine Sonder- bzw. Förderschule, sondern eine reguläre Grund- und Sekundarschule. Damit wird deutlich, dass ein Großteil dieser Schüler kaum eine professionelle pädagogische und therapeutische Behandlung und Hilfestellung bekommt. Angesichts dieser Problemlage ist es auch oder vor allem für die an den allgemeinbildenden Schulen tätigen Lehrkräfte sowie die Lehramtsanwärter überaus sinnvoll und an der Zeit, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund wird die vorliegende Arbeit als ein weiterer wichtiger Schritt bei der Vorbereitung auf das spätere professionelle Handeln betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Versuch der Definition des Begriffs Verhaltensstörung und die Definitionsschwierigkeiten
- 3. Erscheinungsformen und Klassifikation der Verhaltensstörungen
- 4. Pädagogische Diagnostik bei Verhaltensstörungen
- 4.1 Diagnostische Kriterien für die Verhaltensstörungen
- 4.2 Modelle der Diagnostik bei Verhaltensstörungen
- 5. Verhaltensstörungen im Kontext der allgemeinbildenden Schule
- 5.1 Prinzipien der Unterrichtung bei Verhaltensstörungen
- 5.2 Aspekte einer integrativen Didaktik bei Verhaltensstörungen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen von Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs, beschreibt verschiedene Erscheinungsformen und Klassifikationen, und analysiert pädagogische Diagnoseverfahren im Kontext der allgemeinbildenden Schule. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Hilfestrategien im schulischen Alltag.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Verhaltensstörung“
- Erscheinungsformen und Klassifizierung von Verhaltensstörungen
- Pädagogische Diagnostik und deren Modelle
- Prinzipien der Unterrichtung und integrative Didaktik bei Verhaltensstörungen
- Hilfestellungen und Interventionsmöglichkeiten im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen ein und hebt die steigende gesellschaftliche Aufmerksamkeit und die damit verbundene Suche nach effektiven Interventionsmöglichkeiten hervor. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Thema, besonders für Lehrkräfte, und betont die Schwierigkeit einer einheitlichen Definition von Verhaltensstörungen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die behandelten Fragen.
2. Versuch der Definition des Begriffs Verhaltensstörung und die Definitionsschwierigkeiten: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Definition von „Verhaltensstörung“. Es zeigt, wie stark die Definition von den jeweiligen sozialen, kulturellen und historischen Normen abhängt und wie verschiedene Begriffe im Laufe der Zeit verwendet wurden, z. B. „erziehungsschwierig“, „sozial fehlangepasst“, „verhaltensauffällig“. Das Kapitel verdeutlicht, dass eine wertfreie Definition angestrebt wird, die das Verhalten vom Individuum trennt, und diskutiert die gängigsten Oberbegriffe „Verhaltensauffälligkeit“ und „Verhaltensstörung“.
Schlüsselwörter
Verhaltensstörungen, Pädagogische Diagnostik, Definitionsschwierigkeiten, Klassifikation, Integrative Didaktik, Allgemeinbildende Schule, Hilfestellungen, Interventionen, Sonderpädagogik.
Häufig gestellte Fragen zu: Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie behandelt die Definitionsschwierigkeiten des Begriffs, verschiedene Erscheinungsformen und Klassifikationen, pädagogische Diagnostik, Prinzipien der Unterrichtung und integrative Didaktik im schulischen Kontext sowie Hilfestellungen und Interventionsmöglichkeiten. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Definitionsproblemen, Erscheinungsformen, Diagnostik, schulischer Praxis und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Definition von „Verhaltensstörung“ behandelt?
Die Arbeit hebt die starken Abhängigkeiten der Definition von sozialen, kulturellen und historischen Normen hervor. Sie zeigt, wie sich die Begrifflichkeiten im Laufe der Zeit verändert haben (z.B. „erziehungsschwierig“, „sozial fehlangepasst“, „verhaltensauffällig“) und strebt eine wertfreie Definition an, die das Verhalten vom Individuum trennt. Die gängigsten Oberbegriffe „Verhaltensauffälligkeit“ und „Verhaltensstörung“ werden diskutiert.
Welche Aspekte der pädagogischen Diagnostik werden beleuchtet?
Die Arbeit analysiert pädagogische Diagnoseverfahren im Kontext der allgemeinbildenden Schule. Es werden diagnostische Kriterien für Verhaltensstörungen und verschiedene Modelle der Diagnostik behandelt.
Wie wird die schulische Praxis im Umgang mit Verhaltensstörungen betrachtet?
Die Arbeit untersucht Prinzipien der Unterrichtung und Aspekte einer integrativen Didaktik bei Verhaltensstörungen in der allgemeinbildenden Schule. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Hilfestrategien im schulischen Alltag und der Beschreibung von Hilfestellungen und Interventionsmöglichkeiten im schulischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Verhaltensstörungen, Pädagogische Diagnostik, Definitionsschwierigkeiten, Klassifikation, Integrative Didaktik, Allgemeinbildende Schule, Hilfestellungen, Interventionen, Sonderpädagogik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen von Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition, beschreibt Erscheinungsformen und Klassifikationen und analysiert pädagogische Diagnoseverfahren in der Schule. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Hilfestrategien im schulischen Alltag.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für jedes Kapitel, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Bedeutung für Lehrkräfte betont. Kapitel 2 befasst sich detailliert mit den Schwierigkeiten bei der Definition von Verhaltensstörungen. Weitere Kapitelzusammenfassungen erläutern die jeweiligen Inhalte der weiteren Kapitel, wie Diagnostik, schulischer Umgang und Fazit.
- Quote paper
- Xenia Janzen (Author), 2010, Verhaltensstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181541