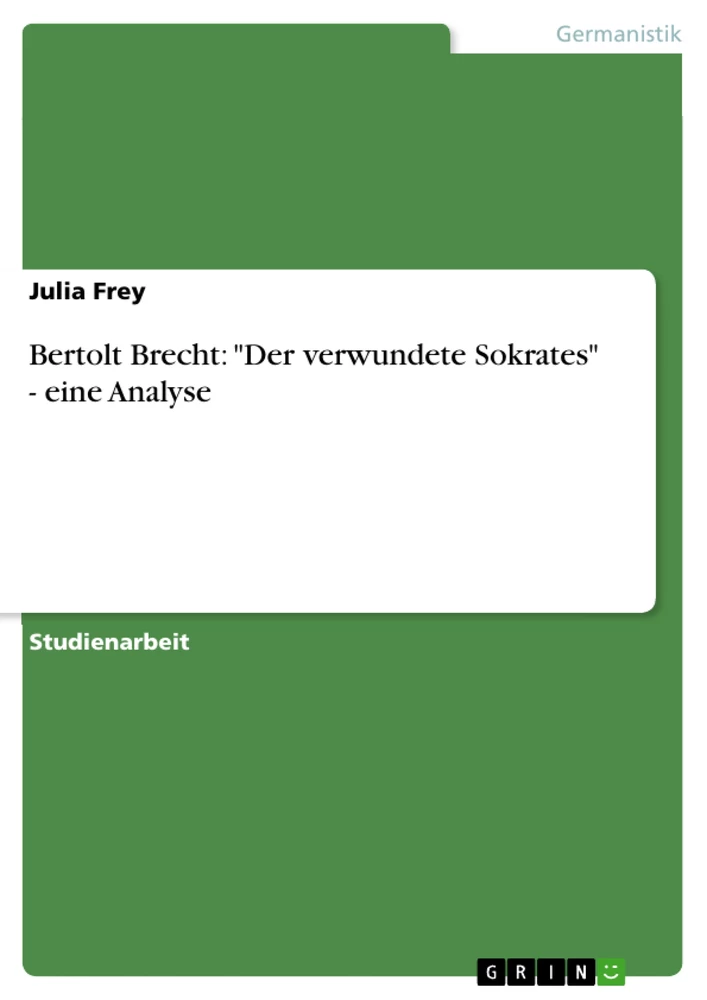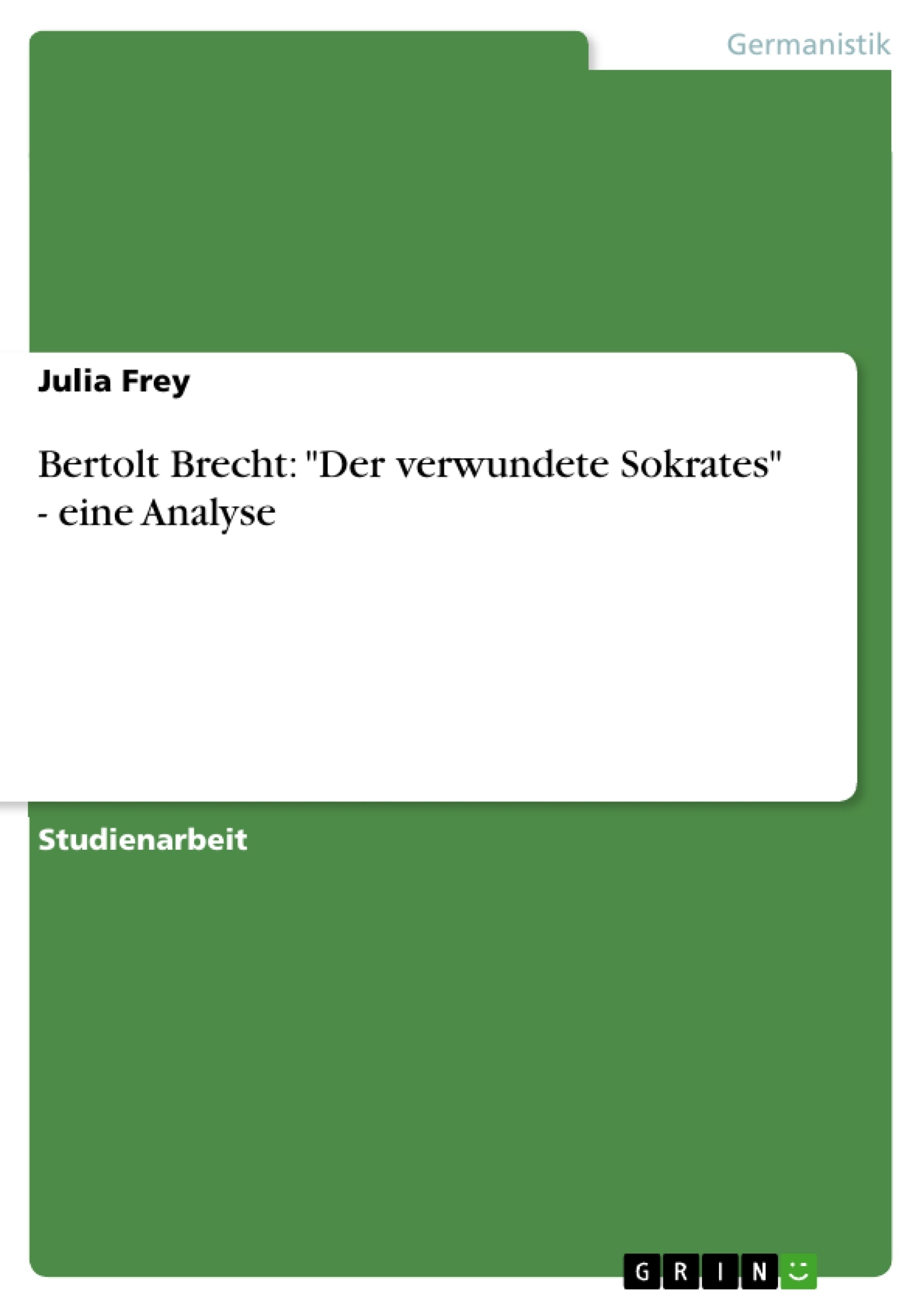„Der verwundete Sokrates“ entstand 1938 in Skovbostrand, Dänemark. Bertolt Brecht, Autor dieser Geschichte, war 1933 aus seinem Heimatland Deutschland geflohen. Aufgrund seiner antifaschistischen Haltung, die auch in seinen Werken zum Ausdruck kam, war er den Nazis ein Dorn im Auge. In den ersten Exiljahren widmete Brecht seine Prosa der Kritik des Faschismus. Sicherlich dachte er, damit eine Reaktion unter seinen Lesern zu erreichen, denn es gab noch gewisse Hoffnungen, dass sich die braune Herrschaft in Deutschland nicht etablieren würde. Brecht wollte wohl mit seinen Schriften auf die kriegerischen Absichten der Nazis aufmerksam machen und vor ihnen warnen. Jedoch erschien „Der verwundete Sokrates“ zusammen mit einigen anderen Erzählungen und Gedichten in Form der Kalendergeschichten erst vier Jahre nach Kriegsende und leistete seine, vor allem für die Kriegsgeneration gedachte, Aufklärungsarbeit viel zu spät.4 Die Kalendergeschichten wurden Brechts erfolgreichste Sammlung und zum Kanon deutscher Erzählkunst.5
In dieser Hausarbeit soll eine der berühmten Kalendergeschichten Bertolt Brechts: „Der verwundete Sokrates“ genau untersucht werden.
Hierfür wird zunächst eine formale Analyse der zusammengefassten Kalendergeschichte durchgeführt, welche die erzähltechnischen Aspekte aufzeigen wird, um die Geschichte anschließend der literarischen Gattung der Kalendergeschichte zuzuordnen. Dabei ist zu untersuchen, ob in Brechts hier zu betrachtendem Werk die Merkmale dieser literarischen Gattung traditionell umgesetzt werden. Es wird also ein Versuch sein, aufzuzeigen, inwiefern sich die Merkmale der deutschen Kalendergeschichte im Allgemeinen, von der Kalendergeschichte Brechts unterscheiden.
Im Weiteren soll geklärt werden, ob der historische Sokrates in seinen Verhaltensweisen ein Abbild der von Brecht als einzig richtig empfundene Ideologie darstellt, um anschließend auf seine Haltung gegenüber dem Krieg und dem Kapitalismus schließen zu können. Hierfür wird zuerst am Text herausgearbeitet, ob Brecht auf die hervorstehenden Eigenschaften des historischen Sokrates zurückgreift und welche Differenzen zwischen diesem und dem Sokrates aus seiner Geschichte vorliegen. Eine davon betrifft die Mäeutik, das Hervorholen der Wahrheit, welches in Verbindung mit Sokrates oft genannt wurde. Diese besondere Gesprächstaktik ist bis heute eine Kunst geblieben, die von vielen Menschen nicht recht beherrscht werden will.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Analyse
- 2.1. „Der verwundete Sokrates“
- 2.2. Gattungszuordnung
- 2.2.1. Die herkömmliche Kalendergeschichte
- 2.2.2. Brechts Kalendergeschichte
- 3. Die Schierlingsbecherproblematik
- 3.1. Ein Vergleich
- 3.2. „So ist das mit der Obrigkeit“ – Brechts Antikriegshaltung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Bertolt Brechts Kalendergeschichte „Der verwundete Sokrates“. Die Analyse fokussiert auf die erzähltechnischen Aspekte, die Gattungszuordnung im Kontext traditioneller Kalendergeschichten und die Darstellung des historischen Sokrates im Vergleich zu Brechts fiktionaler Interpretation. Die Arbeit beleuchtet Brechts Antikriegshaltung und die Problematik des Schierlingsbechers.
- Formale Analyse von Brechts Erzähltechnik
- Gattungszuordnung von „Der verwundete Sokrates“ als Kalendergeschichte
- Vergleich des historischen Sokrates mit der Figur in Brechts Erzählung
- Brechts Antikriegshaltung und ihre Darstellung im Text
- Interpretation der Schierlingsbecher-Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung situiert die Entstehung der Geschichte im Exil und beschreibt Brechts antifaschistische Haltung. Sie umreißt die Ziele der Arbeit: formale Analyse, Gattungszuordnung und Untersuchung der Darstellung Sokrates'.
Der Abschnitt „Die Analyse“ beginnt mit einer detaillierten Betrachtung von „Der verwundete Sokrates“, beschreibt die Erzählperspektive und die Handlungselemente. Die fiktionale Darstellung Sokrates' wird hervorgehoben. Der Abschnitt zur Gattungszuordnung vergleicht Brechts Werk mit traditionellen Kalendergeschichten.
Der Abschnitt über „Die Schierlingsbecherproblematik“ vertieft den Vergleich zwischen historischem und fiktionalem Sokrates, und analysiert Brechts Antikriegshaltung im Kontext der Erzählung.
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, Kalendergeschichte, „Der verwundete Sokrates“, Sokrates, Antikriegshaltung, Erzähltechnik, Gattungszuordnung, Schierlingsbecher, Faschismuskritik, Exilliteratur.
- Quote paper
- Julia Frey (Author), 2011, Bertolt Brecht: "Der verwundete Sokrates" - eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181528