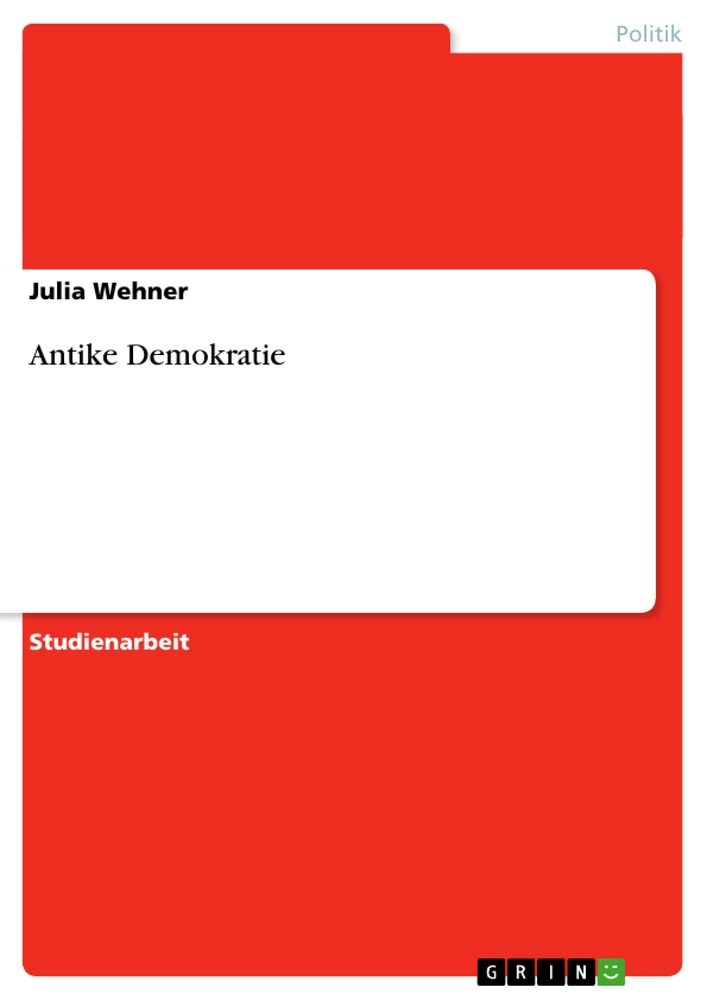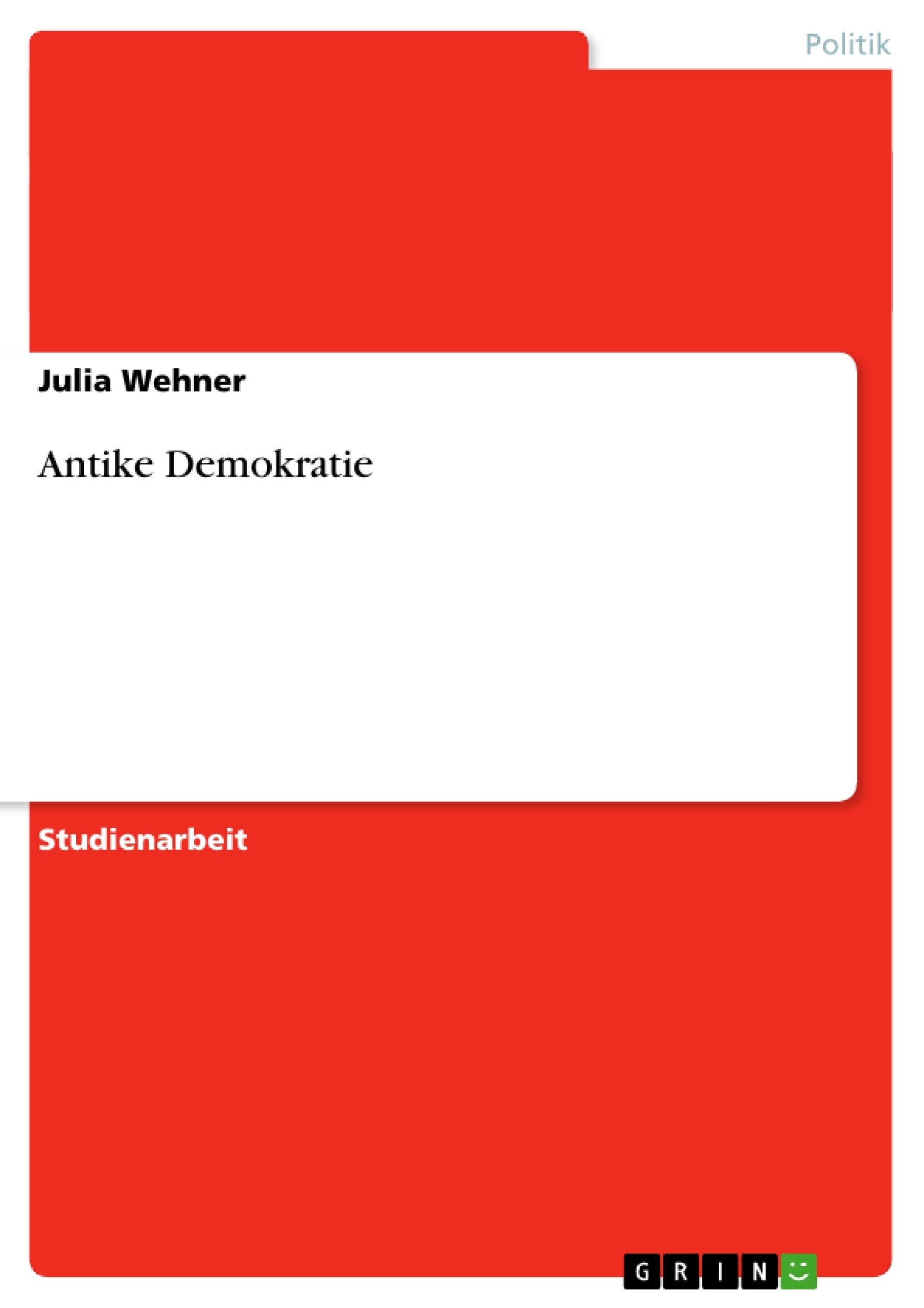Der Ursprung unserer heutigen Demokratie geht bis in die Antike zurück. Der griechische
Staatsmann Perikles definierte die Demokratie seiner Zeit als Staat, der nicht auf wenige
Bürger, sondern auf alle ausgerichtet sei. Diese Definition mag auf den ersten Blick
eindeutig klingen, aber schon die Frage danach, wie diese Mehrheit die Herrschaft ausüben
soll, zieht unterschiedliche Ausprägungen der Demokratie nach sich. Auch die
Wortbedeutungen demos „Volk“ und kratein „herrschen“ liefern keine genaue
Interpretationsgrundlage.
Fraglich ist zum einen, ob die Herrschaft durch das Volk mittelbar oder unmittelbar
ausgeübt werden soll. Entweder drückt sich die Herrschaft der Mehrheit also direkt in
Volksversammlungen und Abstimmungen, oder indirekt durch Bestellung von Vertretern
aus. Zum anderen ist zu klären, ob die Herrschaft des ganzen Volkes gemeint ist, oder ob
die Herrschaft der Vielen, also einer qualifizierten Mehrheit genügt. Daraus folgt auch die
Frage nach der damit verbundenen Minderheit und ihren Rechten. Weiterhin muss
entschieden werden, ob alle Bürgerinnen und Bürger zu jederzeit allumfassend am
Beratungs-, Entscheidungs- und Ausführungsprozess der Politik beteiligt werden muss,
oder ob dieses arbeitsteilig durch einige wenige geschehen kann.
Der Rückblick in die Antike dient also lediglich als Startpunkt für die Geschichte des
Demokratie-Begriffs. Der Demokratie folgen derzeit laut politischer Ordnung weltweit
vorgeblich 120 Staaten. Die Tatsache, dass nicht all diese Staaten wirklich demokratisch
bezeichnet werden können, verdeutlicht, dass es kein universelles Modell der Demokratie
gibt. Je nach historischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten entwickelte sich eine
bestimmte Form der Demokratie. Ausgangspunkt war jedoch stets die demokratia in
Athen, die durch Geschichtsschreiber Herodot im fünften Jahrhundert v. Chr. erstmals
festgehalten wurde.
Vorliegende Arbeit stellt eine Zusammenfassung der „Informationen zur politischen
Bildung“ (Nr.284/2004, S. 4-15) dar. Alle wörtlichen oder dem Sinn nach entnommenen
Passagen sind deshalb nicht mit genauer Quellenangabe versehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundzüge der athenischen Demokratie
- Institutionen und Verfahren
- Volksversammlung (Ekklesia)
- Rat der 500 (Boule)
- Volksgericht
- Athen Vorbild für moderne Demokratien?
- Strukturelle Unterschiede zwischen Antike und moderner Demokratie
- Grenzen der Polisdemokratie
- Prinzipien republikanischen Denkens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die athenische Demokratie im Kontext der antiken griechischen Polis und untersucht deren Relevanz für moderne Demokratien. Sie beleuchtet die Institutionen und Verfahren der athenischen Demokratie, insbesondere die Volksversammlung, den Rat der 500 und das Volksgericht. Darüber hinaus werden die strukturellen Unterschiede zwischen der antiken und der modernen Demokratie sowie die Grenzen der Polisdemokratie diskutiert.
- Die athenische Demokratie als Ursprung der Bürgerbeteiligung und Partizipationsrechte
- Die Institutionen und Verfahren der athenischen Demokratie
- Die strukturellen Unterschiede zwischen der antiken und der modernen Demokratie
- Die Grenzen der Polisdemokratie
- Die Relevanz der athenischen Demokratie für moderne Demokratien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der athenischen Demokratie ein und beleuchtet die unterschiedlichen Ausprägungen des Demokratiebegriffs. Sie stellt die Bedeutung der athenischen Demokratie als Ausgangspunkt für die Geschichte des Demokratiebegriffs heraus und verdeutlicht die Vielfältigkeit der Demokratieformen in verschiedenen historischen, sozialen und kulturellen Kontexten.
Das Kapitel "Grundzüge der athenischen Demokratie" beschreibt die Entwicklung der athenischen Demokratie von den Reformen des Solon bis zur Blütezeit unter Perikles. Es beleuchtet die soziale Differenzierung der athenischen Gesellschaft und die Rolle der Volksversammlung, des Rates der 500 und des Volksgerichts.
Das Kapitel "Institutionen und Verfahren" analysiert die Funktionsweise der wichtigsten Institutionen der athenischen Demokratie, insbesondere der Volksversammlung, des Rates der 500 und des Volksgerichts. Es beleuchtet die Prinzipien der Isonomie und die Bedeutung des Losentscheids für die Auswahl von Amtsträgern.
Das Kapitel "Athen Vorbild für moderne Demokratien?" diskutiert die Relevanz der athenischen Demokratie für moderne Demokratien. Es analysiert die strukturellen Unterschiede zwischen der antiken und der modernen Demokratie und beleuchtet die Grenzen der Polisdemokratie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die athenische Demokratie, die Polisdemokratie, die Volksversammlung, der Rat der 500, das Volksgericht, die Isonomie, die Bürgerbeteiligung, die Partizipationsrechte, die strukturellen Unterschiede zwischen der antiken und der modernen Demokratie, die Grenzen der Polisdemokratie und die Relevanz der athenischen Demokratie für moderne Demokratien.
- Quote paper
- Julia Wehner (Author), 2011, Antike Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181474