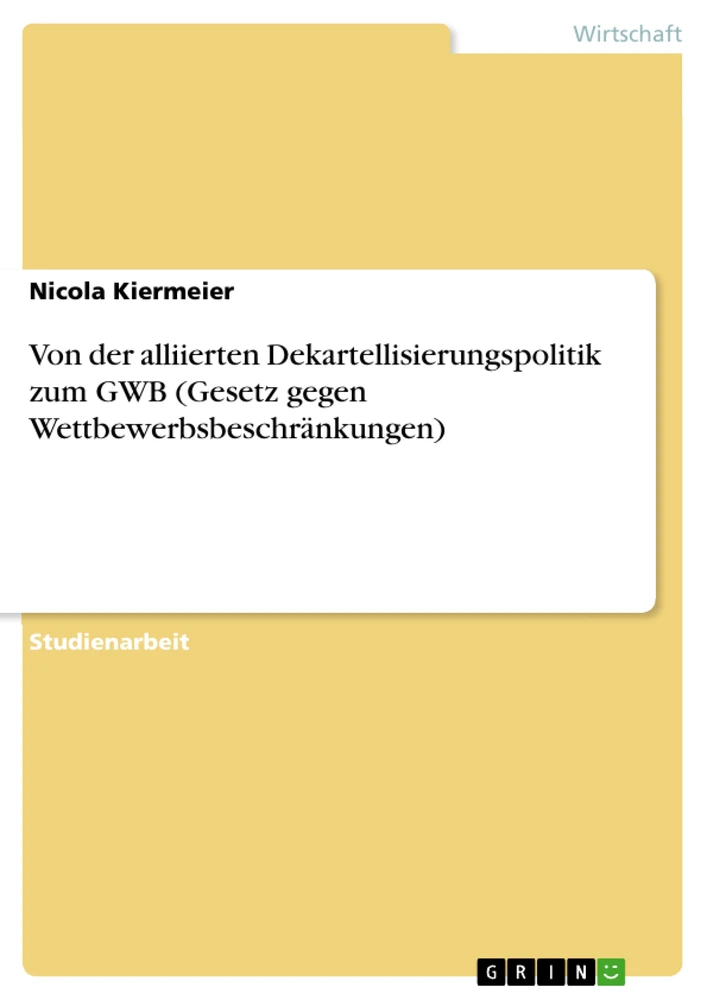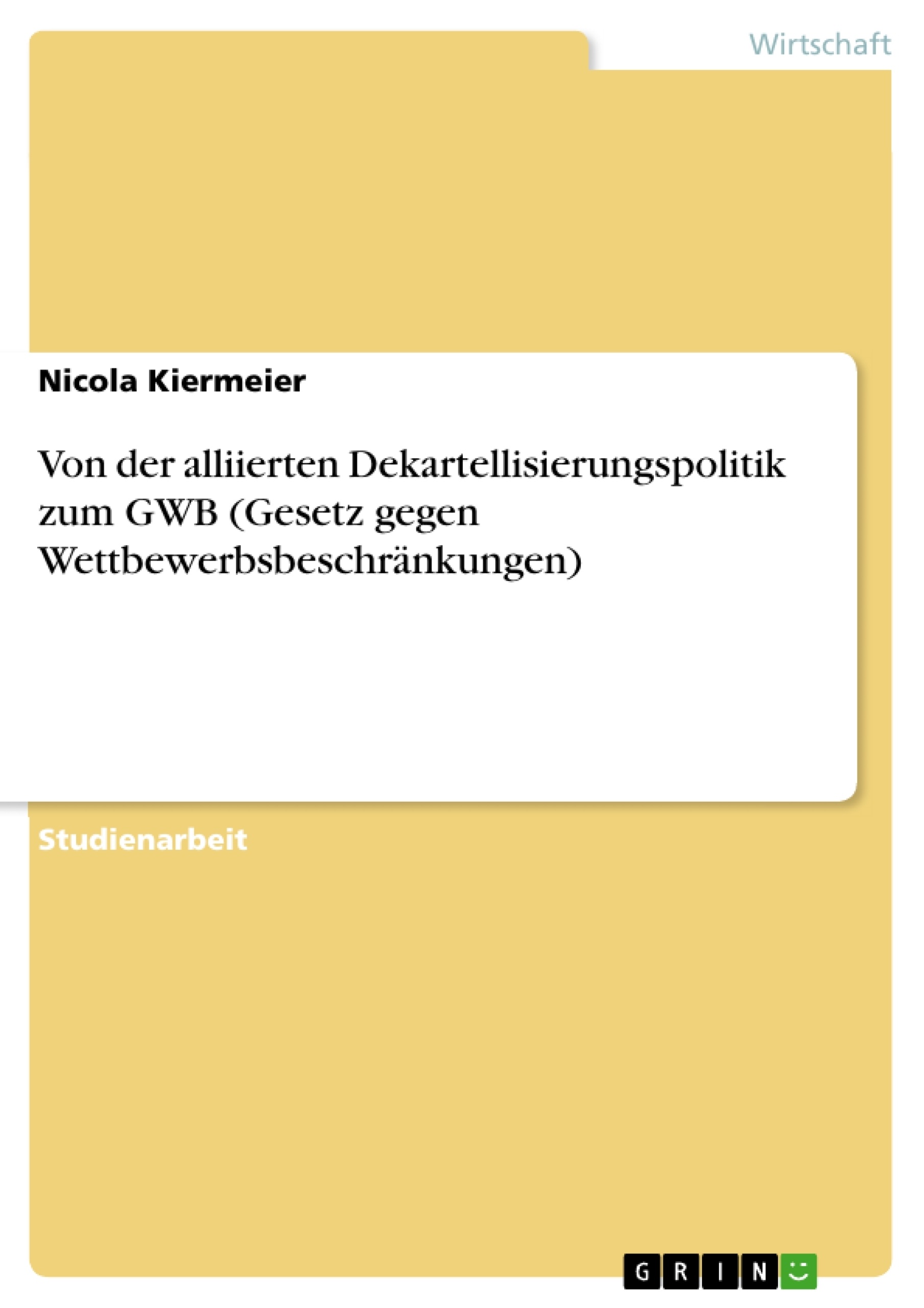„Wie unsere Körper ohne Geist, so ist ein Staat ohne Gesetz.“ (Marcus Tullius Cicero)
In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche Rolle der Staat, als übergeordnete Institution, einnehmen muss. Wie kann der Staat nach Zusammenbruch der Wirtschaft, mit Hilfe von Regelungen, die wirtschaftliche Situation wieder verbessern und welchen Einfluß haben Kartelle und Monopole? Hinter welchem Hintergrund entstand, in diesem Sinne, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957 und wie stark war der Einfluß der Alliierten, besonders der amerikanischen Regierung, auf die deutsche Kartellpolitik der Nachkriegszeit?
Diesen Fragen werde ich in der vorliegenden Arbeit an dem speziellen Beispiel des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. Juli 1957 (BGBl. 1957 I S.1081) nachgehen. Grundsätzlich werden verschiedene Definitionen des Kartellbegriffs vorgestellt und Handlungsweise von Kartellen im freien Wettbewerb und die damit verbundenen Auswirkungen näher beleuchtet. Nachfolgend wird auf die historische Entstehungsgeschichte, von der Kartellverordnung 1923, der alliierten Dekartellisierungspolitik bis zum GWB, und dessen Konzeption eingegangen und im Besonderen den Einfluss der Alliierten herausgehoben. Der Aufbau und die Gliederung des GWB wird deutlich herausgearbeitet und die Ausnahmeregelungen, welche das grundsätzliche Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Zusammenschlüssen abmildert, vorgestellt. Abgerundet wird die Arbeit mit einem zusammenfassenden Fazit, welches auch analytische Elemente enthält.
Als Grundlage meiner Arbeit benutze ich das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957. Des Weiteren wird Literatur von Walter Eucken, als Begründer des Ordoliberalismus, von Barnikel, Buchheim, Isay, Kirschstein, Langen, Mayer, Murach-Brand und Rauhut, Rundstein, Passow, Tschierschky sowie einen Artikel von Hüttenberger verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- 1. Kartellbegriff und Auswirkungen auf den Wettbewerb
- 2. Entstehungsgeschichte des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- 3. Konzeption und Ausnahmeregelungen (§§ 98- 103) des GWB
- III Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Konzeption des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) von 1957 in der Nachkriegszeit Deutschlands. Sie beleuchtet den Einfluss der alliierten Dekartellisierungspolitik und analysiert den Kartellbegriff sowie dessen Auswirkungen auf den Wettbewerb. Die Arbeit fokussiert auf die Bedeutung des GWB für die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Der Kartellbegriff und seine verschiedenen Definitionen in wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Literatur.
- Die historische Entwicklung der Kartellpolitik in Deutschland, von der Kartellverordnung 1923 bis zum GWB.
- Der Einfluss der Alliierten, insbesondere der amerikanischen Regierung, auf die deutsche Kartellpolitik.
- Die Konzeption des GWB und seine Ausnahmeregelungen.
- Die Auswirkungen von Kartellen und Monopolen auf den freien Wettbewerb und die gesamtwirtschaftliche Situation.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle des Staates bei der wirtschaftlichen Wiederherstellung nach dem Zusammenbruch und dem Einfluss der Alliierten auf die deutsche Kartellpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die verwendeten Quellen.
II Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB): Dieses Kapitel untersucht umfassend das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Es beginnt mit einer detaillierten Analyse des Kartellbegriffs, indem es verschiedene Definitionen aus wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Literatur vorstellt und deren Unterschiede herausarbeitet. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der Wettbewerbsbeschränkung als zentrales Merkmal von Kartellen und deren Auswirkungen auf Marktmechanismen, wie den Preisbildungsprozess. Der zweite Teil des Kapitels beschreibt die Entstehungsgeschichte des GWB, beginnend mit der Kartellverordnung von 1923, der alliierten Dekartellisierungspolitik und deren Einfluss auf die Gestaltung des Gesetzes. Der Einfluss der Alliierten wird kritisch beleuchtet und in den Kontext der damaligen politischen und wirtschaftlichen Situation eingeordnet. Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Konzeption des GWB und den darin enthaltenen Ausnahmeregelungen, die das grundsätzliche Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Zusammenschlüssen einschränken. Die Ausnahmeregelungen werden im Detail erläutert und analysiert.
Schlüsselwörter
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Kartell, Wettbewerb, Monopol, Dekartellisierung, Alliierte, Nachkriegswirtschaft, Ordoliberalismus, Marktmechanismen, Wettbewerbsbeschränkung, Wirtschaftspolitik.
FAQ: Analyse des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) von 1957 im Kontext der deutschen Nachkriegswirtschaft. Der Fokus liegt auf der Entstehung des GWB, beeinflusst durch die alliierte Dekartellisierungspolitik, dem Kartellbegriff und seinen Auswirkungen auf den Wettbewerb, sowie der Konzeption und den Ausnahmeregelungen des Gesetzes.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht den Kartellbegriff und seine verschiedenen Definitionen in wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Literatur. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Kartellpolitik in Deutschland, den Einfluss der Alliierten auf die deutsche Kartellpolitik, die Konzeption des GWB und seine Ausnahmeregelungen (§§ 98-103), sowie die Auswirkungen von Kartellen und Monopolen auf den freien Wettbewerb und die gesamtwirtschaftliche Situation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zum GWB und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und formuliert die Forschungsfrage. Das Hauptkapitel analysiert den Kartellbegriff, die Entstehungsgeschichte des GWB (einschließlich der Kartellverordnung von 1923 und der alliierten Dekartellisierungspolitik), und die Konzeption des GWB mit seinen Ausnahmeregelungen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die genauen Quellen sind nicht im gegebenen Text explizit aufgeführt. Die Einleitung erwähnt jedoch, dass der Aufbau der Arbeit und die verwendeten Quellen dort skizziert werden.
Welche Rolle spielte die alliierte Dekartellisierungspolitik?
Die alliierte Dekartellisierungspolitik hatte einen maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung des GWB. Die Arbeit beleuchtet diesen Einfluss kritisch und ordnet ihn in den politischen und wirtschaftlichen Kontext der Nachkriegszeit ein.
Welche Bedeutung hat der Kartellbegriff in dieser Arbeit?
Der Kartellbegriff steht im Zentrum der Analyse. Die Arbeit vergleicht verschiedene Definitionen aus wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Literatur und untersucht die Bedeutung der Wettbewerbsbeschränkung als zentrales Merkmal von Kartellen und deren Auswirkungen auf Marktmechanismen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Kartell, Wettbewerb, Monopol, Dekartellisierung, Alliierte, Nachkriegswirtschaft, Ordoliberalismus, Marktmechanismen, Wettbewerbsbeschränkung, Wirtschaftspolitik.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit ist im gegebenen Text nicht explizit ausgeführt. Es wird lediglich erwähnt, dass die Arbeit ein Fazit enthält, welches die Ergebnisse zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Der Text gibt an, dass die OCR-Daten ausschließlich für akademische Zwecke bestimmt sind, zur Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- B.A. Nicola Kiermeier (Author), 2010, Von der alliierten Dekartellisierungspolitik zum GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181437