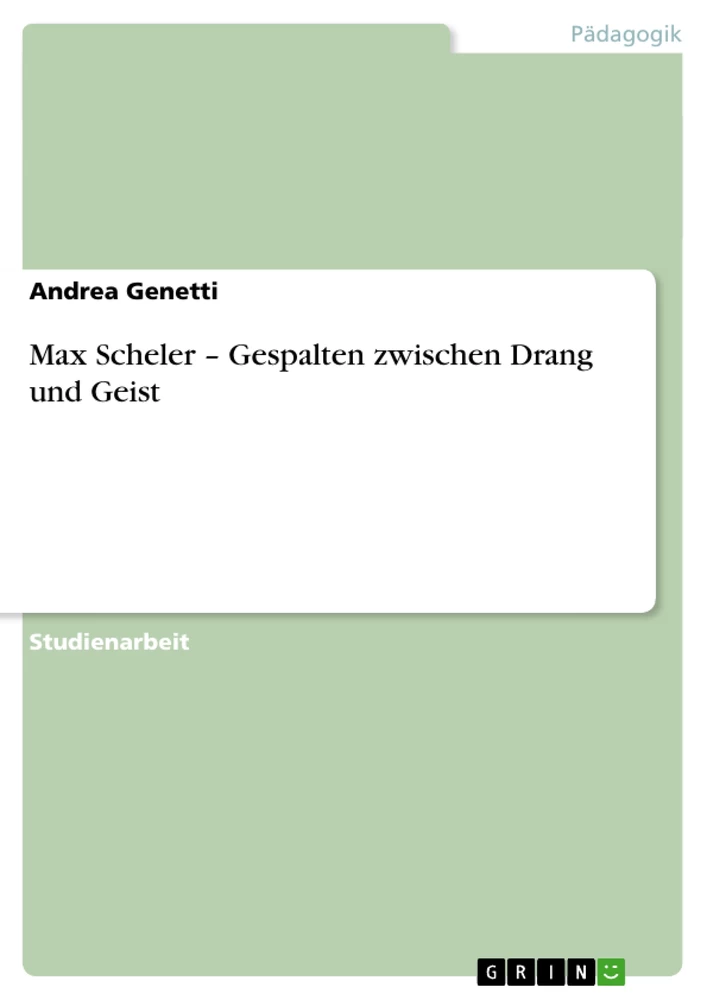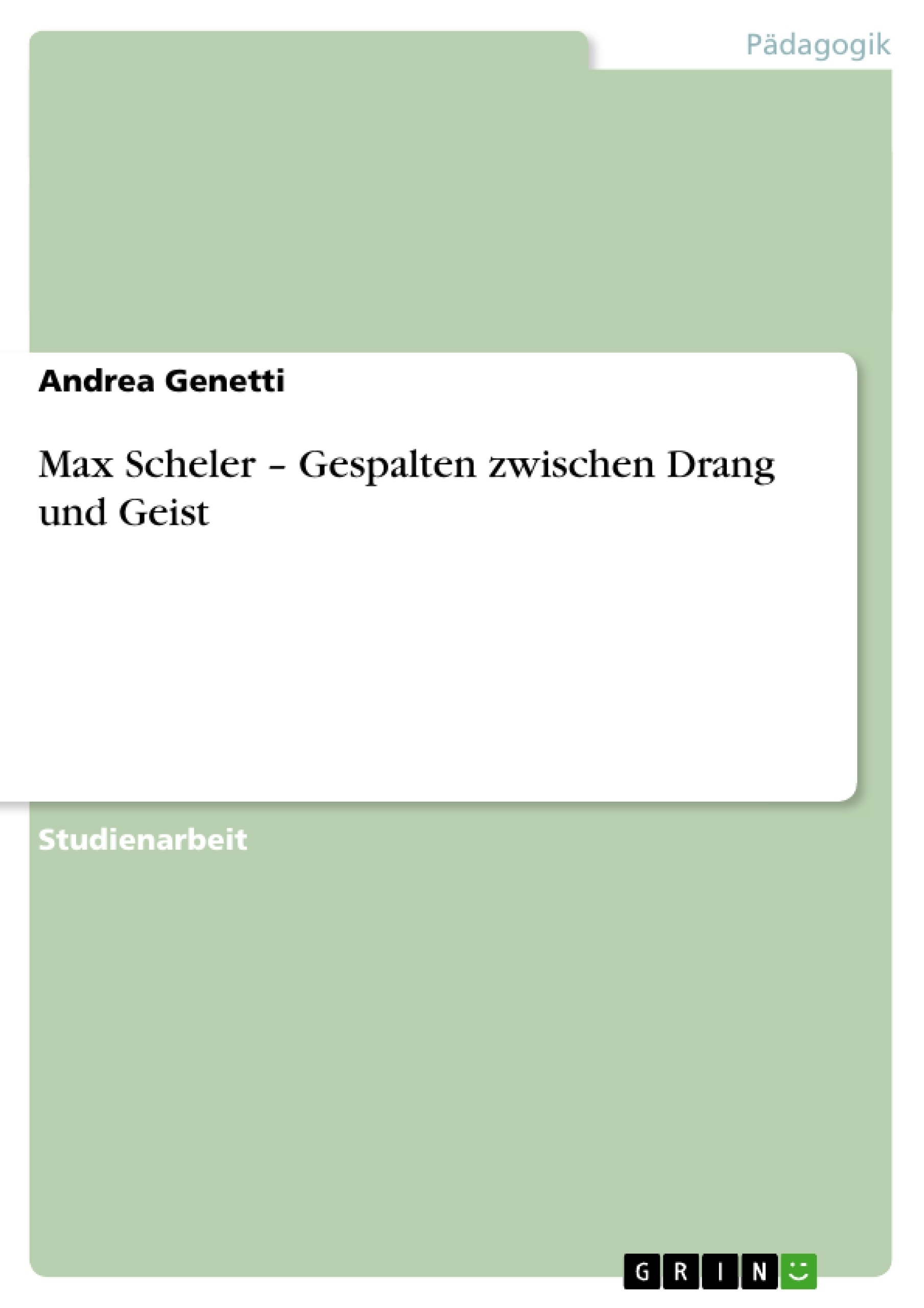Die Anthropologie von Scheler, Plessner und Gehlen haben einen Grundzug gemeinsam. Alle wollen das Wesen des Menschen bestimmen, in Bezug auf Pflanze und Tier. Es soll die Sonderstellung des Menschen herausgearbeitet werden, ebenfalls im Bezug auf Pflanze und Tier. Schelers Anthropologie unterscheidet sich zu den beiden ebenfalls genannten, durch einen dualistischen und nahe der Metaphysik angesiedelten Ansatz. Max Scheler (1874-1928) zählt neben Helmut Plessner und Arnold Gehlen zu den Hauptvertretern der Philosophischen Anthropologie.
Scheler war der Auffassung, dass “zu keiner Zeit der Geschichte der Mensch sich so problematisch geworden ist wie in der Gegenwart” (Scheler 2002,10). Er sah die Notwendigkeit, die Frage nach dem Wesen des Menschen auf der Grundlage der verschiedenen neuen Wissenschaften neu aufzurollen und “eine neue Form seines Selbstbewusstseins und seiner Selbstanschauung zu entwickeln (ebd.,6f). Nach Scheler hat es in der abendländischen Tradition bisher drei grundlegende Antwortversuche auf die Frage nach dem Menschen gegeben:
−
der Gedankenkreis der jüdisch- christlichen Tradition
−
der Gedankenkreis der griechisch – antiken Tradition
−
der Gedankenkreis der modernen Naturwissenschaft und der genetischen Psychologie
Seiner Ansicht nach genügte keine dieser Anthropologien aber mehr den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Anthropologie. Erforderlich sei ein “neuer Versuch” einer Philosophischen Anthropologie “auf breitester Grundlage” (ebd., 10). Das neue Konzept baut Scheler auf zwei Aussagekreisen auf:
−
“ Das Wesen des Menschen im Verhältnis zu Pflanze und Tier”
−
und “die metaphysische Sonderstellung des Menschen”(ebd)
Scheler unterschied zwischen den lebendigen Organismen und den anorganischen. Er schreibt allem Lebendigen eine Psyche zu: “ Was die Grenze des Psychischen betrifft, so fällt sie mit der Grenze des Lebendigen überhaupt zusammen”(ebd., 11).
Inhaltsverzeichnis
- Max Scheler - Gespalten zwischen Drang und Geist
- Der ekstatische Gefühlsdrang
- Instinkt
- Assoziatives Gedächtnis
- Organisch gebundene Intelligenz und Wahl
- Die Stellung des Menschen im Reich des Geistes
- Der Geist - Wesensmerkmale
- Die Vermögen des Geistes
- Der Geist ist reine Aktualität
- Der Mensch, ein »Asket des Lebens«
- Der entmachtete Drang als Energie des ohnmächtigen Geistes
- Die >>Selbstvergottung« des absoluten Seins im Leib der Welt
- Der Mensch als Miterzeuger des werdenden Gottes
- Unsere Stellungsnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Max Schelers anthropologische Konzeption und deren Abgrenzung von Plessner und Gehlen. Sie beleuchtet Schelers dualistischen Ansatz, der die metaphysische Sonderstellung des Menschen betont. Ein zentrales Anliegen ist die Darstellung Schelers Verständnis des Wesens des Menschen im Verhältnis zu Pflanze und Tier.
- Schelers dualistische Anthropologie und deren metaphysische Dimension
- Der Vergleich von Schelers Anthropologie mit Plessner und Gehlen
- Schelers Konzept des "ekstatischen Gefühlsdrangs" und seine Bedeutung für das Verständnis des Lebens
- Die Rolle von Instinkt und assoziativem Gedächtnis in Schelers Anthropologie
- Die Abgrenzung von tierischer und menschlicher Intelligenz bei Scheler
Zusammenfassung der Kapitel
Max Scheler - Gespalten zwischen Drang und Geist: Dieser einleitende Abschnitt präsentiert Schelers anthropologischen Ansatz im Kontext der philosophischen Anthropologie, insbesondere im Vergleich zu Plessner und Gehlen. Scheler sucht nach einer neuen, wissenschaftlichen Anthropologie, die über die bisherigen Ansätze der jüdisch-christlichen Tradition, der antiken Philosophie und der modernen Naturwissenschaften hinausgeht. Er betont die Notwendigkeit, das Wesen des Menschen neu zu definieren angesichts der Herausforderungen der Moderne. Der Text legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, indem er Schelers zentrale Fragestellung und seinen dualistischen Ansatz einführt, der das Verhältnis von "Drang" und "Geist" im Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Der ekstatische Gefühlsdrang: Scheler erweitert hier sein anthropologisches Konzept, indem er die Beseeltheit aller lebenden Organismen postuliert, beginnend mit Pflanzen. Er beschreibt den "ekstatischen Gefühlsdrang" als die grundlegende Triebkraft des Lebens, der sich bei Pflanzen als Wachstumstrieb und bei Tieren und Menschen in komplexeren Formen manifestiert. Im Gegensatz zu den Behavioristen seiner Zeit betont Scheler die Bedeutung innerer Zustände und die aktive Beziehung des Organismus zu seiner Umwelt. Dieser Abschnitt beleuchtet die graduelle Entwicklung des Gefühlsdrangs von Pflanzen über Tiere zum Menschen.
Instinkt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Instinkt als einer für das Überleben zweckmäßigen Verhaltensweise bei Tieren. Scheler differenziert zwischen Instinkt und erlerntem Verhalten und hebt die Bedeutung angeborener Entwicklungspotenziale hervor. Er widerlegt die rein behavioristische Sichtweise und betont die Komplexität tierischen Verhaltens, das nicht allein auf Reiz-Reaktions-Mechanismen reduziert werden kann. Die Erörterung des Instinkts dient als Brücke zum Verständnis des assoziativen Gedächtnisses.
Assoziatives Gedächtnis: Hier wird das assoziative Gedächtnis als eine höhere Form des Lernens bei Tieren beschrieben, die über einfache Reiz-Reaktions-Muster hinausgeht. Scheler nutzt das Beispiel des Pawlowschen Hundes, um die Fähigkeit von Tieren zu veranschaulichen, Erfahrungen zu verknüpfen und ihr Verhalten anzupassen. Die Erklärung des assoziativen Gedächtnisses bereitet den Boden für die Betrachtung der organisch gebundenen Intelligenz.
Organisch gebundene Intelligenz und Wahl: Dieses Kapitel thematisiert die praktische Intelligenz bei Tieren, die im Dienst von Trieben und Bedürfnissen steht. Scheler unterscheidet klar zwischen tierischer und menschlicher Intelligenz, wobei er letztere als die Fähigkeit definiert, auch geistigen Zielen zu dienen. Er betont, dass Tiere zwar über Intelligenz und Wahlmöglichkeiten verfügen, diese aber im Gegensatz zum Menschen nicht auf reflexiver Ebene stattfinden. Dieser Abschnitt bereitet den Weg zur Diskussion der Sonderstellung des Menschen.
Schlüsselwörter
Philosophische Anthropologie, Max Scheler, ekstatischer Gefühlsdrang, Instinkt, assoziatives Gedächtnis, Intelligenz, Mensch-Tier-Verhältnis, Dualismus, Metaphysik, Lebensphilosophie.
Häufig gestellte Fragen zu: Max Scheler - Gespalten zwischen Drang und Geist
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht Max Schelers anthropologische Konzeption und deren Abgrenzung von Plessner und Gehlen. Sie beleuchtet Schelers dualistischen Ansatz, der die metaphysische Sonderstellung des Menschen betont und sein Verständnis des Wesens des Menschen im Verhältnis zu Pflanze und Tier darstellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Zentrale Themen sind Schelers dualistische Anthropologie und ihre metaphysische Dimension, ein Vergleich mit Plessner und Gehlen, Schelers Konzept des "ekstatischen Gefühlsdrangs", die Rolle von Instinkt und assoziativem Gedächtnis in seiner Anthropologie sowie die Abgrenzung von tierischer und menschlicher Intelligenz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung zu Schelers anthropologischem Ansatz. Es folgen Kapitel zum ekstatischen Gefühlsdrang, Instinkt, assoziativem Gedächtnis, organisch gebundener Intelligenz und Wahl. Die Arbeit gipfelt in der Diskussion der Sonderstellung des Menschen im Verhältnis zu Pflanze und Tier.
Was ist der "ekstatische Gefühlsdrang" nach Scheler?
Scheler beschreibt den "ekstatischen Gefühlsdrang" als die grundlegende Triebkraft des Lebens, die sich von Pflanzen über Tiere bis zum Menschen in steigender Komplexität manifestiert. Er betont damit die Bedeutung innerer Zustände und die aktive Beziehung des Organismus zu seiner Umwelt.
Wie unterscheidet Scheler zwischen tierischer und menschlicher Intelligenz?
Scheler unterscheidet zwischen der praktischen Intelligenz von Tieren, die im Dienst von Trieben steht, und der menschlichen Intelligenz, die auch geistigen Zielen dienen kann. Tierische Intelligenz findet im Gegensatz zur menschlichen nicht auf reflexiver Ebene statt.
Welche Rolle spielen Instinkt und assoziatives Gedächtnis in Schelers Anthropologie?
Instinkt wird als zweckmäßige Verhaltensweise bei Tieren beschrieben, während das assoziative Gedächtnis eine höhere Form des Lernens darstellt, die über einfache Reiz-Reaktions-Muster hinausgeht. Beide Konzepte dienen Scheler als Vergleichspunkte für das Verständnis menschlicher Fähigkeiten.
Wie lässt sich Schelers Anthropologie im Vergleich zu Plessner und Gehlen einordnen?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Schelers Anthropologie und den Ansätzen von Plessner und Gehlen. Dies dient der Einordnung von Schelers Werk in den Kontext der philosophischen Anthropologie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Philosophische Anthropologie, Max Scheler, ekstatischer Gefühlsdrang, Instinkt, assoziatives Gedächtnis, Intelligenz, Mensch-Tier-Verhältnis, Dualismus, Metaphysik, Lebensphilosophie.
Welche metaphysische Dimension hat Schelers Anthropologie?
Schelers Anthropologie betont die metaphysische Sonderstellung des Menschen. Dieser Dualismus zwischen "Drang" und "Geist" ist ein zentrales Element seiner metaphysischen Betrachtungsweise.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die HTML-Datei enthält Kapitelzusammenfassungen, welche die zentralen Argumente und Thesen jedes Kapitels knapp zusammenfassen.
- Quote paper
- Andrea Genetti (Author), 2010, Max Scheler – Gespalten zwischen Drang und Geist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181432