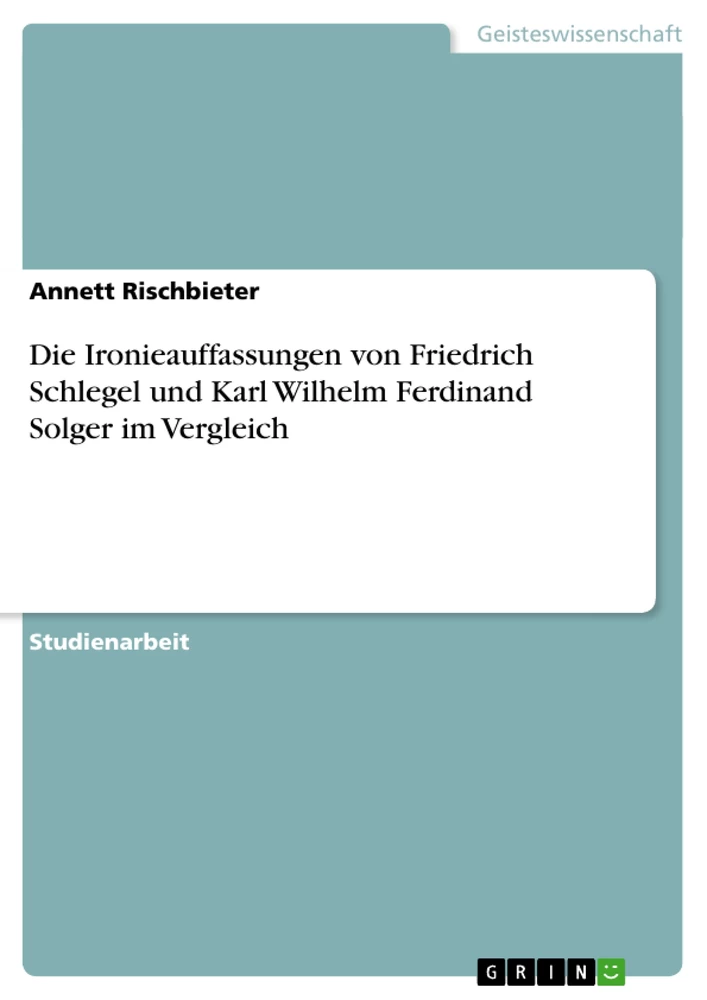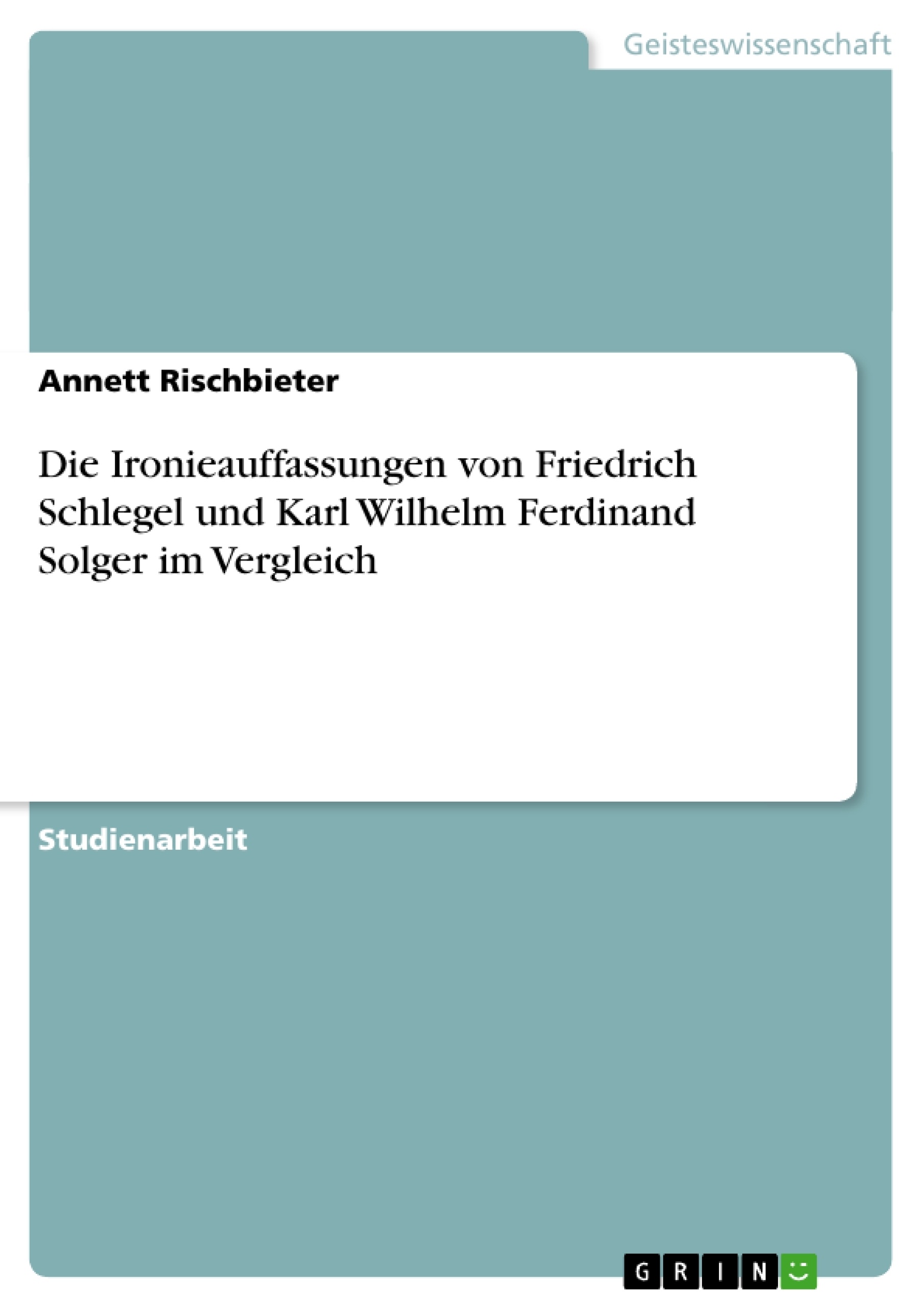Romantische Ironie bedeutet die Überlegenheit des genialen Menschen, der über den Dingen
steht, diese nicht ernst nimmt, sie und auch sich selbst, sein eigenes Tun jederzeit aufzulösen
und zu überwinden vermag. Sie ist Bewusstseinshaltung und künstlerisches Vermögen
zugleich. Indem die romantische Ironie sich als selbständiger Akt in der Seele des Schaffenden
abspielt, umschließt sie die dialektische Einheit seiner selbstbewegenden und selbstbewegten
ideellen Kraft. Poesie und Ironie werden identisch, sie vereinigen sich in der Grundhaltung
des Subjekts.
Friedrich Schlegel entwickelt im Ausgang von Johann Gottlieb Fichtes Wissenschaftslehre
die romantische Ironie, indem er dessen Kategorien in der Kunst zur Anwendung bringt.
Schlegel und die Frühromantiker radikalisieren Fichtes subjektiven Idealismus und übertragen
seine einem überindividuellen, als Gattungswesen verstandenen Subjekt zugeschriebene Autonomie
auf das einzelne Individuum. Die mit dem Ich assoziierten produktiven und aktiven
Eigenschaften werden in die Philosophie der Kunst übernommen. Der Ich-Begriff Fichtes
bildet die Folie, von der sich die Ironie erhebt. Ironie ist nicht länger bloße ästhetische Kategorie,
sie erweitert ihre Bedeutung über dieses Stadium hinaus zu einer geschichtsphilosophischen
Kategorie, welche sich hauptsächlich mit der Haltung des Subjekts gegenüber der Realität
beschäftigt.
Auf den nachfolgenden Seiten möchte ich versuchen, eine Theorie der romantischen Ironie zu
entwerfen. Dafür werde ich verschiedene Schriften heranziehen, um aus diesen eine Theorie
der Ironie herauszuarbeiten. Konzentrieren will ich mich dabei besonders auf Friedrich Schlegel
und Karl Ferdinand Wilhelm Solger.
Von Schlegel werde ich die Fragmente des Lyceum und Athenäum behandeln. Sie sind die
wichtigste Quelle für die ursprüngliche Konzeption der romantischen Ironie. In den Lyceums-
Fragmenten wurde Ironie bestimmt als eine Erhebung über sich selbst aus Freiheit, eine aus
Selbstschöpfung und Selbstvernichtung resultierende Selbstbeschränkung, auch unendliche
Kraft genannt. In den Athenäums-Fragmenten geht es um die Bestimmung eines dynamischen
Prinzips: einer über Gegensätze und Synthesis sich vollziehenden Lebensbewegung. Im abschließenden
Band des Athenäum, in dem sich der Essay Über die Unverständlichkeit befindet,
macht Schlegel weitere Äußerungen zu dieser Thematik. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. VORBEMERKUNG
- II. IRONIE BEI FRIEDRICH SCHLEGEL
- Die Fragmente
- 1. Die Lyceums-Fragmente
- 2. Das Athenäum
- Die Zeitschrift
- f) Ironie in den Athenäums-Fragmenten
- Gespräch über die Poesie
- Ideen-Sammlung
- Über die Unverständlichkeit
- Die Fragmente
- III. IRONIE BEI KARL WILHELM FERDINAND SOLGER
- 1. Künstlerische Ironie in Solgers Schriften
- a) Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst
- b) Vorlesungen über Ästhetik
- 2. Formen der Ironie
- a) Die unechte Ironie
- b) Die echte Ironie
- 1. Künstlerische Ironie in Solgers Schriften
- IV. HEGELS KRITIK DER IRONIE
- 1. Hegel über Schlegel
- 2. Hegel über Solger
- V. VERGLEICH SCHLEGEL - SOLGER
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption der romantischen Ironie bei Friedrich Schlegel und Karl Wilhelm Ferdinand Solger im Vergleich. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Auffassungen von Ironie aufzuzeigen und die Bedeutung dieses Konzepts für die deutsche Romantik zu beleuchten.
- Die Entwicklung der romantischen Ironie im Kontext der deutschen Romantik
- Die unterschiedlichen Auffassungen von Ironie bei Schlegel und Solger
- Der Einfluss von Fichtes Philosophie auf die Konzeption der romantischen Ironie
- Die Verbindung von Ironie und Poesie bei Schlegel und Solger
- Die Kritik Hegels an der romantischen Ironie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Begriff der romantischen Ironie definiert und die zentralen Fragen der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden die Schriften Schlegels analysiert, insbesondere die Fragmente des Lyceums und Athenäum. Die Analyse zeigt, wie Schlegel Ironie als eine Form der Selbstüberwindung und Selbstfindung begreift.
Kapitel drei beschäftigt sich mit Solgers Konzeption der Ironie. Die Arbeit konzentriert sich auf Solgers Werke „Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst“ und „Vorlesungen über Ästhetik“. In diesen Werken zeigt Solger, wie Ironie sowohl in der Kunst als auch im Leben eine wichtige Rolle spielt.
Kapitel vier widmet sich der Kritik Hegels an der romantischen Ironie. Die Arbeit untersucht Hegels Rezension zu Solgers Schriften sowie seine Vorlesungen über die Ästhetik. In dieser Analyse werden Hegels Argumente gegen die romantische Ironie beleuchtet.
Das fünfte Kapitel bietet einen Vergleich der Ironie-Konzeptionen von Schlegel und Solger. Die Arbeit zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Auffassungen auf und untersucht die Bedeutung dieser Konzeptionen für die deutsche Romantik.
Schlüsselwörter
Romantische Ironie, Friedrich Schlegel, Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Poesie, Kunst, Selbstüberwindung, Selbstfindung, Ästhetik, Geschichte, Philosophie.
- Quote paper
- M.A. Annett Rischbieter (Author), 2003, Die Ironieauffassungen von Friedrich Schlegel und Karl Wilhelm Ferdinand Solger im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18080