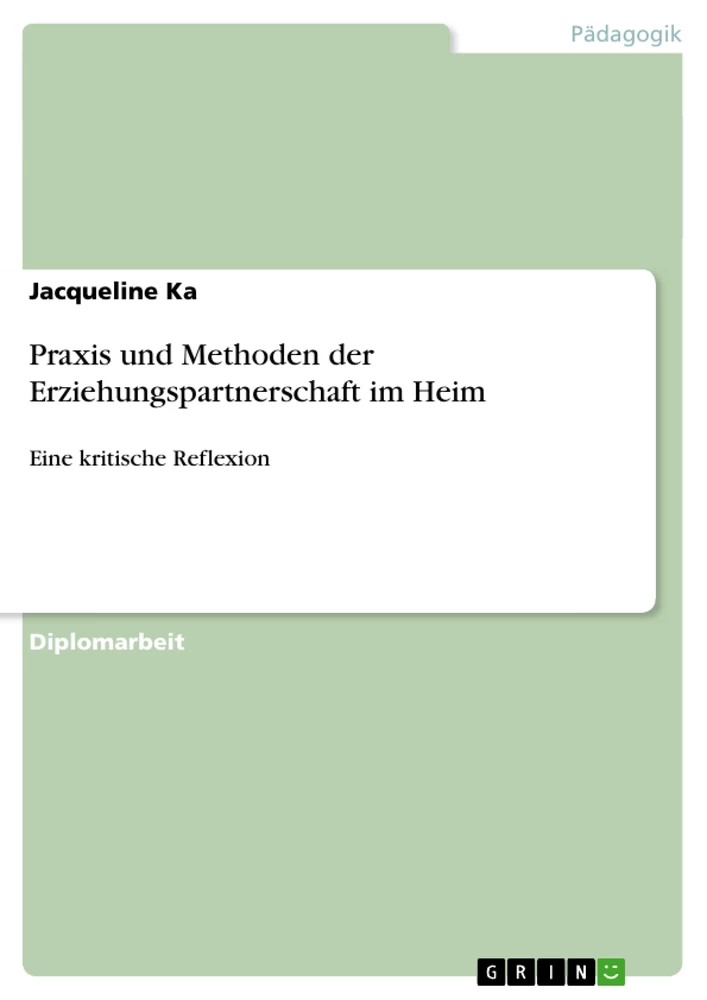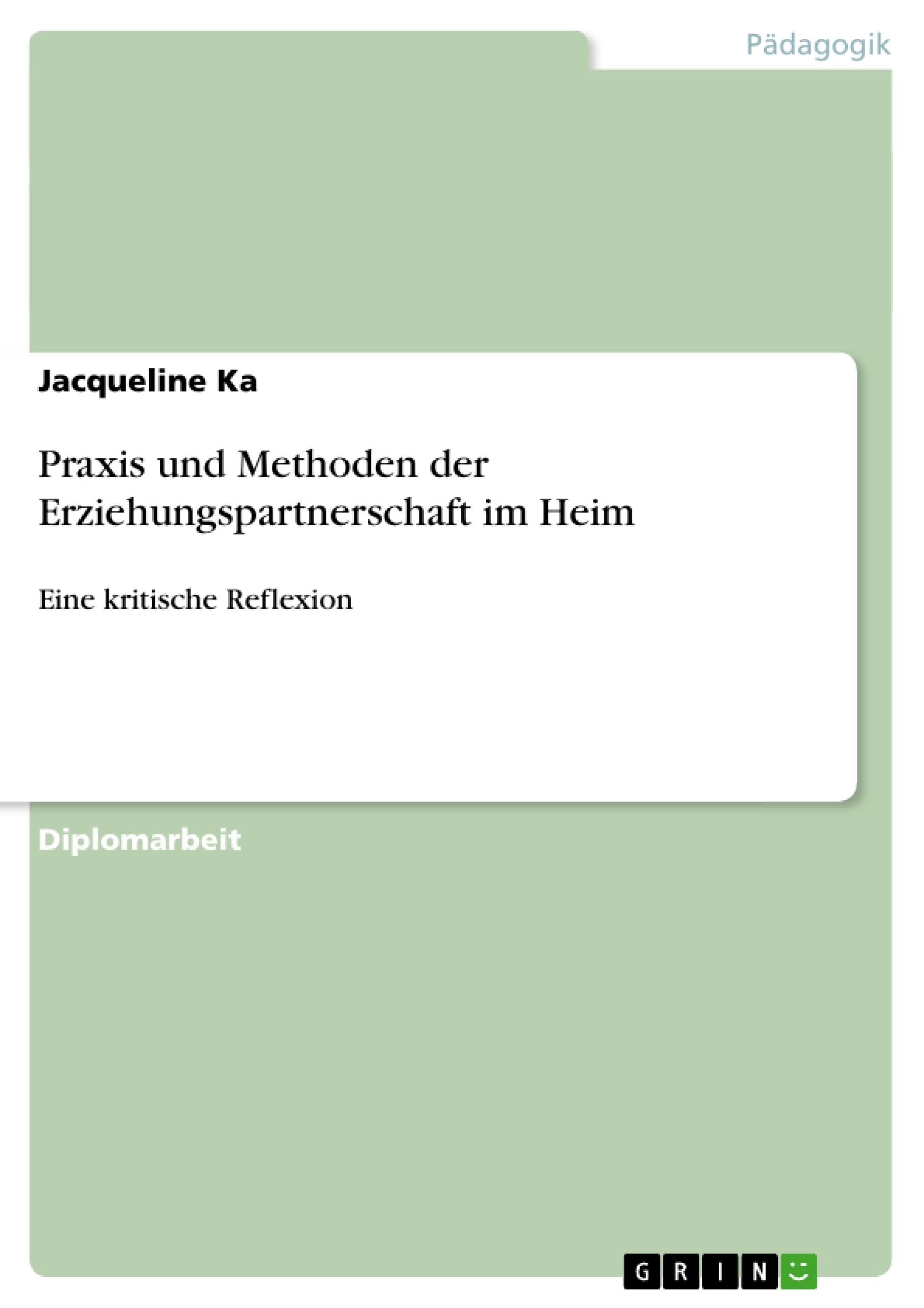Während meines Studiums habe ich ein 2-monatiges Praktikum in einer stationären
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe absolviert. Im Rahmen meiner Tätigkeit kam ich
mit allen Bereichen in Kontakt und konnte somit die verschiedenen Ebenen der
sozialpädagogischen Institution kennenlernen. Dabei bin ich auch auf das Phänomen
„Elternarbeit“ in vollstationär unterbringenden Einrichtungen gestoßen.
In der Praktikumszeit machte ich die Erfahrung, dass den Eltern weitreichende
Informationen, zum Beispiel Kenntnisse über den Ablauf des Heimalltags, fehlen und sie in
Entscheidungen oftmals zu wenig einbezogen werden. Des Weiteren war der Umgang der
Erzieher mit den Eltern nicht immer der Beste: Die Eltern der Kinder wurden vorwiegend
als Störfaktoren und als Konkurrenz wahrgenommen. Die Arbeit mit den Eltern ließ viele
Schwierigkeiten aufkommen und nicht selten kam es zu persönlichen
Auseinandersetzungen zwischen Erziehern und Eltern.
Auch in meinem absolvierten Praktikum im Jugendamt sind mir negative Einstellungen
seitens der Mitarbeiter gegenüber den Eltern aufgefallen. Diese wurden als zusätzliche
Arbeit und als Hindernis für eine erfolgreiche Kindesentwicklung angesehen.
Diese als Last empfundene Arbeit mit den Eltern seitens der Mitarbeiter nahm ich als
Anstoß, mein Augenmerk auf die Elternarbeit in der Heimerziehung zu richten.
Die Arbeit soll aufzeigen, dass von diesem Denken Abschied zu nehmen ist, denn gerade
der Einbezug der Eltern kann im größten Teil aller Fälle positive Entwicklungen bewirken.
Eltern nehmen aufgrund von kindlichen Loyalitätskonflikten weiterhin, ob positiv oder
negativ, Einfluss auf ihr Kind. Studien bestätigen die Bedeutung von Elternarbeit als eine
wesentliche Einflussgröße auf den Hilfeverlauf. Egal, was die leiblichen Eltern im
Elternhaus gemacht haben, die Familie bleibt wichtig für ihre Kinder und muss in der
weiteren Entwicklung mit einbezogen werden.
Unter Familie werden in der Diplomarbeit insbesondere Eltern, Elternteile, Geschwister,
Großeltern, Stiefmutter/Stiefvater, aber auch Freunde der alleinerziehenden Elternteile und
Bezugspersonen aus der nahen Verwandtschaft verstanden, soweit sie in das gesamte
soziale Beziehungsgeflecht innerhalb der Herkunftsfamilie einzubeziehen sind. So ist das
Kind immer im Kontext seines gesamten Beziehungsgeflechtes zu sehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangsbasis praktischer Elternarbeit
- Geschichtliche Entwicklung der Elternarbeit
- Rechtliche Grundlage
- Rechtliche Verankerung der Familienorientierung im KJHG
- Zwischen Elternrecht und Kindeswohl
- Begriffsbestimmung und Definition der Elternarbeit
- Begründung der Notwendigkeit der Elternarbeit
- Ziele und Zielgruppen der Elternarbeit
- Wer leistet Elternarbeit?
- Voraussetzungen für die Elternarbeit
- Eltern und Fachkräfte - ein partnerschaftliches Verhältnis?
- Fallarbeit
- Formen und Methoden der Elternarbeit
- Kooperationsansätze
- Informelle Elternarbeit
- Informative Angebote
- Schriftliche Mitteilungen
- Elternrundbriefe
- Heimzeitung
- Einzelkontakte
- Telefonkontakte
- Tür-und-Angel-Gespräche
- Elternsprechstunden
- Formelle Elternarbeit
- Standardisierte Formen unter Beteiligung der Familie, Erzieher und Jugendamtsmitarbeiter
- Aufnahmegespräche
- Hilfeplangespräche
- Vorbereitung der Entlassung und Nachbetreuung
- Angebote unter Beteiligung der Familie und Erzieher
- Hausbesuche
- Feste mit Eltern und Kindern
- Angebote unter Beteiligung der Eltern und Erzieher
- Thematischer Elternabend
- Elterngruppen
- Eltern als Miterzieher
- Besuche der Eltern in der Gruppe
- Eltern im Gruppenalltag
- Familienpädagogische Wochenenden
- Eltern- und Familienfreizeiten
- Beurlaubungen der Heimkinder zu den Eltern
- Beratungsansatz und Elterntraining
- Elternberatung
- Elterntraining
- Therapeutische Familieninterventionen
- Systemische Familientherapie
- Familienaktivierung durch Aufnahme ganzer Familien
- Eltern-Kind-Beobachtung mit Video-Home-Training
- Elternarbeit bei nicht absehbarer Rückführung
- Elternarbeit als Trauerarbeit
- Elternarbeit ohne Eltern - Eine Paradoxie?
- Elternarbeit zur Unterstützung des Ablösevorgangs
- Hindernisse und Erschwernisse der Elternarbeit
- Schwierigkeiten seitens der Eltern
- Einstellungen und Haltungen der Eltern
- Desinteresse
- Sprache und Sprachniveau
- Eltern in schwieriger persönlicher Situation
- Sozial unterprivilegierte Familien
- Schwierigkeiten seitens der Erzieher
- Einstellungen und Haltungen der Fachkräfte
- Mangelnde Qualifikation
- Allgemeine Schwierigkeiten
- Zeitliche und personelle Ressourcen
- Finanzielle Ressourcen
- Motivation zur Elternarbeit
- Professionelle Grundstandards in der Elternarbeit
- Effektivität von Elternarbeit
- Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der Elternarbeit
- Verschiedene Formen und Methoden der Elternarbeit (informell und formell)
- Herausforderungen und Hindernisse in der Elternarbeit (von Seiten der Eltern und Erzieher)
- Notwendigkeit und Bedeutung der Erziehungspartnerschaft
- Faktoren, die die Effektivität der Elternarbeit beeinflussen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Praxis und Methoden der Erziehungspartnerschaft in Heimen und reflektiert diese kritisch. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze der Elternarbeit zu beleuchten und Herausforderungen sowie Erfolgsfaktoren zu identifizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Erziehungspartnerschaft in Heimen ein und beschreibt die Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit. Sie liefert einen Überblick über den Aufbau und den Inhalt der Arbeit und stellt den theoretischen Rahmen vor.
Ausgangsbasis praktischer Elternarbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Elternarbeit und die relevanten rechtlichen Grundlagen, insbesondere die Verankerung der Familienorientierung im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Es wird der Spannungsbereich zwischen Elternrechten und Kindeswohl thematisiert.
Begriffsbestimmung und Definition der Elternarbeit: Hier wird der Begriff "Elternarbeit" präzise definiert und abgegrenzt. Es werden verschiedene Perspektiven und Verständnisse des Begriffs diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Analyse zu schaffen.
Begründung der Notwendigkeit der Elternarbeit: Dieses Kapitel argumentiert für die Notwendigkeit von Elternarbeit in Heimen. Es werden verschiedene Aspekte wie die Bedeutung der Bindung, die Förderung der Entwicklung des Kindes und die Stärkung der Familie thematisiert. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften wird hervorgehoben.
Ziele und Zielgruppen der Elternarbeit: Hier werden die Ziele der Elternarbeit detailliert beschrieben und die verschiedenen Zielgruppen definiert (Eltern, Kinder, Fachkräfte). Es wird dargelegt, wie die Ziele auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt sein sollten.
Wer leistet Elternarbeit?: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Akteure, die an der Elternarbeit beteiligt sind. Es werden die Rollen und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Akteure, wie z.B. Erzieher, Sozialarbeiter und Jugendamtsmitarbeiter, untersucht und ihre Zusammenarbeit analysiert.
Voraussetzungen für die Elternarbeit: Dieses Kapitel untersucht die notwendigen Voraussetzungen für erfolgreiche Elternarbeit. Es werden Faktoren wie die Bereitschaft der Eltern, die Qualifikation der Fachkräfte und die Ressourcen des Heims beleuchtet. Die Bedeutung einer guten Kommunikation und eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen Eltern und Fachkräften wird hervorgehoben.
Eltern und Fachkräfte - ein partnerschaftliches Verhältnis?: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Eltern und Fachkräften im Kontext der Elternarbeit. Es wird untersucht, welche Faktoren zu einer erfolgreichen Partnerschaft beitragen und welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt. Die Bedeutung von Vertrauen und gegenseitigem Respekt wird hervorgehoben.
Fallarbeit: Das Kapitel beschreibt die praktische Anwendung der Elternarbeit an Hand von Fallbeispielen und zeigt wie diese in die Praxis umgesetzt wird. Es beleuchtet unterschiedliche Konstellationen und zeigt die Schwierigkeiten auf, die in der Praxis auftreten.
Formen und Methoden der Elternarbeit: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Formen und Methoden der Elternarbeit, sowohl informelle (z.B. Elterngespräche, Elternbriefe) als auch formelle (z.B. Hilfeplangespräche, Elternabende). Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden diskutiert und deren Anwendung in der Praxis erläutert. Die Integration der Eltern in den Alltag des Heimes wird als wichtige Methode betont.
Hindernisse und Erschwernisse der Elternarbeit: Dieses Kapitel analysiert die Hindernisse und Schwierigkeiten, die die erfolgreiche Umsetzung der Elternarbeit behindern können. Es werden sowohl Schwierigkeiten seitens der Eltern (z.B. Desinteresse, Sprachbarrieren, schwierige persönliche Situationen) als auch seitens der Erzieher (z.B. mangelnde Qualifikation, Zeitmangel) betrachtet. Zusätzlich werden allgemeine Schwierigkeiten wie Ressourcenmangel beleuchtet.
Motivation zur Elternarbeit: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Motivation von allen Beteiligten für den Erfolg der Elternarbeit. Es werden Faktoren diskutiert, die die Motivation fördern oder hemmen können. Die Bedeutung einer wertschätzenden Haltung und einer positiven Arbeitsatmosphäre wird hervorgehoben.
Professionelle Grundstandards in der Elternarbeit: Dieses Kapitel formuliert professionelle Grundstandards für die Elternarbeit. Es werden Qualitätskriterien definiert und Maßnahmen zur Qualitätssicherung vorgeschlagen. Die Bedeutung von Fortbildung und Supervision wird betont.
Effektivität von Elternarbeit: Das Kapitel untersucht, welche Faktoren die Effektivität der Elternarbeit beeinflussen. Es werden wissenschaftliche Erkenntnisse und empirische Befunde diskutiert.
Schlüsselwörter
Erziehungspartnerschaft, Heim, Elternarbeit, KJHG, Familienorientierung, Methoden, Kooperation, Herausforderungen, Effektivität, Professionalisierung
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Erziehungspartnerschaft in Heimen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Praxis und Methoden der Erziehungspartnerschaft in Heimen und reflektiert diese kritisch. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze der Elternarbeit, identifiziert Herausforderungen und Erfolgsfaktoren und analysiert die Effektivität solcher Maßnahmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Elternarbeit, verschiedene Formen und Methoden (informell und formell), Herausforderungen und Hindernisse (von Seiten der Eltern und Erzieher), die Notwendigkeit und Bedeutung der Erziehungspartnerschaft sowie Faktoren, die die Effektivität der Elternarbeit beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, Ausgangsbasis praktischer Elternarbeit (inklusive geschichtlicher Entwicklung und rechtlicher Grundlagen), Begriffsbestimmung und Definition der Elternarbeit, Begründung der Notwendigkeit, Ziele und Zielgruppen, Akteure der Elternarbeit, Voraussetzungen für erfolgreiche Elternarbeit, dem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Eltern und Fachkräften, Fallarbeit, Formen und Methoden der Elternarbeit (informell und formell), Hindernisse und Erschwernisse, Motivation, professionelle Grundstandards und schließlich die Effektivität der Elternarbeit.
Welche Formen und Methoden der Elternarbeit werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen informellen Methoden wie schriftliche Mitteilungen, Elternrundbriefe, Einzelkontakte (Telefon, Tür-und-Angel-Gespräche, Elternsprechstunden) und formellen Methoden wie Aufnahmegespräche, Hilfeplangespräche, Hausbesuche, Feste, thematische Elternabende, Elterngruppen, Eltern als Miterzieher (Besuche in der Gruppe, Eltern im Gruppenalltag, Wochenenden/Freizeiten), Beratungsansätze und Elterntraining sowie therapeutische Interventionen (systemische Familientherapie, Video-Home-Training).
Welche Hindernisse und Schwierigkeiten werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Schwierigkeiten seitens der Eltern (Einstellungen, Desinteresse, Sprache, persönliche Situation, soziale Benachteiligung), seitens der Erzieher (Einstellungen, Qualifikation), und allgemeine Schwierigkeiten (Zeit, Personal, finanzielle Ressourcen).
Welche Ziele verfolgt die Elternarbeit laut dieser Arbeit?
Die Ziele der Elternarbeit zielen auf die Förderung der Entwicklung des Kindes, die Stärkung der Familie und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften ab. Die spezifischen Ziele sind je nach Zielgruppe (Eltern, Kinder, Fachkräfte) unterschiedlich.
Wer sind die Akteure der Elternarbeit?
An der Elternarbeit sind verschiedene Akteure beteiligt, darunter Erzieher, Sozialarbeiter, Jugendamtsmitarbeiter und natürlich die Eltern selbst. Die Arbeit analysiert die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure und deren Zusammenarbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erziehungspartnerschaft, Heim, Elternarbeit, KJHG, Familienorientierung, Methoden, Kooperation, Herausforderungen, Effektivität, Professionalisierung.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und Zielsetzung erläutert. Es folgen Kapitel, die die einzelnen Aspekte der Elternarbeit systematisch behandeln. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind im bereitgestellten Text nicht explizit aufgeführt. Die Arbeit analysiert jedoch Faktoren, die die Effektivität der Elternarbeit beeinflussen und formuliert professionelle Grundstandards.
- Quote paper
- Jacqueline Ka (Author), 2010, Praxis und Methoden der Erziehungspartnerschaft im Heim, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180724