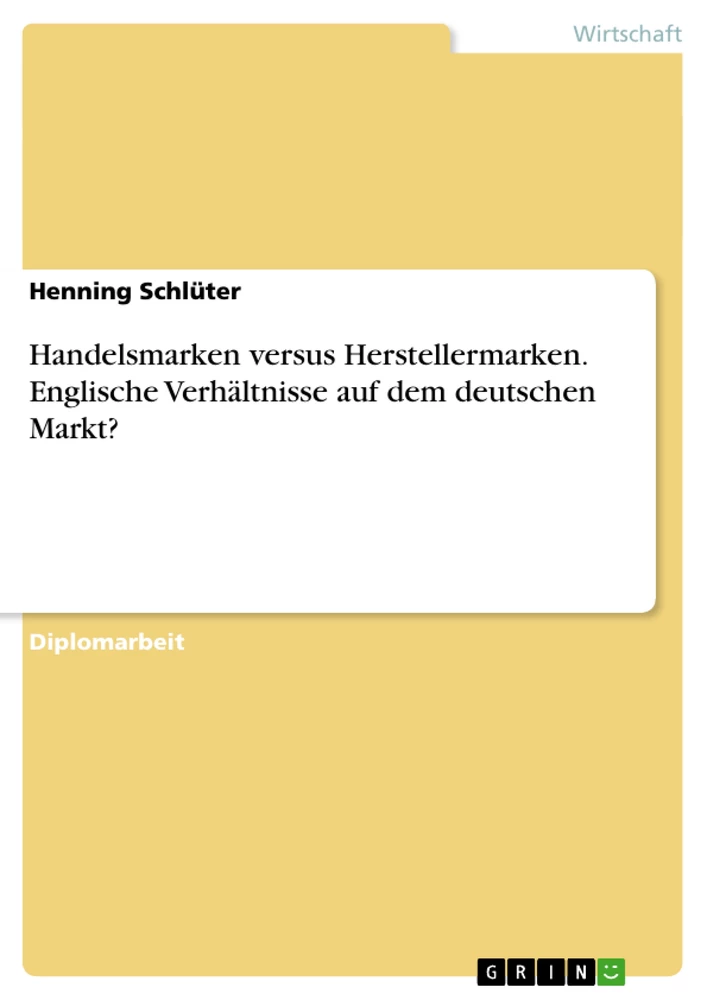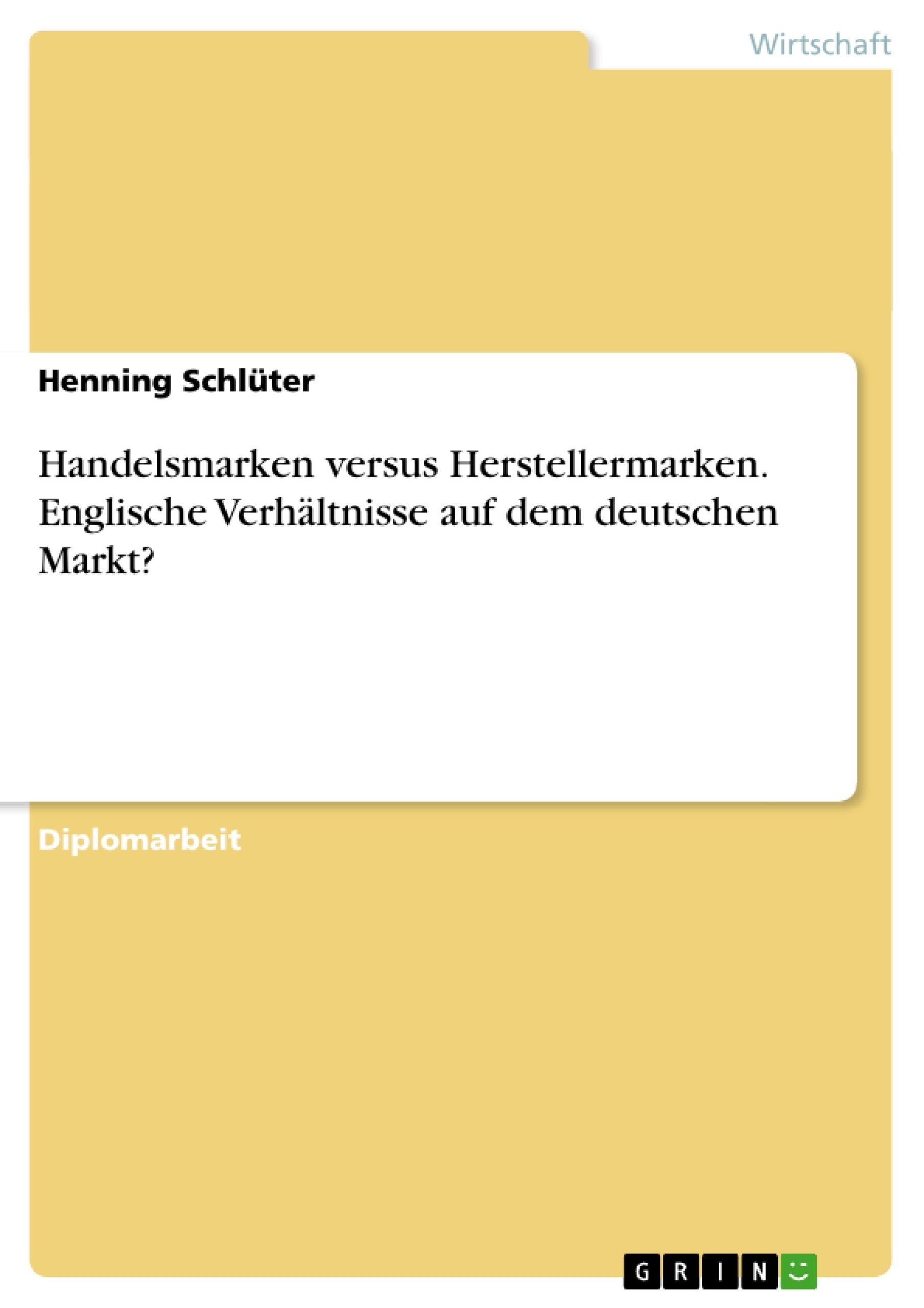Die Handelsmarken sind heute eines der wichtigsten Profilierungsinstrumente im
Marketingmix der jeweiligen Vertriebsschiene der Handelskonzerne. Sie schaffen
Kundenbindung und führen weg vom alleinigen Fokus auf den Preis. Handelsmarken
sind damit nicht nur ein betriebswirtschaftlicher Faktor, der an Bedeutung immer
mehr zunimmt, sondern ein unternehmenspolitisches Strategieelement, an dem
überall kräftig gearbeitet wird.
Angesichts der konjunkturellen Lage und der häufig zitierten „Teuro“-Umstellung sowie
des damit verbundenen Discounter-Booms ist die Handelsmarkenentwicklung
verstärkt in den Blickpunkt geraten.
Im Jahre 1975 lag der Handelsmarkenanteil in Deutschland noch bei 11,7 % und
stieg bis zum Jahre 2002 stetig auf 27,2 %. Andere Länder wie Großbritannien haben
deutlich höhere Eigenmarkenanteile (45 %). Diese Abschlussarbeit „Handelsmarken
versus Herstellermarken – Englische Verhältnisse am deutschen Markt?“
nimmt sich zum Ziel, die Handelsmarken und Herstellermarken näher zu betrachten,
die gegenwärtige Situation sowie weitere Entwicklung zu durchleuchten.
Während in Kapitel 2 die relevanten Begriffe bestimmt und gegeneinander abgegrenzt
werden, erläutert Kapitel 3 die Grundmotive der Handelsunternehmen für den
Aufbau von Handelsmarken.
In Kapitel 4 wird auf die Machtpositionen der Industriemarkenhersteller und Handelsunternehmen
eingegangen und Gründe für die Produktion oder Nichtproduktion von
Eigenmarken genannt. Anhand von Beispielen werden verschiedene Unternehmensausrichtungen
von Konsumgüterunternehmen bezüglich ihrer Handelsmarkenstrategie
beschrieben.
Das Kapitel 5 behandelt die heutige Marktsituation. Zunächst wird der deutsche
Markt betrachtet und Handelsmarken relevante Themen erörtert. Es folgt die Beschreibung
der internationalen Situation in bezug auf die Eigenmarken. Hier werden
länderspezifische Besonderheiten anhand von Beispielen genannt. Kapitel 6 zeigt einen Blick in die Zukunft: Hier wird erörtert, ob zukünftig mit einer
weiteren Zunahme der Handelsmarken zu rechnen ist und gar englische Verhältnisse
d.h. ein Eigenmarkenanteil von 35 bis 40 Prozent am Gesamtumsatz erreicht werden
können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Marke
- Herstellermarke
- Definition
- Entstehung
- Handelsmarke
- Definition
- Entstehung
- Abgrenzung
- Zusammenfassung
- Grundmotive für den Aufbau von Handelsmarken
- Erhöhung der Ertragssituation
- Stärkung der Verhandlungsposition
- Differenzierung des Sortiments und Kundenbindung
- Internationalisierung
- Sortimentsoptimierung
- Zusammenfassung
- Machtpositionen zwischen Industriemarkenherstellern und Handelsunternehmen
- Gründe für die Produktion von Handelsmarken aus Sicht der Industriemarkenhersteller
- Gründe für die Nichtproduktion von Handelsmarken aus Sicht der Industriemarkenhersteller
- Gradwanderung in der Unternehmensausrichtung der Industriemarkenhersteller
- Beispiele der Unternehmensausrichtung von Industriemarkenherstellern
- Kellogg's
- Masterfoods
- Nestlé
- Dalli-Werke
- Fehler der Industriemarkenhersteller
- Zusammenfassung
- Der Markt heute
- Deutschland
- Warengruppen
- Betriebstypen
- Markenbindung
- Handelsmarkentypen
- Euroeinführung
- Konjunktur
- Handelskonzentration
- Probleme bei der Situationsbetrachtung
- International
- Situationsanalyse
- Handelskonzentration
- Preisliche Positionierung
- Geschäftsformate
- Internationalisierung
- Länderspezifische Besonderheiten
- Großbritannien
- USA
- Schweiz
- Frankreich
- Weitere europäische Länder
- Zusammenfassung
- Blick in die Zukunft
- Zunahme der internationalen Handelskonzentration
- Prognosen der Handelsmarkenentwicklung
- Planungen der Händler
- Marktforschungsinstitute
- GfK Nürnberg
- KPMG und EHI Köln
- Ausschöpfung des Potenzials von Handelsunternehmen
- Hoffnungsschimmer der Konsumgüterindustrie
- Zusammenfassung
- Gesamtzusammenfassung in Thesen
- Schlussbetrachtung
- Entwicklung und Bedeutung von Handelsmarken im Vergleich zu Herstellermarken
- Strategische Motive von Handelsunternehmen beim Aufbau von Handelsmarken
- Reaktionen der Herstellermarkenhersteller auf den Aufstieg von Handelsmarken
- Marktentwicklung in Deutschland und auf internationaler Ebene
- Zukunftsperspektiven für Handelsmarken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Entwicklung von Handelsmarken im Vergleich zu Herstellermarken und untersucht die Gründe für den Aufstieg der Handelsmarken im Lebensmittelhandel. Dabei werden die strategischen Motive von Handelsunternehmen und die Reaktionen der Herstellermarkenhersteller beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff der Marke und grenzt Herstellermarken von Handelsmarken ab. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Motive für den Aufbau von Handelsmarken durch Handelsunternehmen erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Machtposition zwischen Industriemarkenherstellern und Handelsunternehmen und analysiert die Gründe für die Produktion oder Nichtproduktion von Handelsmarken aus Sicht der Hersteller. Kapitel 4 gibt einen Überblick über den aktuellen Markt für Handelsmarken in Deutschland und international, wobei verschiedene Aspekte wie Warengruppen, Betriebstypen, Markenbindung und länderspezifische Besonderheiten betrachtet werden. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Zukunftsperspektiven für Handelsmarken, wobei Prognosen der Handelsmarkenentwicklung und die Einschätzungen von Marktforschungsinstituten beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Handelsmarken, Herstellermarken, Lebensmittelhandel, strategische Motive, Machtposition, Marktentwicklung, Deutschland, international, Zukunftsperspektive, Prognosen, Marktforschungsinstitute
- Quote paper
- Henning Schlüter (Author), 2003, Handelsmarken versus Herstellermarken. Englische Verhältnisse auf dem deutschen Markt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18070