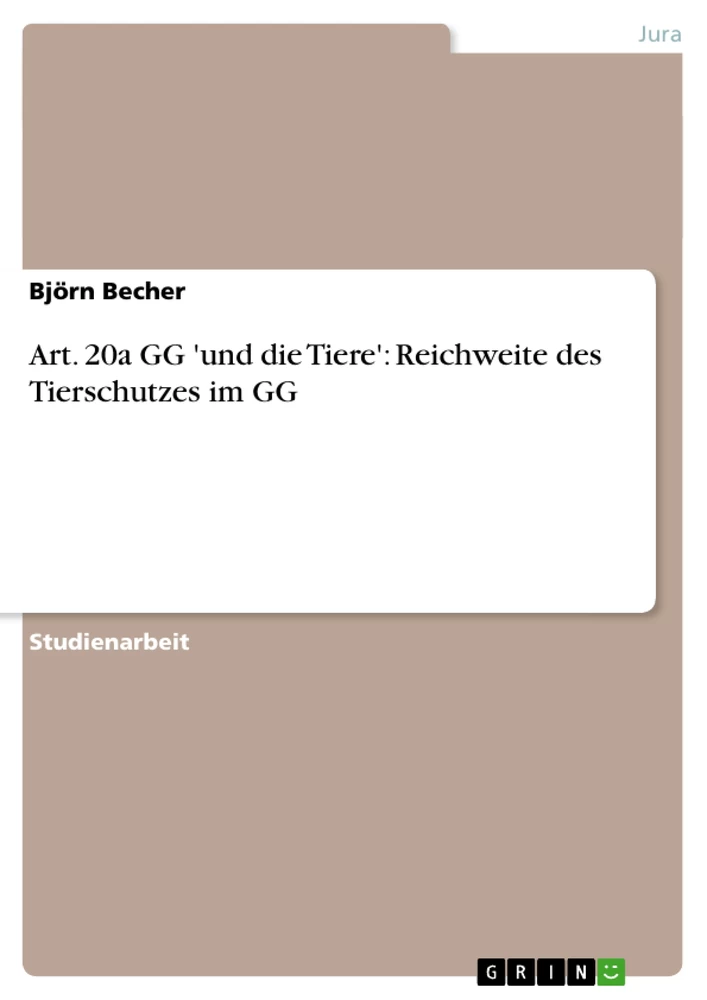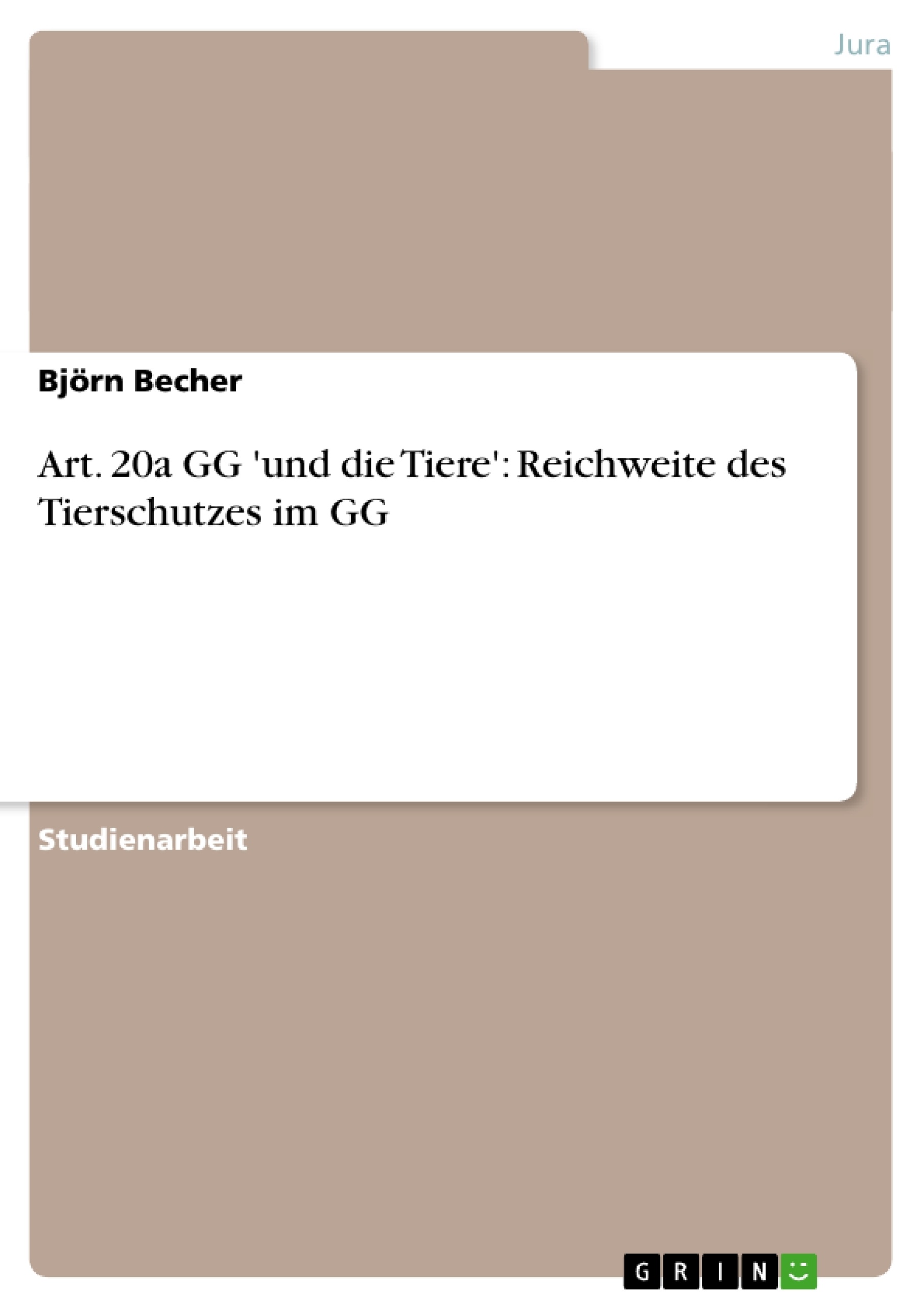In der Juristerei können wenige Buchstaben viel verändern. Genau um elf Buchstaben
wurde jahrelang mitunter sehr leidenschaftlich gestritten, bis am 17.05.2002 der Bundestag
mit einer überwältigten Mehrheit beschloss das Grundgesetz, genauer den Art. 20a GG, um
die drei Worte „und die Tiere“ zu ergänzen. Wenig später stimmte auch der Bundesrat diesem
zu.
Diese Arbeit beschäftigt sich nach einem kurzen historischen Abriss des Weges bis hin zur
Ergänzung des Grundgesetzes und einem Überblick über die vorherigen Diskussionen, ob
der Tierschutz nicht schon Verfassungsrang hatte, vor allem mit den Auswirkungen, welche
diese elf neuen Buchstaben in Artikel 20a GG, genau bringen werden. Dabei werden
vor allem die Auswirkungen der Grundgesetzänderung auf die unbeschränkt gewährleisteten
Grundrechte der Kunstfreiheit, der Lehr- und Forschungsfreiheit, sowie der Religionsfreiheit
im Vordergrund stehen. In diesen Bereichen gab es in der Vergangenheit
zahlreiche Urteile, bei welchen die Gerichte unter den neuen Voraussetzungen bei der Beurteilung
des Falles unter Umständen zu einem anderen Ergebnis kommen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Der Weg zur Grundgesetzänderung
- I. Erste Formen des Tierschutzes in Deutschland
- II. Diskussionen anlässlich der deutschen Einheit
- III. Erste Fortschritte auf Länderebene
- IV. Gesetzesinitiativen nach der Bundestagswahl 1998
- V. Die Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz 2002
- C. Streit über den Verfassungsrang von Tierschutz vor der Grundgesetzänderung
- I. Herleitung aus der Präambel
- II. Herleitung aus der Menschenwürdegarantie des Art. 1 I GG
- III. Herleitung aus Art. 2 GG
- IV. Herleitung aus dem Umweltschutz (Art. 20a GG a.F.)
- V. Herleitung aus der Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Nr. 20 GG)
- VI. Ergebnis zum Streit über den Verfassungsrang des Tierschutzes
- D. Die künftige Bedeutung des Staatsziels Tierschutzes
- I. Zur Rechtsnatur von Staatszielbestimmungen
- II. Auswirkungen für die Legislative
- III. Auswirkungen für die Exekutive
- IV. Auswirkungen für die Judikative
- 1. Tierschutz und die Forschungsfreiheit
- a) Schutzbereich der Forschungsfreiheit
- b) Eingriff
- c) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs
- aa) Staatsziel Tierschutz ein Rechtswert mit Verfassungsrang?
- (1) Vergleich mit dem Sozialstaatsprinzip
- (2) Vergleich mit dem Umweltschutzprinzip
- bb) Folgerungen aus dem Verfassungsrang des Tierschutzes
- aa) Staatsziel Tierschutz ein Rechtswert mit Verfassungsrang?
- 2. Tierschutz und die Lehrfreiheit
- 3. Tierschutz und die Kunstfreiheit
- 4. Tierschutz und die Religionsfreiheit
- a) Die Regeln des Schächtens
- b) Entscheidungen der Rechtssprechung zum Schächten
- c) Die neue Rechtslage durch den Verfassungsrang des Tierschutzes
- 5. Tierschutz und Grundrechte mit Gesetzesvorbehalt
- 1. Tierschutz und die Forschungsfreiheit
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reichweite des Tierschutzes im Grundgesetz, insbesondere nach der Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel in Art. 20a GG. Die Zielsetzung besteht darin, den Weg zur Grundgesetzänderung nachzuvollziehen, den Streit um den Verfassungsrang des Tierschutzes vor der Änderung zu beleuchten und die Auswirkungen des neuen Staatsziels auf verschiedene Bereiche des Rechts zu analysieren.
- Entwicklung des Tierschutzes in Deutschland
- Streit um den Verfassungsrang des Tierschutzes
- Auswirkungen des Staatsziels Tierschutz auf die Gesetzgebung
- Konflikte zwischen Tierschutz und Grundrechten
- Die Bedeutung des Tierschutzes im Grundgesetz
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des Tierschutzes und die Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Verankerung.
B. Der Weg zur Grundgesetzänderung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Tierschutzes in Deutschland, von frühen Formen des Tierschutzes bis hin zur Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel ins Grundgesetz. Es beleuchtet die Diskussionen und Gesetzesinitiativen, die zu dieser Entwicklung führten, und zeigt die Herausforderungen auf, die mit dem Integrationsprozess verbunden waren. Die einzelnen Unterkapitel illustrieren die schrittweise Annäherung an eine umfassendere rechtliche Regulierung des Tierschutzes in Deutschland.
C. Streit über den Verfassungsrang von Tierschutz vor der Grundgesetzänderung: Vor der Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz gab es kontroverse Diskussionen über dessen Verfassungsrang. Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Argumente, die für eine Herleitung des Tierschutzes aus verschiedenen Grundrechtsartikeln oder der Präambel vorgebracht wurden. Es untersucht die verschiedenen juristischen Ansätze und wertet die dazugehörigen Debatten aus, um den Kontext der gesetzlichen Änderung zu verdeutlichen.
D. Die künftige Bedeutung des Staatsziels Tierschutzes: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel auf die Legislative, Exekutive und Judikative. Es analysiert die Rechtsnatur von Staatszielbestimmungen und untersucht Konfliktfälle mit anderen Grundrechten wie der Forschungs-, Lehr-, Kunst- und Religionsfreiheit. Die detaillierte Auseinandersetzung mit Schächten und möglichen Einschränkungen der Forschungsfreiheit verdeutlicht die Komplexität der gesetzlichen Regulierung im Kontext des Tierschutzes.
Schlüsselwörter
Tierschutz, Grundgesetz, Art. 20a GG, Staatsziel, Verfassungsrang, Grundrechte, Forschungsfreiheit, Lehrfreiheit, Kunstfreiheit, Religionsfreiheit, Schächten, Umweltschutz, Gesetzgebung, Exekutive, Judikative.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Der Verfassungsrang des Tierschutzes
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert den Verfassungsrang des Tierschutzes in Deutschland, insbesondere nach der Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel in Artikel 20a des Grundgesetzes (GG). Es beleuchtet den historischen Weg zur Grundgesetzänderung, den juristischen Streit um den Tierschutz vor der Änderung und die Auswirkungen des neuen Staatsziels auf verschiedene Rechtsbereiche.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Weg zur Grundgesetzänderung, Streit um den Verfassungsrang vor der Änderung, Bedeutung des Staatsziels Tierschutz und Fazit. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel und manchmal sogar weitere Unterpunkte unterteilt, um die komplexe Thematik detailliert zu untersuchen. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die verwendeten Schlüsselwörter.
Welche historischen Entwicklungen werden behandelt?
Das Dokument beschreibt die Entwicklung des Tierschutzes in Deutschland von frühen Formen bis zur Verankerung im Grundgesetz. Es beleuchtet Diskussionen anlässlich der deutschen Einheit, Fortschritte auf Länderebene und Gesetzesinitiativen nach der Bundestagswahl 1998, die schließlich zur Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz im Jahr 2002 führten.
Welcher Streit wurde vor der Grundgesetzänderung geführt?
Vor der Grundgesetzänderung gab es kontroverse Diskussionen über den Verfassungsrang des Tierschutzes. Das Dokument analysiert Argumente für eine Herleitung des Tierschutzes aus der Präambel, der Menschenwürdegarantie (Art. 1 I GG), Art. 2 GG, dem Umweltschutz (Art. 20a GG a.F.) und der Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Nr. 20 GG).
Welche Auswirkungen hat das Staatsziel Tierschutz?
Die Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel hat Auswirkungen auf die Legislative, Exekutive und Judikative. Das Dokument analysiert diese Auswirkungen und untersucht mögliche Konflikte mit anderen Grundrechten wie der Forschungs-, Lehr-, Kunst- und Religionsfreiheit. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Problematik des Schächten und den Einschränkungen der Forschungsfreiheit.
Welche Rolle spielt der Tierschutz im Verhältnis zu anderen Grundrechten?
Das Dokument untersucht detailliert die Abwägung des Tierschutzes mit anderen Grundrechten, die einen Gesetzesvorbehalt aufweisen. Es analysiert die Rechtsprechung zu Konflikten zwischen Tierschutz und Forschungsfreiheit, Lehrfreiheit, Kunstfreiheit und Religionsfreiheit (insbesondere im Kontext des Schächten).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Tierschutz, Grundgesetz, Art. 20a GG, Staatsziel, Verfassungsrang, Grundrechte, Forschungsfreiheit, Lehrfreiheit, Kunstfreiheit, Religionsfreiheit, Schächten, Umweltschutz, Gesetzgebung, Exekutive, Judikative.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Jurist*innen, Wissenschaftler*innen, Studierende und alle, die sich für den Tierschutz und dessen verfassungsrechtliche Verankerung interessieren. Es bietet eine umfassende Analyse der Thematik und eignet sich für akademische Zwecke.
- Quote paper
- Björn Becher (Author), 2003, Art. 20a GG 'und die Tiere': Reichweite des Tierschutzes im GG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18068