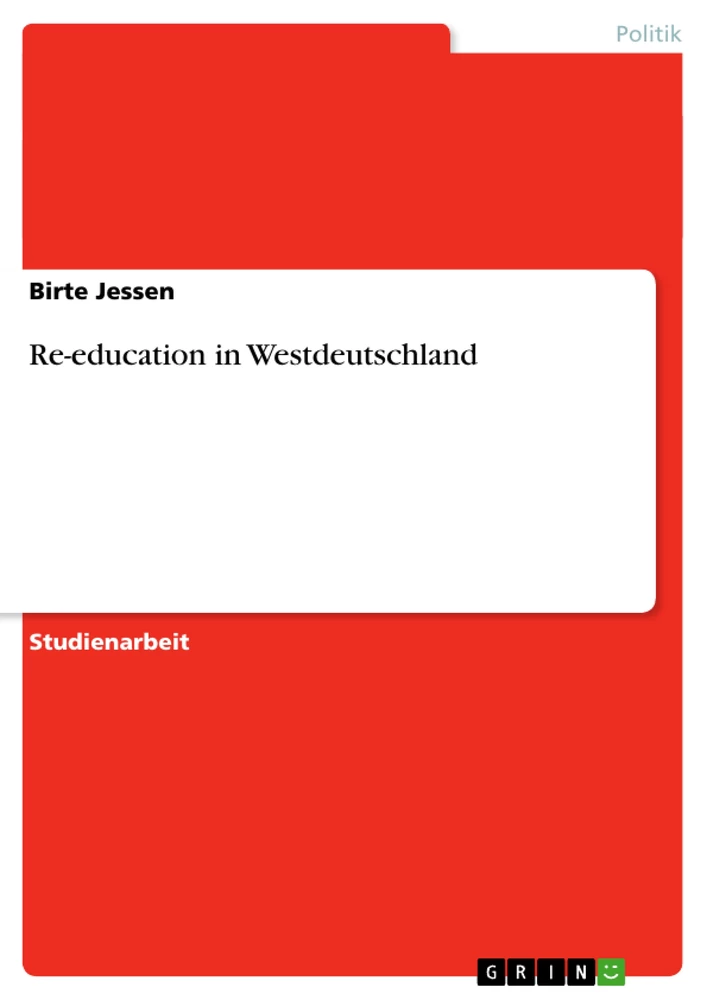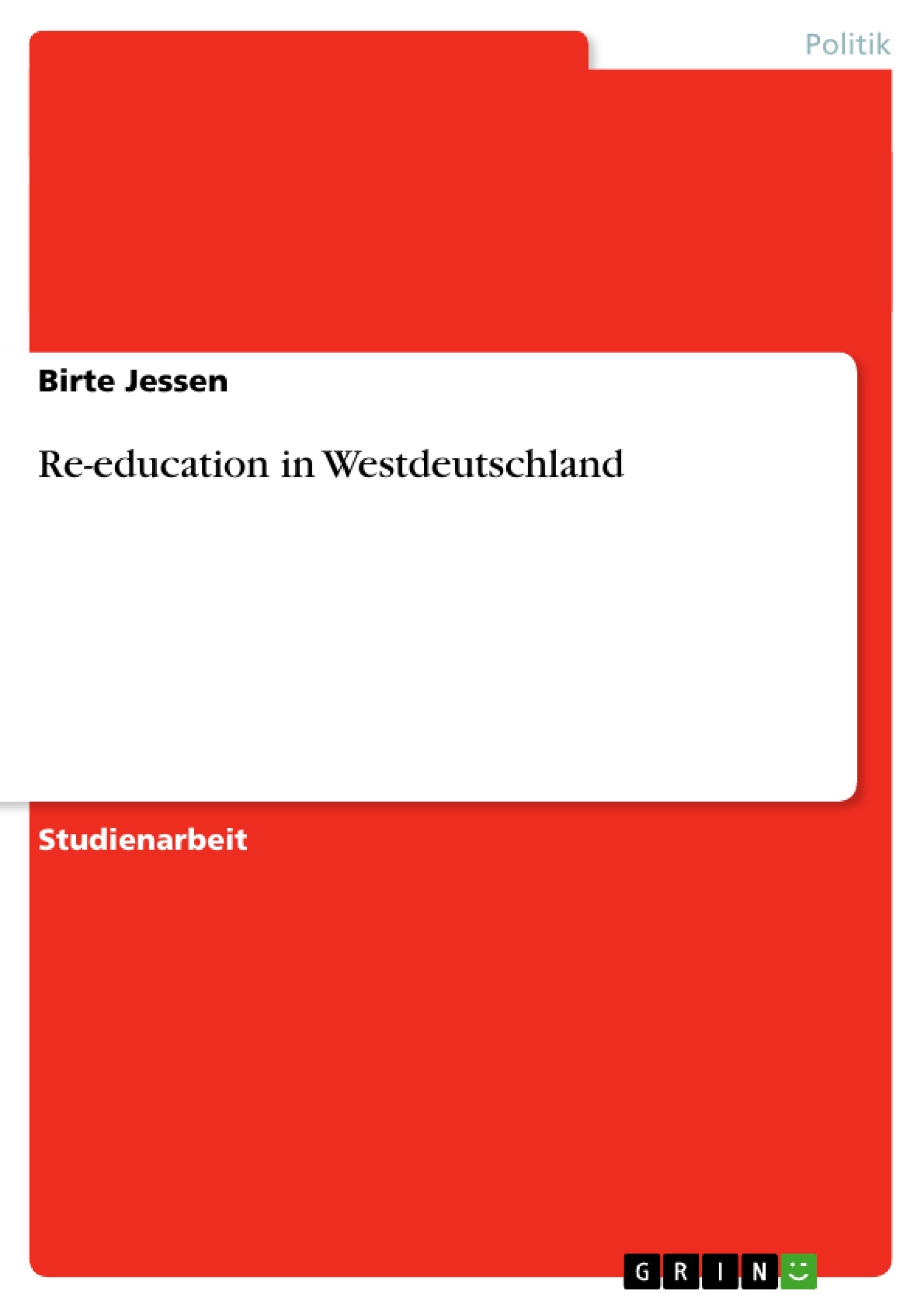Die Geschichte der politischen Bildung beginnt in Deutschland mit dem Zusammenbruch eines totalitären Systems. Mit dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft ging in Deutschland 1945 eine Besatzungspolitik einher, die eine Re-education anstrebte: die Deutschen sollten zur Demokratie umerzogen werden.
Die vorliegende Arbeit betrachtet zunächst die Ausgangssituation im besetzten Deutschland nach 1945. Die Erziehung und damit verbunden die Schule waren für die westlichen Alliierten der Hauptansatzpunkt, um aus der deutschen Bevölkerung eine demokratische zu machen. Daneben war die kulturelle Umerziehung durch beispielsweise Radio und Zeitungen wichtig. Bekannt geworden ist der von der amerikanischen Armeeführung angeordnete Besuch von Bürgern der Stadt Weimar im Konzentrationslager Buchenwald, ein Beispiel der Aufklärung durch Abschreckung. In dieser Arbeit soll jedoch der Fokus auf die Pläne der Alliierten bezüglich der Schule gelegt werden – wie sollte hier die Umerziehungspolitik aussehen, welche Vorstellungen hatten die westlichen Besatzungsmächte? Diese Frage soll im nächsten Abschnitt geklärt werden. Der Schwerpunkt wird auf dem amerikanischen Re-education-Programm liegen. Somit wird auch bei der Betrachtung der Wirkung des Umerziehungsprogramms, das heißt, der Resonanz bei den Deutschen sowie Erfolgen und Misserfolgen dieser Politik, vornehmlich auf den amerikanischen Einfluss eingegangen werden. Das Problem des Kulturtransfers wird im Nachkriegsdeutschland deutlich und in dieser Arbeit im Anschluss behandelt. Eine Schlussbetrachtung soll die Frage aufwerfen, wie aktuell solche Umerziehungsabsichten und die Debatten von damals, das heißt von vor ca. 60 Jahren, heute noch sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Besatzungspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
- 3. Die Umerziehungspolitik der Amerikaner
- 3.1 Das Re-education-Programm
- 3.2 „Learning by Dewey“
- 4. Die Umerziehungspolitik der Briten und Franzosen
- 5. Die Wirkung der Re-education-Politik
- 5.1 Die Resonanz bei den Deutschen
- 5.2 (Miss-)Erfolge der Re-education
- 6. Das Problem des Kulturtransfers
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umerziehungspolitik der Alliierten in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere deren Auswirkungen auf das Bildungssystem. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ziele und Methoden der Re-education, insbesondere des amerikanischen Programms. Die Arbeit beleuchtet die Kontroversen und Herausforderungen des Kulturtransfers in dieser Zeit.
- Die Besatzungspolitik der Alliierten nach 1945 und ihre Ziele
- Das amerikanische Re-education-Programm und seine Umsetzung
- Die Reaktionen der deutschen Bevölkerung auf die Umerziehungspolitik
- Der Erfolg und Misserfolg der Re-education-Bemühungen
- Das Problem des Kulturtransfers im Nachkriegsdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der politischen Bildung in Deutschland nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und der einsetzenden Besatzungspolitik der Alliierten. Sie hebt die Re-education als zentrales Ziel hervor und kündigt den Fokus der Arbeit auf die schulische Umerziehung und insbesondere das amerikanische Programm an. Die Einleitung betont die vergleichsweise geringe Rolle Frankreichs und Großbritanniens in diesem Kontext und deutet die zentrale Forschungsfrage nach den Plänen und Vorstellungen der westlichen Besatzungsmächte an. Der Ausblick auf die späteren Kapitel umfasst die Betrachtung der Wirkung der Re-education, des Problems des Kulturtransfers und die Aktualität der damaligen Debatten.
2. Die Besatzungspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: Dieses Kapitel beschreibt die politische Situation in Deutschland nach der bedingungslosen Kapitulation 1945. Es erläutert die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen und die Ziele der Potsdamer Konferenz, insbesondere Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentralisierung, Demontage und Demokratisierung. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Bildungswesens als zentrales Element der Demokratisierung und der gemeinsamen Auffassung der westlichen Alliierten, den Nationalsozialismus als Charakterzug der Deutschen und eine Gefahr für den Weltfrieden zu betrachten. Das Kapitel verdeutlicht, dass die Umerziehung als notwendig erachtet wurde, um die „heranwachsende Generation gegenüber der Verführung durch den Nationalsozialismus immun“ zu machen.
3. Die Umerziehungspolitik der Amerikaner: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die amerikanische Umerziehungspolitik mit ihrem Schwerpunkt auf der Demokratisierung des Bildungswesens. Es wird das amerikanische Re-education-Programm im Detail beleuchtet, welches die Umgestaltung des dreigliedrigen deutschen Schulsystems anstrebte. Die Bedeutung von "Learning by Dewey" und die Herausforderungen bei der Umsetzung werden hier erörtert. Die Kapitel beschreibt die amerikanische Perspektive auf den Nationalsozialismus und dessen Ursachen und unterstreicht die unterschiedlichen Ansätze der verschiedenen Besatzungsmächte bezüglich der Umerziehung.
Schlüsselwörter
Re-education, Besatzungspolitik, Westdeutschland, Nachkriegsdeutschland, Demokratisierung, Bildungswesen, Umerziehung, Amerikanisierung, Kulturtransfer, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umerziehung in Westdeutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Umerziehungspolitik der Alliierten in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere deren Auswirkungen auf das Bildungssystem. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ziele und Methoden der Re-education, besonders des amerikanischen Programms, sowie der Kontroversen und Herausforderungen des Kulturtransfers.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Besatzungspolitik der Alliierten nach 1945 und deren Ziele, das amerikanische Re-education-Programm und dessen Umsetzung, die Reaktionen der deutschen Bevölkerung, den Erfolg und Misserfolg der Umerziehungsbemühungen und das Problem des Kulturtransfers im Nachkriegsdeutschland. Sie beleuchtet auch die Unterschiede in den Ansätzen der Amerikaner, Briten und Franzosen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den historischen Kontext und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 beschreibt die allgemeine Besatzungspolitik nach 1945. Kapitel 3 fokussiert sich auf die amerikanische Umerziehungspolitik und das Re-education-Programm, inklusive "Learning by Dewey". Kapitel 4 behandelt die Umerziehungspolitik der Briten und Franzosen. Kapitel 5 analysiert die Wirkung und den Erfolg/Misserfolg der Re-education. Kapitel 6 diskutiert das Problem des Kulturtransfers. Kapitel 7 (Schlussbetrachtung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielte das amerikanische Re-education-Programm?
Das amerikanische Re-education-Programm bildete einen zentralen Schwerpunkt der Arbeit. Es wird detailliert untersucht, wie die Amerikaner versuchten, das deutsche Bildungssystem zu demokratisieren und die "heranwachsende Generation gegenüber der Verführung durch den Nationalsozialismus immun" zu machen. Die Herausforderungen bei der Umsetzung und die Bedeutung von "Learning by Dewey" werden ebenfalls erörtert.
Wie reagierte die deutsche Bevölkerung auf die Umerziehung?
Die Arbeit untersucht die Resonanz der deutschen Bevölkerung auf die Umerziehungspolitik. Es wird analysiert, inwieweit die Maßnahmen erfolgreich waren und welche Schwierigkeiten und Widerstände es gab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Re-education, Besatzungspolitik, Westdeutschland, Nachkriegsdeutschland, Demokratisierung, Bildungswesen, Umerziehung, Amerikanisierung, Kulturtransfer, Nationalsozialismus.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Umerziehungspolitik der Alliierten in Westdeutschland umfassend zu analysieren, ihre Methoden und Ziele zu beleuchten und deren Auswirkungen auf das deutsche Bildungssystem und die Gesellschaft zu bewerten. Der Fokus liegt dabei auf dem Vergleich der verschiedenen Ansätze der Alliierten und der Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema des Kulturtransfers.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit ist strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und abschließenden Schlüsselbegriffen. Dieser Aufbau ermöglicht einen schnellen Überblick über den Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse.
- Arbeit zitieren
- Birte Jessen (Autor:in), 2008, Re-education in Westdeutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180665