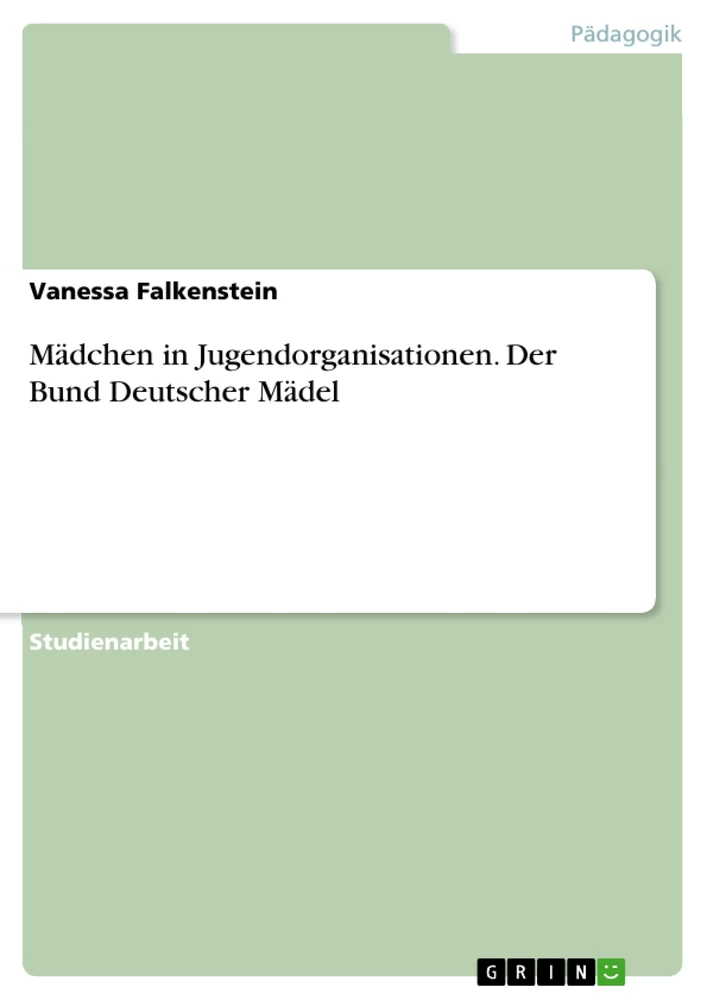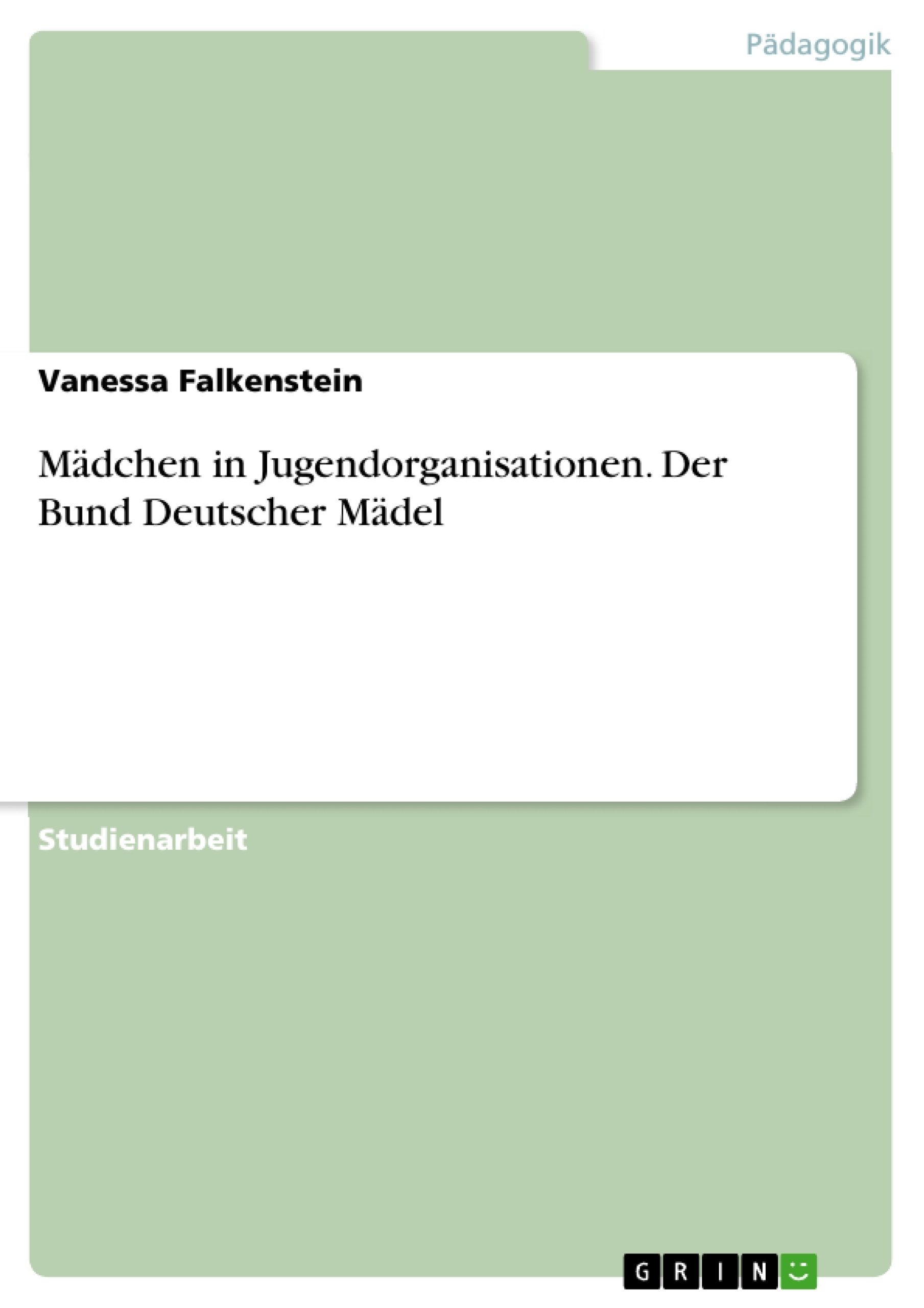Ein Großteil der deutschen Mädchen zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft war Mitglied im Bund Deutscher Mädel (BDM). Durch Freiwilligkeit oder Zwang, durch Gesetze und Institutionen erfuhr der weibliche Teil der Hitler-Jugend einen starken Zulauf der jungen Frauen. Der BDM galt während der Jahre 1933-1945 neben dem Elternhaus und der Schule als dritter Erziehungsfaktor.
Heute wird häufig von jungen Menschen die Frage: „Wie war das damals möglich?“ an die älteren Generationen und insbesondere an Zeitzeugen gestellt. Auf diese Frage, welche Bestandteil einiger wissenschaftlicher Diskussionen und Arbeiten ist, ist derzeitig noch keine umfassende, allgemein gültige Antwort gegeben worden (vgl. Klaus 1983, S. 12).
Bei der Beschäftigung mit der Thematik des Bundes Deutscher Mädel müssen verschiedene Quellen und Sichtweisen Berücksichtigung finden.
Deshalb hat es sich diese Arbeit zur Aufgabe gemacht, den BDM nicht mithilfe von Archivalien sondern auch aus subjektiver Perspektive zu beleuchten. Da seit Ende des zweiten Weltkrieges circa 65 Jahre vergangen sind, ist es heute zwar schwierig, aber dennoch möglich Informationen von Zeitzeugen zu ihren damaligen Erfahrungen und Erlebnissen zu erhalten. Diese Quellen müssen, so lange dies noch durchführbar ist, bei der Betrachtung des Bund Deutscher Mädel zwingend einbezogen werden.
Dazu ist die Arbeit in fünf inhaltliche Kapitel gegliedert. Angefangen bei einer kurzen Einleitung in das Thema, beschäftigt sich die Arbeit im zweiten Kapitel mit der Entstehung des BDM sowie dem Alltag du der Erziehung in der Organisation. Als Grundlage dafür dienen zum Großteil Geschichtsbücher sowie historische Daten und Fakten.
Da eine umfassende Quellenarbeit für die historische Bildungsforschung elementar ist, beschreibt das dritte Kapitel im Hinblick auf die subjektiven Erlebnisse des nachfolgenden Kapitels, den Umgang, die Analyse und Einordnung von Quellen.
Im vierten Kapitel wird der Umgang mit den Quellen anhand von drei ausgewählten Werken verdeutlicht. Hier stehen besonders die Darstellung und Schilderung von persönlichen Geschichten und Erfahrungen von Mädchen im BDM im Vordergrund.
Im letzten Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Bund Deutscher Mädel
- 2.1 Entstehung und Geschichte des BDM
- 2.2 Alltag im BDM
- 2.3 Erziehung im BDM
- 3. Zum Umgang mit Quellen
- 3.1 Charakterisierung und Interpretation von Quellen
- 3.2 Tagebucheinträge
- 3.3 Zeitzeugenberichte
- 4. Subjektives Erleben
- 4.1 Lebenslüge Hitler-Jugend
- 4.2 Die Zeit der großen Täuschungen
- 4.3 „Man war bestätigt und man konnte was“
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Bund Deutscher Mädel (BDM) im Nationalsozialismus, indem sie sowohl historische Daten als auch subjektive Erlebnisse ehemaliger Mitglieder berücksichtigt. Ziel ist es, ein umfassenderes Bild des BDM zu zeichnen und die Frage nach der damaligen Beteiligung von Mädchen zu beleuchten. Die Arbeit vermeidet eine rein archivarische Betrachtung und integriert die Perspektive von Zeitzeuginnen.
- Entstehung und Entwicklung des BDM
- Alltag und Erziehung im BDM
- Analyse und Interpretation verschiedener Quellen (geschichtliche Dokumente und subjektive Berichte)
- Subjektive Erlebnisse von Mädchen im BDM
- Die Rolle des BDM im nationalsozialistischen Erziehungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Bundes Deutscher Mädel (BDM) ein und stellt die Forschungsfrage nach der Beteiligung deutscher Mädchen im Nationalsozialismus. Sie hebt die Notwendigkeit der Einbeziehung subjektiver Perspektiven neben historischen Daten hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Der Bund Deutscher Mädel: Dieses Kapitel behandelt die Organisation des BDM, seine Entstehung und Entwicklung, den Alltag der Mitglieder und die Erziehungsziele der Organisation. Es werden historische Fakten und Daten verwendet, um den Kontext und die Struktur des BDM zu beleuchten. Die Entstehung aus kleineren, nationalsozialistischen Mädchengruppen wird nachvollzogen, ebenso wie die spätere Eingliederung in die Hitlerjugend und die letztendliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft. Der Fokus liegt auf der offiziellen Struktur und den Zielen des BDM.
3. Zum Umgang mit Quellen: Dieses Kapitel widmet sich der Methodik der Arbeit, insbesondere dem Umgang mit unterschiedlichen Quellen. Es beschreibt die Herausforderungen und Besonderheiten der Quellenanalyse im Kontext der subjektiven Erlebnisse von Zeitzeuginnen, die im folgenden Kapitel behandelt werden. Die Bedeutung einer kritischen Auseinandersetzung mit den Quellen und ihrer Interpretation wird hervorgehoben.
4. Subjektives Erleben: Dieses Kapitel präsentiert ausgewählte, subjektive Erlebnisse von Mädchen im BDM. Anhand von drei Beispielen werden persönliche Geschichten und Erfahrungen dargestellt, um ein differenziertes Bild des Lebens im BDM zu zeichnen. Die Kapitel analysieren die Bedeutung von persönlichen Erzählungen für das Verständnis der Geschichte.
Schlüsselwörter
Bund Deutscher Mädel (BDM), Nationalsozialismus, Mädchen, Jugendorganisation, Hitlerjugend, Erziehung, Zeitzeugenberichte, Quellenanalyse, subjektive Erfahrung, Gleichschaltung, nationalsozialistische Ideologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text über den Bund Deutscher Mädel (BDM)
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Bund Deutscher Mädel (BDM) im Nationalsozialismus. Er kombiniert historische Fakten mit den subjektiven Erlebnissen ehemaliger Mitglieder, um ein differenziertes Bild dieser Jugendorganisation zu zeichnen. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entstehung und Entwicklung des BDM, der Alltag und die Erziehung innerhalb der Organisation, die Analyse und Interpretation verschiedener Quellen (historische Dokumente und subjektive Berichte), die subjektiven Erlebnisse von Mädchen im BDM und die Rolle des BDM im nationalsozialistischen Erziehungssystem. Der Text beleuchtet auch die Herausforderungen der Quellenanalyse, insbesondere im Umgang mit subjektiven Erzählungen von Zeitzeuginnen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über den BDM (Entstehung, Alltag, Erziehung), ein Kapitel zur Quellenanalyse-Methodik, ein Kapitel mit subjektiven Erlebnisberichten ehemaliger BDM-Mitglieder und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Quellen werden verwendet?
Der Text verwendet sowohl historische Dokumente und Daten, um den Kontext und die Struktur des BDM zu beleuchten, als auch subjektive Erlebnisberichte ehemaliger Mitglieder. Der Umgang mit diesen unterschiedlichen Quellen und deren Interpretation wird explizit thematisiert.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist es, ein umfassendes und differenziertes Bild des BDM zu zeichnen, indem sowohl objektive historische Daten als auch subjektive Perspektiven ehemaliger Mitglieder berücksichtigt werden. Es geht darum, die Beteiligung deutscher Mädchen im Nationalsozialismus besser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Bund Deutscher Mädel (BDM), Nationalsozialismus, Mädchen, Jugendorganisation, Hitlerjugend, Erziehung, Zeitzeugenberichte, Quellenanalyse, subjektive Erfahrung, Gleichschaltung, nationalsozialistische Ideologie.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text eignet sich für akademische Zwecke, z.B. für die Analyse von Themen im Nationalsozialismus. Die strukturierte Aufbereitung und die Kombination von historischen Daten und subjektiven Berichten machen ihn für wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen wertvoll.
Wo finde ich weitere Informationen zum BDM?
Weitere Informationen zum BDM finden Sie in wissenschaftlicher Literatur zum Nationalsozialismus und in Archiven, die Dokumente und Berichte über den BDM aufbewahren. Die im Text behandelte Quellenanalyse bietet einen guten Ansatzpunkt für weiterführende Recherchen.
- Quote paper
- Vanessa Falkenstein (Author), 2010, Mädchen in Jugendorganisationen. Der Bund Deutscher Mädel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180570