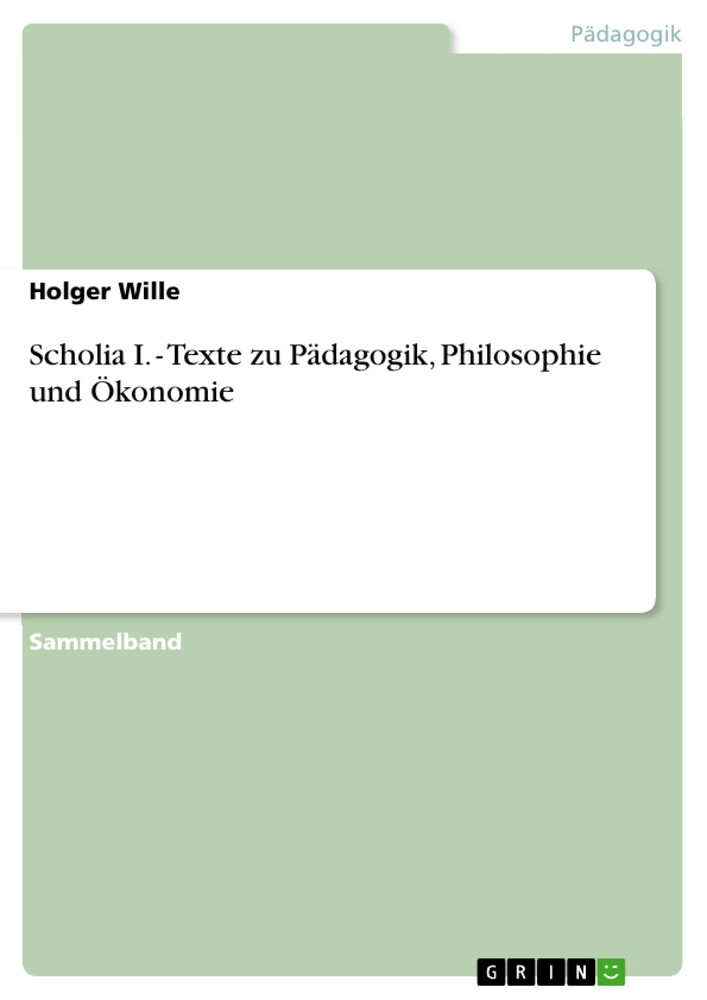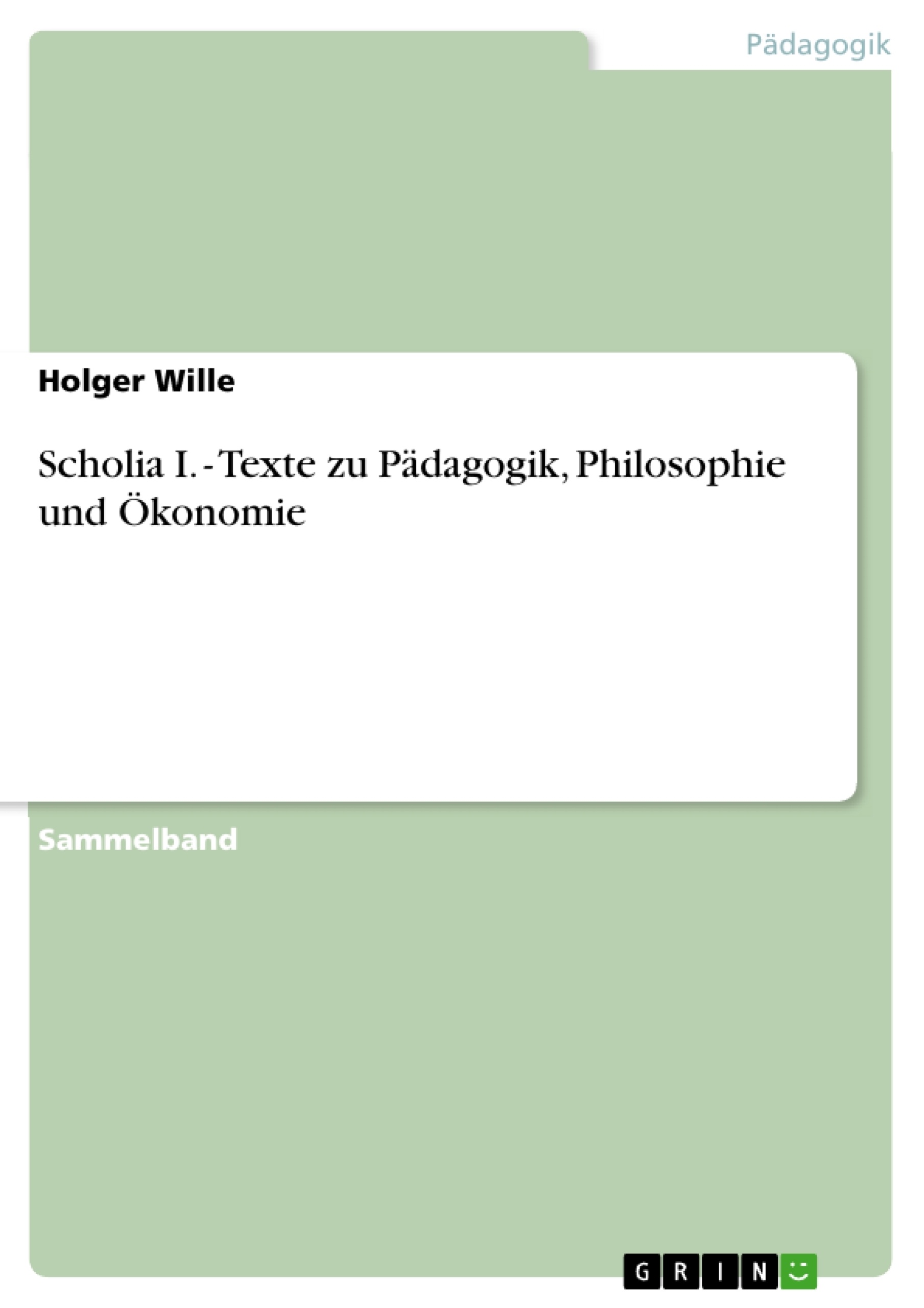Luxus beginnt nicht erst, wenn man sich etwas gönnt. Er beginnt nicht erst, wenn man sich ein neues Auto leistet, statt mit dem gleichen Geld wenigstens einen der weltweit rund 850 Millionen Menschen zu retten, die an Unterernährung leiden. Luxus beginnt früher. Grob geschätzt etwa 14 Milliarden Jahre früher. Luxus beginnt mit einem ungefähr 100.00 Millionen Grad heißen Ereignis, das schließlich das hervorgebracht hat, was man gemeinhin Raum, Zeit, und Materie nennt. Man bezeichnet dieses Ereignis in Ermangelung besserer Euphemismen zumeist als Urknall. Ein wahrlich historisches Ereignis. So historisch, dass man sich wundern kann, wieso es eigentlich stattgefunden hat. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Auf diese Frage des Philosophen Leibniz wissen wir zum Glück mittlerweile die Antwort. Sie lautet schlicht: Darum! Diese Replik ist kein müder Scherz, sondern die einzige ernsthafte Erwiderung, die man geben kann. Denn wo nichts ist, da kann auch keiner nach etwas fragen. Sein überhaupt ist die unhinterfragbare Voraussetzung allen Fragens. Zu philosophisch? Leider nein. Es ist lediglich das grundlegendste Argument, das man zur Verteidigung des Überflüssigen anführen kann. Das Sein, sowie das Leben selbst, sind ein Luxus, den sich die Wirklichkeit irgendwann einmal geleistet hat. Nötig waren beide nie. Die Realität braucht uns ebenso wenig wie sich selbst. Gäbe es keinen Luxus, gäbe es überhaupt nichts. Die Welt und wir, wir müssten eigentlich nicht sein. Doch wenn das Malheur nun schon einmal passiert ist, kann man es auch nicht mehr gut ignorieren. Wechseln wir also von der physikalischen zur menschlichen Geschichte.
Inhaltsverzeichnis
- Luxus ist kein Luxus
- Eine amoralische Apologie des Verschwenderischen
- Damit ist über das Nichts alles gesagt
- Luxus beginnt nicht erst, wenn man sich etwas gönnt. Er beginnt nicht erst, wenn man sich ein neues Auto leistet, statt mit dem gleichen Geld wenigstens einen der weltweit rund 850 Millionen Menschen zu retten, die an Unterernährung leiden. Luxus beginnt früher. Grob geschätzt etwa 14 Milliarden Jahre früher. Luxus beginnt mit einem ungefähr 100.00 Millionen Grad heißen Ereignis, das schließlich das hervorgebracht hat, was man gemeinhin Raum, Zeit, und Materie nennt. Man bezeichnet dieses Ereignis in Ermangelung besserer Euphemismen zumeist als Urknall. Ein wahrlich historisches Ereignis. So historisch, dass man sich wundern kann, wieso es eigentlich stattgefunden hat. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Auf diese Frage des Philosophen Leibniz wissen wir zum Glück mittlerweile die Antwort. Sie lautet schlicht: Darum!
- Diese Replik ist kein müder Scherz, sondern die einzige ernsthafte Erwiderung, die man geben kann. Denn wo nichts ist, da kann auch keiner nach etwas fragen. Sein überhaupt ist die unhinterfragbare Voraussetzung allen Fragens. Zu philosophisch? Leider nein. Es ist lediglich das grundlegendste Argument, das man zur Verteidigung des Überflüssigen anführen kann. Das Sein, sowie das Leben selbst, sind ein Luxus, den sich die Wirklichkeit irgendwann einmal geleistet hat. Nötig waren beide nie. Die Realität braucht uns ebenso wenig wie sich selbst. Gäbe es keinen Luxus, gäbe es überhaupt nichts. Die Welt und wir, wir müssten eigentlich nicht sein. Doch wenn das Malheur nun schon einmal passiert ist, kann man es auch nicht mehr gut ignorieren. Wechseln wir also von der physikalischen zur menschlichen Geschichte.
- Luxus ist erst 300 Jahre alt
- Es klingt paradox, aber von Luxus kann man erst seit seiner Abschaffung zu Beginn des 18. Jahrhunderts sprechen. Angesichts von rund 12.000 Jahren Zivilisationsgeschichte ist das eine erstaunlich kurze Zeit. Und was gab es vorher? Was ist etwa mit den Sumptuargesetzen (lat. sumptus Aufwand, Kosten, Luxus), die fast schon so alt sind wie die politischen Gesellschaften selbst? Was ist mit den vielen moralischen Verurteilungen, die die Antike gegen eine ausschweifende Lebensführung ausgesprochen hat? Was ist mit der „luxuria“, die seit Ende des 6. Jahrhunderts zum Kanon der sieben Todsünden gehört? Was ist mit den mittelalterlichen Vorschriften, die das Tragen von Samt und Seide, von Gold- und Silberstoffen verboten bzw. nur bestimmten Adelsklassen erlaubten? Ist das alles nichts? Richtig! Denn was tatsächlich erst Anfang des 18. Jahrhunderts einsetzt ist die Verwandlung des „homo oeconomicus“ in den „homo supervacanea petens et eorum indigens“. Der Mensch wird als ein Wesen (an)erkannt, das Überflüssiges ebenso erstrebt wie dessen auch bedarf.
- Der Tod des homo oeconomicus
- Dass dieser Gedanke eine so lange Inkubationszeit benötigt hat, liegt an einer Tradition, die eine begriffliche Unterscheidung zu einer Scheinalternative aufgebläht hat. Seit den Zeiten des Sokrates differenzierte man zwischen dem bloßen Leben und dem guten Leben. Das Fatale dieser Unterscheidung war, dass man sie historisch durchweg als eine zweistufige Entwicklung interpretiert hat. Erst kommt das Überleben, dann das gute Leben. Aristoteles hat dieses Zweistufenmodell deutlich formuliert. Es gibt die sklavischen, banausischen Tätigkeiten, die das Lebensnotwendige zur Verfügung stellen, und es gibt die freien Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen stattfinden. Die höheren Tätigkeiten können erst einsetzen, wenn man für die Erledigung der niedrigen Tätigkeiten gesorgt hat. Zu einem Gutteil denken wir noch heute so. (Beispiel: Maslowsche Bedürfnispyramide) Es verwundert deshalb auch nicht, dass man immer wieder gerne auf das vermeintliche Vorbild der Naturvölker zurückgreift, um den maßlosen Reichtum moderner Ökonomien zu hinterfragen. Archaischen Gesellschaften wird vorschnell eine Beschränkung auf das wirklich Elementare, Ursprüngliche, Unverfälschte unterstellt, die sich leicht gegen die gekünstelten Bedürfnisse und die Verschwendungssucht heutiger Zivilisationen ausspielen lässt. Doch leider macht man mit guten Absichten oft schlechte Wirtschaftsanthropologie. Die Alternative von Notwendigkeit und Überflüssigkeit funktioniert ebenso wenig bei alten Stammeskulturen wie bei uns. Die Ethnologie zeigt uns den Wilden nämlich nicht als jemanden, der einsichtsvoll-asketisch im „Einklang“ mit seiner inneren und äußeren Natur lebt. Oft genug wählt er beispielsweise den zum Häuptling, der am meisten von allen Mitgliedern des Stammes essen kann. Der Vielfraß, der Fresssack, war nicht selten der, dessen nie gestillter Appetit auch die symbolische Gewähr dafür sein sollte, dass auch die anderen nie lange würden Hunger leiden müssen – auch, wenn sie für diese Gewähr selbst hungerten. Seine Völlerei war für sie lebenswichtig. Sie verließen sich auf seinen bis zum Bersten gefüllten Bauch, als hätte er ihn für sie alle mitgefüllt. Oder der so genannte „Potlatsch“ der nordamerikanischen Indianer: Hier steigerte sich die Möglichkeit der Verschwendung bis hin zu rituell festgesetzten Orgien der Zerstörung. Der Potlatsch bestand aus einer großen, festlichen Zusammenkunft der ganzen Gemeinschaft, die in Zerstörungs-Wettbewerben der Häuptlinge untereinander gipfelte. Jeder Häuptling prahlte damit, wie viel von seinem Besitz er zu zerstören bereit war. Wer wirklich am meisten zerstören ließ, war Sieger und genoss von allen den größten Ruhm. Und nur, wer möglichst viel hatte, konnte auch möglichst viel aufgeben. Oder schließlich der merkwürdige Suizid ganzer Völkerschaften: Wie wäre es etwa mit dem Volk der Xosa, das Mitte des 19. Jahrhunderts lediglich auf Geheiß der Geister verstorbener Angehöriger nahezu seine gesamten Lebensmittelvorräte bereitwillig vernichtete und so 68.000 Menschen sehenden Auges dem Hungertod aussetzte? Wo ist hier das Ausleben „eigentlicher“ Bedürfnisse? Wo ist der Einklang mit einer kulturfreien Natur, wenn schon ein bisschen Ahnenkult ausreicht, um sich den Luxus zu leisten, sogar auf das Unverzichtbare zu verzichten? Die Rede von einer natürlichen Bedürftigkeit ist nur der künstliche Versuch des Menschen ein Tier zu sein.
- Das Märchen von den primären Bedürfnissen
- Das Problem ist nicht, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Das Problem ist, dass die Dinge nicht nur das sind, was sie sind. Produktion und Konsum weisen von Anfang an über sich hinaus. Sie haben einen unfreiwilligen Überschuss. Kein Bedürfnis ist rein materiell, keine Erfindung bloß zweckdienlich, und es gibt keine Tätigkeit, die nur reproduktive Arbeit wäre. Unser ökonomisches Handeln ist nie ohne einen nicht-ökonomischen Kontext zu haben. Moralisch mag man dem Luxus im konkreten Einzelfall vorwerfen, was man will, wissenschaftlich gesehen ist die Überdeterminiertheit der Dinge unvermeidlich. Ein reiner Funktionalismus funktioniert nicht. Produktion und Konsumtion sind zwar allgemeine Begriffe, doch produktives und konsumtives Verhalten kann immer nur im Konkreten stattfinden. Jede konkrete Aneignung der materiellen Welt aber ist immateriell vorbelastet. Versuchen Sie mal, eines Ihrer vielbeschworenen Primärbedürfnisse (Nahrung, Atmung, Schlaf, Kleidung, Sex) zu befriedigen, ohne sich mit irgendeiner Form von Symbolik zu infizieren! Noch nicht einmal völlig negieren kann man diese Bedürfnisse, ohne sich in einen Zusammenhang sozialer Zeichen zu stellen, etwa den, der den Unterschied zwischen einem Begräbnis für Reiche und einem Begräbnis für Arme markiert. Dass sich das Märchen von der einfachen und authentischen Lebensweise nach wie vor so hartnäckig hält, hat unter anderem mit der Suggestionskraft mancher Erfindungen zu tun. Es gibt Gegenstände, deren Funktionsweise sich anscheinend nicht weiter perfektionieren lässt: Das Trinkglas, das Rad, der Löffel, der Hammer, die Büroklammer, das Buch oder die Zitronenpresse. Als Philippe Starck die Form der Zitronenpresse ändern wollte, entstand zwar ein wunderschönes minimalistisches Objekt. Dessen übersteigerte Simplizität war jedoch ein Pseudo-Funktionalismus. Seine drei Beine machten es wackelig, und es ließ die Kerne ins darunter stehende Glas fallen, wohingegen die klassische Zitronenpresse die Kerne mit dem Fruchtfleisch zurückhält.© www.zeitgeist.yopi.de/desgin/219/philippe-starck-design-ist-absolut-nutzlos Solche klassischen Designs sind es, die uns glauben machen, man könne sich in einem Raum purer, nicht mehr reduzierbarer Zweckerfüllung bewegen. Firmen wie Manufactum leben von der Faszination dieses Glaubens. Doch hat gerade die vermeintliche Rückkehr zur reinen Form ihren Preis. Die handbetriebene Brotschneidemaschine verzichtet zwar auf Schnick-Schnack, ist aber weitaus teurer als ihr überfrachtetes Pendant aus dem Elektromarkt. Genauso spielt die manuelle Getreidemühle den Hunger nach Naturverbundenheit gegen den Hunger aus, der sich einstellt, wenn man nach einem 10-Stunden-Tag auch noch Zeit haben muss, das eigene Brot zu backen. Das Unprätentiöse muss man sich erst einmal leisten können. Das ist keine verkehrte Welt, sondern die Welt, in der wir leben. Es ist die Welt, in der es ein Luxus ist, kein Handy zu besitzen, weil man es nicht nötig hat, immer erreichbar zu sein. Es ist die Welt, die man wirklich nicht aushält, wenn man morgens nicht mindestens seinen obligatorischen Latte-Macchiato-Einlauf bekommen hat.
- Luxus ist alles. Und nichts?
- Wer in Daniel Defoes Roman liest, wie sich Robinson Crusoe auf seiner Insel einzurichten beginnt, ist erstaunt, wie unökonomisch der Gestrandete oft mit seinen Kräften haushaltet. Was Robinson Crusoe am meisten vermisst und als erstes wirklich herstellt sind ein Stuhl und ein Tisch, um bequemer schreiben und essen zu können. Er will wenigstens das genießen, was ihm neben seinem blanken Leben noch geblieben ist. Der Roman ist in den Jahren 1719/1720 erschienen, also genau in der Zeit, in der die Diskussion um den Luxus gerade begonnen hatte, sich von ihrer Vereinnahmung durch die Ethik zu lösen. Die Emanzipation des Überflüssigen bediente sich hierbei
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Bedeutung von Luxus in der Geschichte und in der Gegenwart. Er stellt die Frage, ob Luxus tatsächlich etwas Überflüssiges ist oder ob er eine wichtige Rolle in unserer Kultur und Gesellschaft spielt. Der Text argumentiert, dass Luxus nicht nur etwas für die Reichen ist, sondern dass er auch einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Verständnis von Bedürfnissen und unserem Verhältnis zur Natur hat.
- Die historische Entwicklung des Luxusbegriffs
- Die philosophischen und ethischen Dimensionen des Luxus
- Die Rolle von Luxus in der modernen Konsumgesellschaft
- Der Einfluss von Luxus auf unsere Bedürfnisse und unser Verhältnis zur Natur
- Die Bedeutung von Überfluss und Verschwendung in unserer Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt den Leser in die amoralische Apologie des Verschwenderischen ein. Es stellt die Frage, ob Luxus tatsächlich etwas Überflüssiges ist oder ob er eine wichtige Rolle in unserer Kultur und Gesellschaft spielt.
- Im zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung des Luxusbegriffs beleuchtet. Der Autor argumentiert, dass Luxus erst mit der Abschaffung des homo oeconomicus im 18. Jahrhundert als Konzept entstand.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Tod des homo oeconomicus. Der Autor kritisiert die traditionelle Unterscheidung zwischen dem bloßen Leben und dem guten Leben, die zu einer falschen Dichotomie zwischen Notwendigkeit und Überflüssigkeit führt.
- Im vierten Kapitel wird das Märchen von den primären Bedürfnissen entlarvt. Der Autor argumentiert, dass es keine reinen materiellen Bedürfnisse gibt und dass unser ökonomisches Handeln immer einen nicht-ökonomischen Kontext hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Luxus, Verschwendung, Überfluss, Bedürfnisse, Konsum, Geschichte, Philosophie, Ethik, Ökonomie, Natur, Kultur und Gesellschaft. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Luxus ein negatives oder positives Phänomen ist und welche Auswirkungen er auf unsere Kultur und unser Leben hat.
- Quote paper
- Dr. Holger Wille (Author), 2011, Scholia I. - Texte zu Pädagogik, Philosophie und Ökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180555