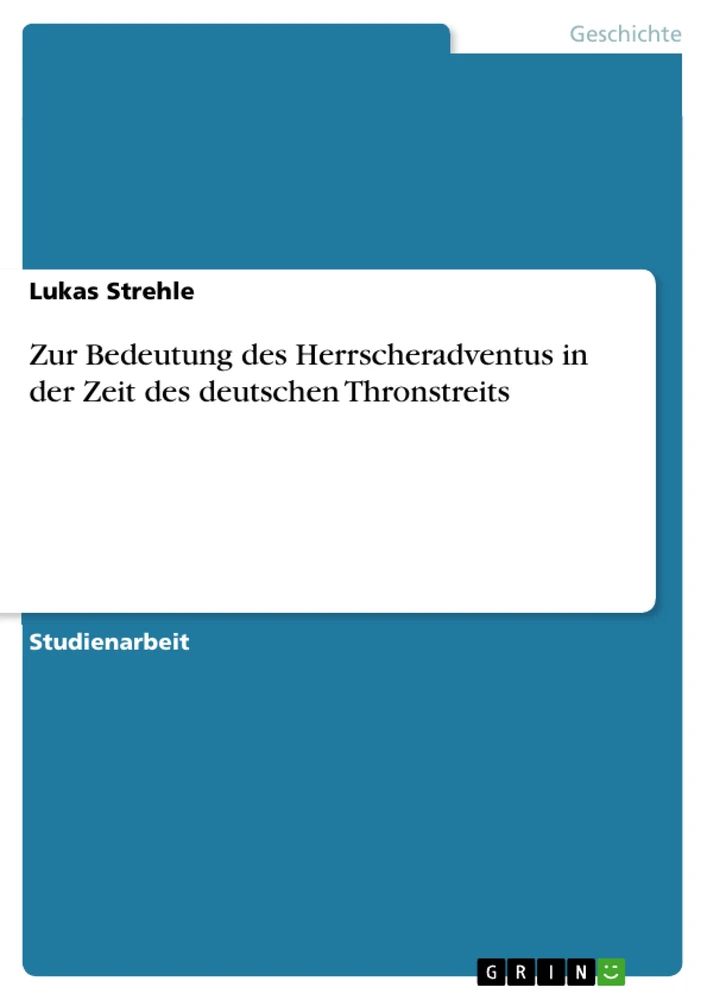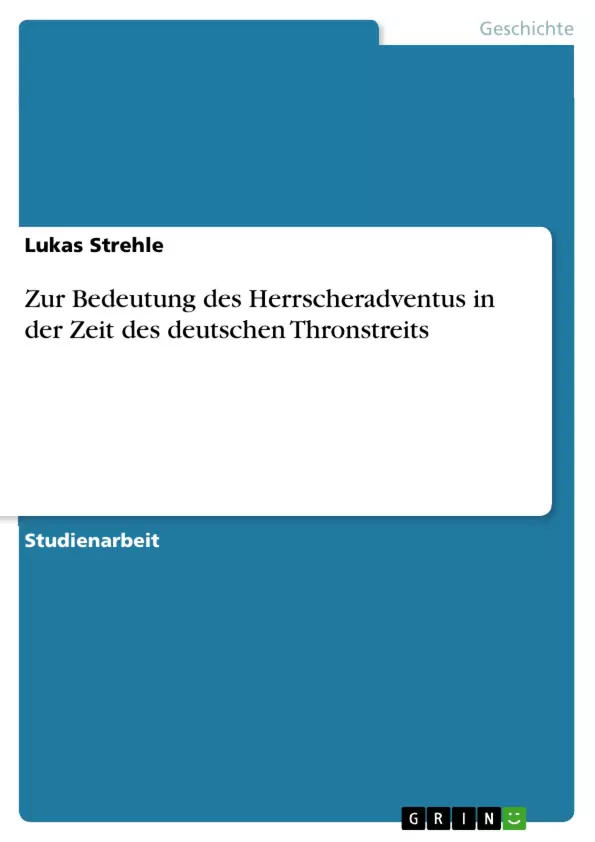Besonders für Zeiten umstrittener Herrschaft verdienen Formen der Inszenierung und der symbolischen Kommunikation die gesteigerte Aufmerksamkeit des Historikers, die aufgrund ihrer spezifischen Legitimationskraft zu einer gezielten Instrumentalisierung durch die Zeitgenossen geeignet waren.
Für die Zeit des deutschen Thronstreits von 1198 bis 1208 fand bislang neben der Frage der Rechtmäßigkeit der Königswahlen vor allem diejenige um die herrschaftslegitimierende Funktion der ‚echten’ Krönungsinsignien, des ‚korrekten’ Krönungsortes und des ‚richtigen’ Koronators Beachtung. Ein anderer Aspekt anerkannter Herrschaft blieb für diesen Zeitraum hingegen bisher weitestgehend unbeachtet. Es handelt sich dabei um die Bedeutung des adventus regis für die Stellung, Anerkennung und Inszenierung des Herrschers.
Das erscheint insofern verwunderlich, als dieser feierlich inszenierte Einritt des Regenten in eine Stadt zum Zweck seiner politischen und sakralen Überhöhung bereits in der Antike Bestandteil des Kaiserkults und, auch in Analogie zum in Mt. 21 geschilderten Einzug Jesu nach Jerusalem, seit Karl dem Großen festes Element in der Darstellung und Repräsentation der Königs- bzw. Kaiserwürde war. Im Zusammenhang mit der Praxis des Reisekönigtums gewann der adventus regis im frühen und hohen Mittelalter eine symbolbehaftete Bedeutung, deren nähere Untersuchung sich insbesondere für die Zeiten umstrittener Herrschaft lohnt.
Erschwert wird eine solche Untersuchung durch den relativen Quellenmangel. So sind uns viele der herrscherlichen Ankünfte nur in wenigen Worten überliefert, aus denen sich oft nicht mehr als die bloße Anwesenheit des Königs entnehmen lässt. Als umso interessanter und aufschlussreicher sollte man die Quellen einstufen, die tiefere Einblicke in die Bedingungen, das Zeremoniell und die Bedeutung des adventus ermöglichen. Für die Zeit des deutschen Thronstreits wurde dies bislang lediglich von Steffen Krieb ansatzweise unternommen, während für die Bedeutung des adventus im Spätmittelalter das Werk von Gerrit Jasper Schenk neue Maßstäbe setzte.
Die folgende Arbeit soll anhand einer eingehenden Analyse der beiden bestüberlieferten Herrscherankünfte aus der Zeit des Thronstreits, denjenigen Philipps in Straßburg 1199 und Köln 1207, sowie mithilfe eines zusammenfassenden Kapitels über Bemerkenswertes weiterer bekannter adventus der Zeit die Bedeutung dieses ritualisierten Zeremoniells für diese besondere Phase umkämpfter Herrschaft untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Bedeutung des adventus regis zwischen 1198 und 1208
- I. Straßburg 1199
- a) Die Situation im Elsass vor 1199
- b) Exkurs: Vermittler als Bestandteil mittelalterlicher Konfliktbeilegung
- c) Der adventus des Königs in Straßburg
- II. Köln 1207
- a) Der Konflikt mit Köln 1198 - 1207
- b) Exkurs: Das Einreißen der Mauern als Bestandteil des Kaiserrechts
- c) Der Friedensvertrag zwischen Philipp und Köln
- d) Der adventus in Köln – Einordnung in ein Idealschema
- e) Die Umsetzung des Friedensvertrages - Das Privileg König Philipps
- f) Die Bedeutung des adventus in Köln
- III. Weitere adventus zwischen 1198 und 1208 - Bemerkenswertes
- I. Straßburg 1199
- C. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des adventus regis, des feierlichen Einzugs eines Herrschers in eine Stadt, für die Zeit des deutschen Thronstreits von 1198 bis 1208. Im Fokus stehen die Herrscherankünfte Philipps von Schwaben in Straßburg 1199 und Köln 1207, wobei die Untersuchung den adventus regis in seiner Rolle als Instrument der politischen und sakralen Legitimationsbildung sowie der Herrschaftsinszenierung beleuchtet.
- Die Funktion des adventus regis als Instrument der Legitimation und Machtdemonstration
- Die Bedeutung des adventus regis im Kontext der Konfliktbeilegung und der Herrschaftsstabilisierung
- Der Vergleich der Herrscherankünfte in Straßburg 1199 und Köln 1207 im Hinblick auf ihre spezifischen Inhalte und Bedeutungen
- Der Einfluss des adventus regis auf die öffentliche Meinung und die Wahrnehmung des Herrschers
- Die Rolle des adventus regis im Vergleich mit anderen Formen der Herrschaftslegitimation in der Zeit des Thronstreits
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A: Einleitung
Diese Einleitung stellt die Thematik des adventus regis im Kontext des deutschen Thronstreits vor und beleuchtet die Forschungsgeschichte. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung des adventus regis für die Legitimierung und Inszenierung der Herrschermacht in einer Zeit politischer und sakraler Instabilität.
Kapitel B: Die Bedeutung des adventus regis zwischen 1198 und 1208
I. Straßburg 1199: Dieses Kapitel analysiert den adventus Philipps in Straßburg 1199 im Kontext der vorausgegangenen Fehde und der komplizierten Machtverhältnisse im Elsass. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Rolle des adventus regis in der Konfliktbeilegung und die Symbolkraft dieses ritualisierten Einzugs.
II. Köln 1207: Dieses Kapitel untersucht die Herrscherankunft Philipps in Köln 1207, wobei der Fokus auf dem Friedensvertrag, der vorangehenden Konfrontation mit der Stadt sowie der Bedeutung des adventus für die Herrschaftslegitimation liegt.
III. Weitere adventus zwischen 1198 und 1208: Dieses Kapitel beleuchtet weitere Beispiele von Herrscherankünften in der Zeit des Thronstreits, um ein umfassenderes Bild der Bedeutung und Funktionen des adventus regis in dieser Zeit zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem adventus regis, dem feierlichen Einzug eines Herrschers in eine Stadt, im Kontext des deutschen Thronstreits (1198-1208). Zentrale Begriffe und Konzepte der Arbeit sind Herrschaftslegitimation, politische Inszenierung, Konfliktbeilegung, sakrale Macht, Herrschaftsstabilisierung, Ritual, Symbol, und Reisenherrschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Herrscheradventus"?
Der adventus regis bezeichnet den feierlich inszenierten Einritt eines Regenten in eine Stadt, der zur politischen und sakralen Überhöhung des Herrschers dient.
Welcher Zeitraum wird in dieser Arbeit untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Zeit des deutschen Thronstreits zwischen 1198 und 1208.
Welche historischen Ereignisse dienen als Fallbeispiele?
Im Fokus stehen die Einzüge von Philipp von Schwaben in Straßburg (1199) und in Köln (1207).
Warum war der Adventus in Zeiten umstrittener Herrschaft so wichtig?
Er diente als Instrument der Legitimation, Machtdemonstration und symbolischen Kommunikation, um die Anerkennung des Herrschers zu festigen.
Welche Rolle spielte Köln im Jahr 1207?
Nach einem langen Konflikt markierte der Adventus in Köln den Friedensschluss und die Anerkennung Philipps durch die bedeutende Stadt.
- Quote paper
- Lukas Strehle (Author), 2008, Zur Bedeutung des Herrscheradventus in der Zeit des deutschen Thronstreits, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180487