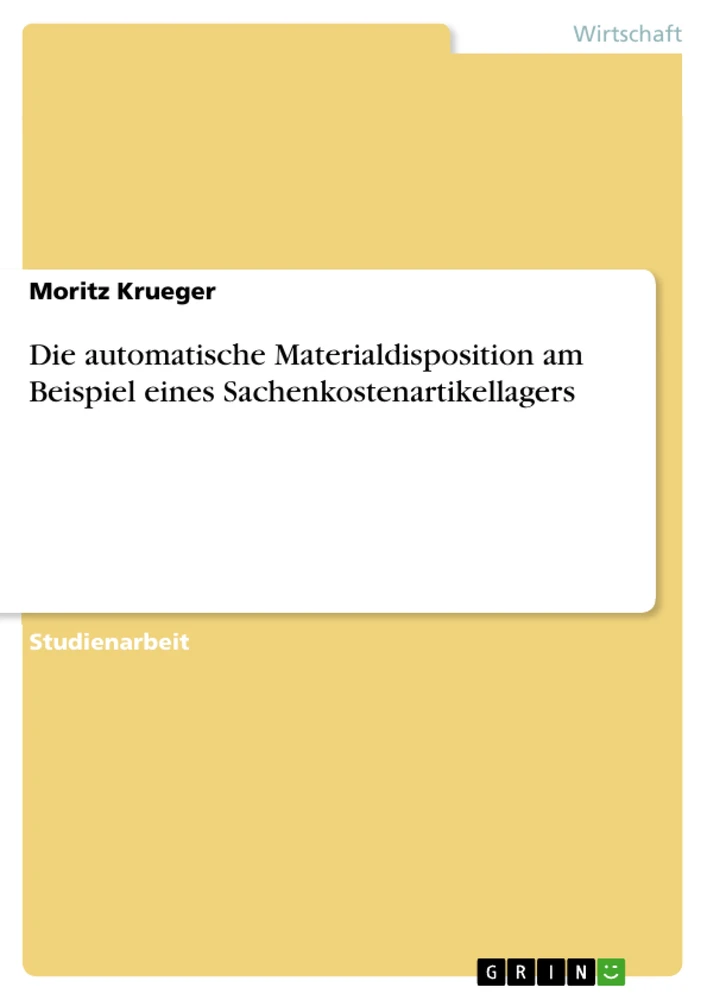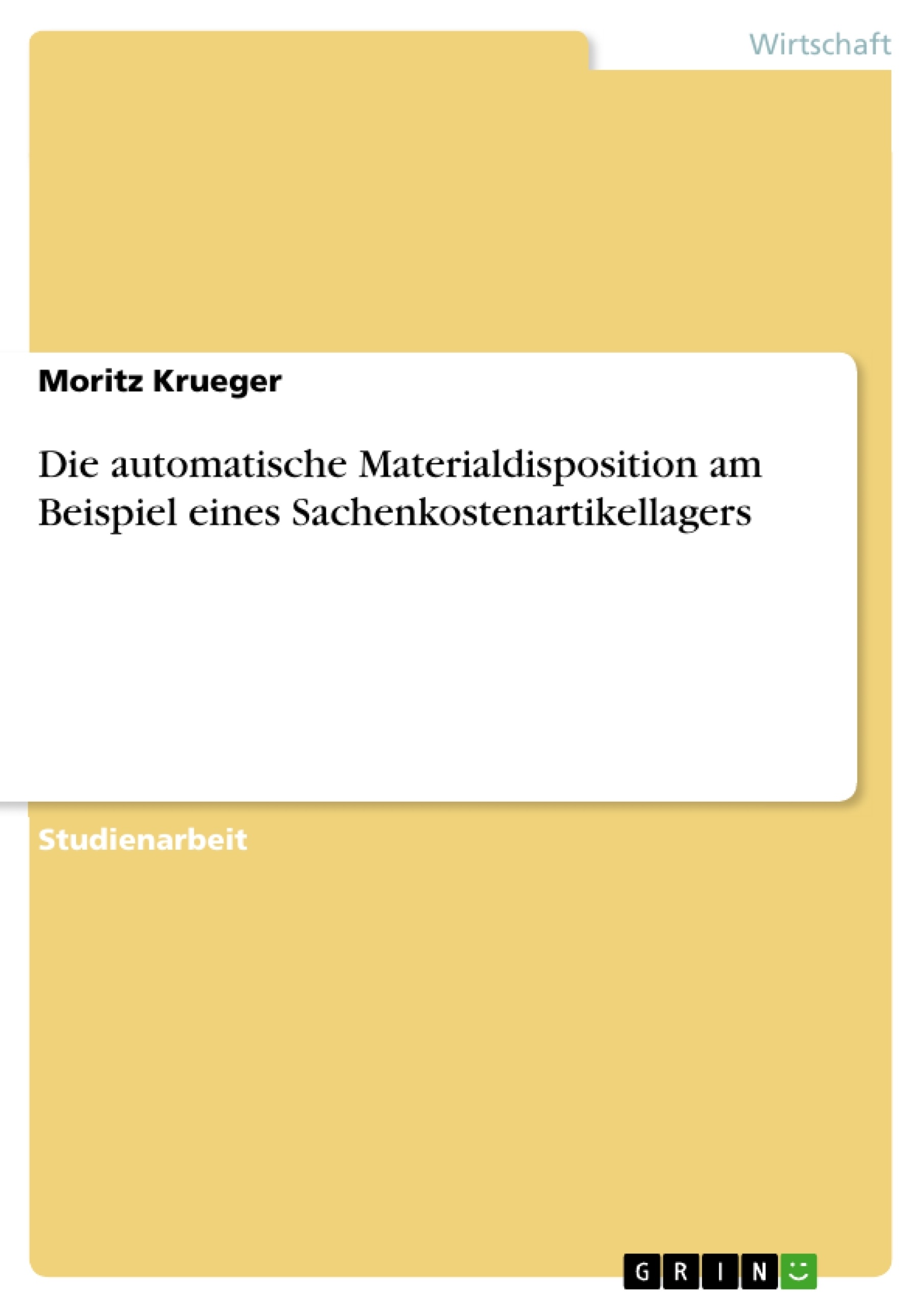„Nobody’s perfect“
Ein Ausspruch, der selten so gut zu dem Wesen eines Menschen passt, wie dieser simple Satz es schafft. Er verkörpert das Menschliche in einer automatisierten Welt. Der Faktor Mensch und Menschlichkeit wird in unserer heutigen Gesellschaft leider oftmals unter den Teppich gekehrt, missachtet oder mit Füßen getreten. Doch ist es das Ziel eines Jeden nach dem Perfekten zu streben? Nicht jeder Ablauf funktioniert jeden Tag gleich, nicht jeder Vorgang läuft reibungslos ab oder findet seinen geeigneten Weg. Es ist schlichtweg fatal und falsch zu glauben, dass, je weiter der technische Fortschritt voranschreitet, alles nach Plan, Mustern und Schemata abläuft, bei dem der Mensch an sich nicht mehr „viel Kaputt“ machen kann. Als mahnendes Beispiel sei hier eine Situation aus dem Monat Mai im Jahr 2010 erwähnt, als ein Börsenmakler durch einen folgeschweren Tippfehler und dem anschließenden Knopfdruck eine riesige Lawine automatisierter Prozesse losgetreten hatte, die nicht mehr zu stoppen war und enorme Folgen hatte. Es führte zu einem Börsencrash an der Wall Street, was eindeutig beweist, wie abhängig wir Menschen von den Maschinen geworden sind.
Im Rahmen meiner Studienarbeit möchte ich genauer eingehen auf automatisierte Prozesse bei der automatischen Materialdisposition für ein Sachkostenartikellager. Ich möchte jedoch vor allem darauf hinweisen, dass nicht jeder Prozess einwandfrei von statten gehen kann. Es ist immer noch ein Mensch, der diese Maschinen bedient und sie programmiert. Einem Menschen unterlaufen Fehler, welche verziehen werden sollten. Jeder Mensch macht Fehler, niemand ist perfekt. Wird dies berücksichtigt und Fehler minimiert, entsteht im Gesamtkonzept ein Zusammenspiel aus Mensch und Maschine, was uns Beschäftigten die Arbeit enorm erleichtert aber die Verantwortung immer wachsen lässt. Eine Maschine ist nur so clever und intelligent, wie der Nutzer, der davor sitzt. So muss in mancher Situation mit Vorsicht der nächste Schritt wohl überlegt sein, um in einem automatisierten System kein Chaos zu verursachen. Wie das funktionieren kann wird im Folgenden genauer erläutert werden.
...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition automatische Materialdisposition
- 3 Voraussetzungen für eine automatische Materialdisposition
- 3.1 Disponent
- 3.2 Einkäufer
- 3.3 Mahnwesen
- 3.4 Ersatzlieferung
- 3.5 System
- 4 Ablauf der automatischen Materialdisposition
- 4.1 Verschiedene Bedarfsarten
- 4.1.1 Primärbedarf
- 4.1.2 Sekundärbedarf
- 4.1.3 Tertiärbedarf
- 4.2 Verschiedene Möglichkeiten der Bedarfsermittlung
- 4.2.1 Auftragsgesteuerte Disposition
- 4.2.2 Plangesteuerte Disposition
- 4.2.3 Verbrauchsgesteuerte Disposition
- 4.2.3.1 Bestellpunktdisposition
- 4.2.3.2 Stochastische Disposition
- 4.3 Ablaufschema
- 4.3.1 Nettobedarfsrechnung
- 4.3.2 Losgrößenberechnung
- 4.3.3 Terminierung
- 4.3.4 Ermittlung von Bestellvorschlägen
- 4.3.5 Erstellung von Ausnahmemeldungen
- 4.1 Verschiedene Bedarfsarten
- 5 ABC- und XYZ-Analyse
- 6 Automatische Materialdisposition
- 6.1 Ablauf
- 6.1.1 Meldebestanddisposition
- 6.1.2 Berechnung Meldebestand/ Bestellpunkt
- 6.1.3 Steuerung Lagerbestand
- 6.1.4 Verhalten bei Lieferverzug
- 6.1.5 Mahnwesen
- 6.2 Problemstellungen
- 6.2.1 Fehlerhafte Materialstämme
- 6.2.1 Kritische Materialien
- 6.2.2 Mehrlieferanten-Strategie
- 6.2.3 Zuverlässigkeit der Lieferanten
- 6.2.4 Automatische Materialdisposition im Ausland
- 6.1 Ablauf
- 7 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die automatische Materialdisposition in einem Sachkostenartikellager. Ziel ist es, den Ablauf dieses Prozesses zu beschreiben, Voraussetzungen zu definieren und potenzielle Problemstellungen aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Interaktion zwischen Mensch und Maschine und der Notwendigkeit, menschliche Fehler zu berücksichtigen.
- Definition und Abgrenzung der automatischen Materialdisposition
- Voraussetzungen und Faktoren für einen effizienten Ablauf
- Analyse verschiedener Bedarfsermittlungsmethoden
- Bedeutung der ABC- und XYZ-Analyse für die Materialdisposition
- Herausforderungen und Lösungsansätze bei der automatischen Materialdisposition
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Unvollkommenheit automatisierter Prozesse und die Bedeutung des menschlichen Faktors. Am Beispiel eines Börsencrashs wird die Abhängigkeit von Technologie und die Notwendigkeit, menschliche Fehler zu berücksichtigen, verdeutlicht. Die Arbeit konzentriert sich auf die automatische Materialdisposition in einem Sachkostenartikellager und die Mensch-Maschine-Interaktion.
2 Definition automatische Materialdisposition: Dieses Kapitel legt eine präzise Definition des Begriffs "automatische Materialdisposition" fest. Es dient als Brücke zum nächsten Kapitel, in dem die Voraussetzungen für einen solchen Prozess detailliert beschrieben werden.
3 Voraussetzungen für eine automatische Materialdisposition: Dieses Kapitel beschreibt die essentiellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche automatische Materialdisposition. Es analysiert die Rollen des Disponenten, des Einkäufers und des Mahnwesens sowie die Bedeutung der Ersatzlieferung und des Systems selbst. Die strukturierte Darstellung unterstreicht die Notwendigkeit von Ordnung und Transparenz im Ablauf.
4 Ablauf der automatischen Materialdisposition: Hier wird der Ablauf der automatischen Materialdisposition detailliert dargestellt. Es werden verschiedene Bedarfsarten (Primär-, Sekundär-, Tertiärbedarf) und Bedarfsermittlungsmethoden (auftragsgesteuert, plangesteuert, verbrauchsgesteuert) erläutert. Das Ablaufschema umfasst Nettobedarfsrechnung, Losgrößenberechnung, Terminierung, Ermittlung von Bestellvorschlägen und die Erstellung von Ausnahmemeldungen. Der Fokus liegt auf der systematischen Vorgehensweise und der Integration verschiedener Methoden.
5 ABC- und XYZ-Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung der ABC- und XYZ-Analyse zur Klassifizierung von Materialien und zur Identifizierung derjenigen, die sich am besten für eine automatische Disposition eignen. Die Analyse dient der Optimierung des Prozesses und der Ressourcenallokation.
6 Automatische Materialdisposition: Dieses Kapitel beleuchtet den praktischen Ablauf der automatischen Materialdisposition im Unternehmen, konzentriert sich auf die Meldebestanddisposition, die Berechnung des Meldebestands und des Bestellpunktes, die Steuerung des Lagerbestands und das Verhalten bei Lieferverzug. Es analysiert verschiedene Problemstellungen, wie fehlerhafte Materialstämme, kritische Materialien, Mehrlieferantenstrategien, die Zuverlässigkeit von Lieferanten und die Besonderheiten der automatischen Materialdisposition im Ausland.
Schlüsselwörter
Automatische Materialdisposition, Sachkostenartikellager, Bedarfsermittlung, ABC-Analyse, XYZ-Analyse, Bestellpunktdisposition, Stochastische Disposition, Lieferantenmanagement, Mensch-Maschine-Interaktion, Fehlermanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Automatische Materialdisposition in einem Sachkostenartikellager
Was ist das Thema der Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich mit der automatischen Materialdisposition in einem Sachkostenartikellager. Sie untersucht den Ablauf dieses Prozesses, definiert die notwendigen Voraussetzungen und zeigt potentielle Problemstellungen auf. Ein besonderer Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Mensch und Maschine und der Berücksichtigung menschlicher Fehler.
Welche Ziele werden in der Studienarbeit verfolgt?
Die Arbeit beschreibt den Ablauf der automatischen Materialdisposition, definiert die Voraussetzungen für einen effizienten Ablauf, analysiert verschiedene Bedarfsermittlungsmethoden, untersucht die Bedeutung der ABC- und XYZ-Analyse und zeigt Herausforderungen und Lösungsansätze bei der automatischen Materialdisposition auf.
Welche Kapitel umfasst die Studienarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition automatischer Materialdisposition, Voraussetzungen für eine automatische Materialdisposition, Ablauf der automatischen Materialdisposition, ABC- und XYZ-Analyse, Automatische Materialdisposition (praktische Anwendung und Problemstellungen) und Resümee.
Wie wird die automatische Materialdisposition definiert?
Kapitel 2 liefert eine präzise Definition des Begriffs "automatische Materialdisposition", die als Grundlage für die weiteren Kapitel dient.
Welche Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche automatische Materialdisposition notwendig?
Kapitel 3 beschreibt die essentiellen Voraussetzungen, darunter die Rollen des Disponenten, Einkäufers und des Mahnwesens, die Bedeutung der Ersatzlieferung und des Systems selbst. Ordnung und Transparenz werden als entscheidend hervorgehoben.
Welche Bedarfsermittlungsmethoden werden behandelt?
Kapitel 4 erläutert verschiedene Bedarfsarten (Primär-, Sekundär-, Tertiärbedarf) und Bedarfsermittlungsmethoden (auftragsgesteuert, plangesteuert, verbrauchsgesteuert, inklusive Bestellpunktdisposition und stochastischer Disposition).
Wie läuft der Ablauf der automatischen Materialdisposition im Detail ab?
Kapitel 4 beschreibt den Ablauf detailliert mit einem Ablaufschema, das Nettobedarfsrechnung, Losgrößenberechnung, Terminierung, Ermittlung von Bestellvorschlägen und die Erstellung von Ausnahmemeldungen umfasst.
Welche Rolle spielen die ABC- und XYZ-Analyse?
Kapitel 5 beschreibt die Anwendung der ABC- und XYZ-Analyse zur Klassifizierung von Materialien und zur Identifizierung derjenigen, die sich am besten für eine automatische Disposition eignen. Die Analyse dient der Optimierung des Prozesses und der Ressourcenallokation.
Welche Probleme können bei der automatischen Materialdisposition auftreten?
Kapitel 6 analysiert verschiedene Problemstellungen, wie fehlerhafte Materialstämme, kritische Materialien, Mehrlieferantenstrategien, die Zuverlässigkeit von Lieferanten und die Besonderheiten der automatischen Materialdisposition im Ausland.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studienarbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Automatische Materialdisposition, Sachkostenartikellager, Bedarfsermittlung, ABC-Analyse, XYZ-Analyse, Bestellpunktdisposition, Stochastische Disposition, Lieferantenmanagement, Mensch-Maschine-Interaktion, Fehlermanagement.
Wie wird die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betont die Unvollkommenheit automatisierter Prozesse und die Bedeutung des menschlichen Faktors. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Mensch und Maschine und der Notwendigkeit, menschliche Fehler zu berücksichtigen.
- Quote paper
- Moritz Krueger (Author), 2011, Die automatische Materialdisposition am Beispiel eines Sachenkostenartikellagers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180371