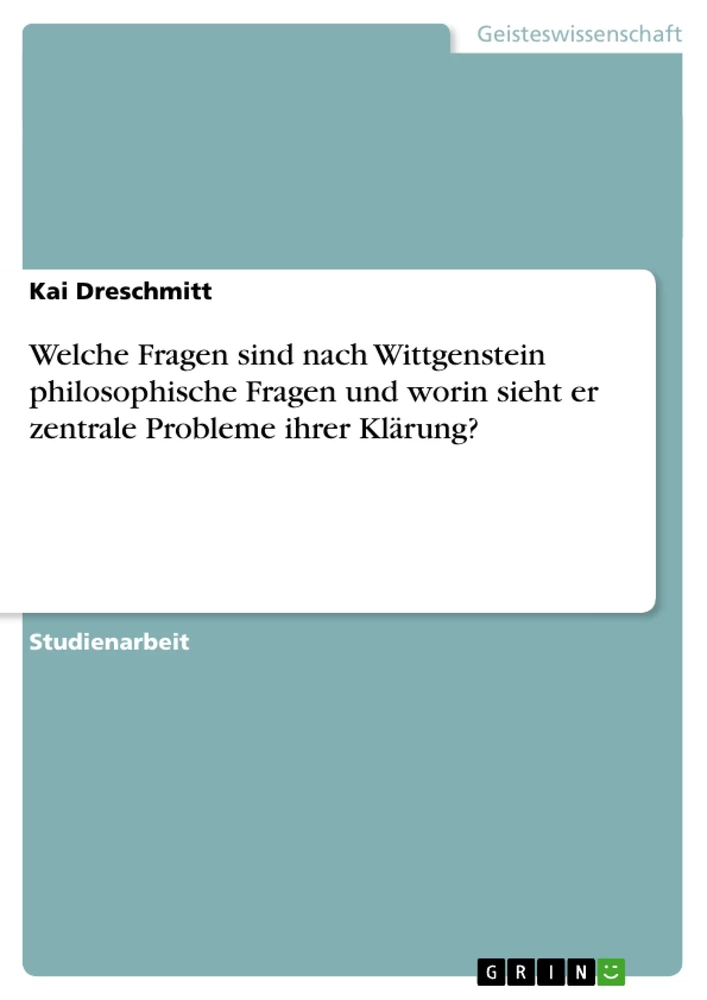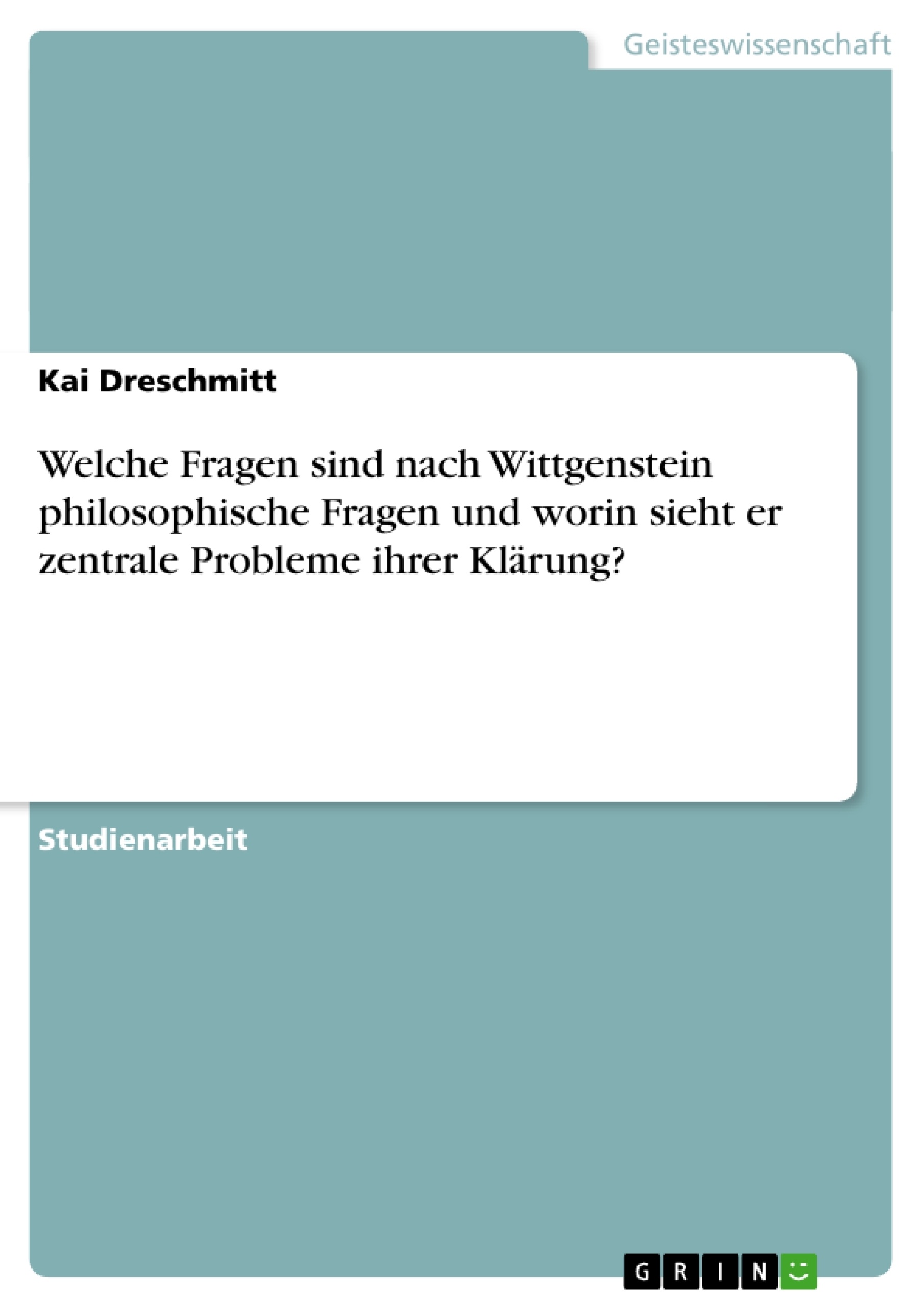Die Philosophie Wittgensteins manifestiert sich in zwei scheinbar unterschiedlichen Ansätzen: zum einen im Tractatus logico-philosophicus, seinem Frühwerk (erschienen 1921) und zum anderen in den „Philosophischen Untersuchungen, seinem Spätwerk, das erst zwei Jahre nach seinem Tod 1953 veröffentlicht wurde. Den beiden Werken ist gemein, dass sie beide Irrtümer bezüglich der Verwendung der Sprache aufzuklären versuchen. Allerdings auf höchst unterschiedliche Art und Weise. Während Wittgenstein in seiner frühen Schaffensphase noch der Überzeugung war, dass die Sprache in direktem Zusammenhang mit der tatsächlichen Wirklichkeit steht, verwirft er diesen Gedanken in den „Philosophischen Untersuchungen“ und arbeitet statt dessen heraus, wie die Sprache immer nur auf sich selbst verweisen kann und damit in keiner Beziehung zur objektiven Wirklichkeit steht. Somit erscheint es unmöglich verifizierbare Aussagen über die Welt zu machen. In den „Philosophischen Untersuchungen“ macht Wittgenstein schließlich deutlich, dass Aussagen nur in ihrem sozialen Kontext bestätigt werden können, was letztlich zu der Erkenntnis führt, das der Ort des Verstehens ein sozialer Ort ist.
Im Verlauf der Arbeit versuche ich nun zu erörtern, welche Probleme für Wittgenstein mit diesen Erkenntnissen verbunden sind und welche Auswirkungen diese auf die philosophische Arbeit haben. Dazu werde ich zunächst zentrale Aspekte der Wende in der Philosophie Wittgensteins skizzieren, also Unterschiede zwischen Tractatus logico-philosophicus (i.F.: TLP) und den „Philosophischen Untersuchungen“ (i.F.: PU) deutlich machen, sowie die neuen zentralen Themen herausarbeiten. Hierbei scheinen mir vor allem die neue Bedeutungstheorie, das „Regelfolgen“, sowie die damit verbundenen Ausführungen über Lebensformen und soziale Kontexte von Bedeutung für das Thema der Arbeit. Darauf folgend werde ich die, aus den zuvor genannten Themen resultierenden, Probleme und Konsequenzen für die philosophische Arbeit herausarbeiten. Wie schon im TLP wird auch in den PU besonders deutlich, was die Philosophie gerade nicht leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das neue Programm: Die „Philosophischen Untersuchungen“
- Bedeutung
- Sprachspiele und Regelfolgen
- Die Aufgabe der Philosophie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Wittgensteins philosophische Fragen und die Probleme ihrer Klärung, insbesondere den Wandel seiner Philosophie vom Tractatus Logico-Philosophicus zu den Philosophischen Untersuchungen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Bedeutungstheorie und der Rolle von Sprachspielen und Regelfolgen im Verständnis philosophischen Fragens.
- Wandel in Wittgensteins Philosophie (Tractatus vs. Philosophische Untersuchungen)
- Neue Bedeutungstheorie und der soziale Kontext von Sprache
- Sprachspiele und Regelfolgen als konstitutive Elemente der Bedeutung
- Die Grenzen und Möglichkeiten philosophischer Arbeit
- Die Rolle der Alltagssprache in der philosophischen Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden zentralen Werke Wittgensteins, den Tractatus Logico-Philosophicus und die Philosophischen Untersuchungen, gegenüber. Sie hebt den Unterschied in ihren Ansätzen zur Klärung von Irrtümern im Sprachgebrauch hervor: Während der Tractatus einen direkten Zusammenhang zwischen Sprache und Wirklichkeit postuliert, verwirft Wittgenstein dies später zugunsten eines sozial geprägten Verstehens von Sprache. Die Arbeit befasst sich mit den Problemen und Auswirkungen dieser Wende auf die philosophische Arbeit.
1. Das neue Programm: Die „Philosophischen Untersuchungen“: Dieses Kapitel untersucht die zentrale Rolle der Sprache in Wittgensteins Philosophie. Es vergleicht die Abbildtheorie des Tractatus mit der neuen Bedeutungstheorie der Philosophischen Untersuchungen. Wittgenstein verlässt die Suche nach einer idealen Sprache und konzentriert sich stattdessen auf die Analyse der Alltagssprache und deren Gebrauch in sozialen Kontexten. Die Bedeutung eines Wortes wird durch seinen Gebrauch definiert, und die Philosophie erhält einen deskriptiven Auftrag, die Alltagssprache zu untersuchen.
1.1 Bedeutung: Dieses Unterkapitel befasst sich mit Wittgensteins neuartiger Bedeutungstheorie. Im Gegensatz zu traditionellen Auffassungen, die Bedeutung als Repräsentation eines von ihr verschiedenen Objekts verstehen, betont Wittgenstein die soziale Eingebundenheit von Bedeutung. Die Bedeutung eines Wortes wird durch seinen Gebrauch im sozialen Kontext bestimmt und ist nicht an eine objektive Wirklichkeit gebunden. Die Philosophie muss die tatsächliche Verwendung von Worten in der Alltagssprache untersuchen, um Bedeutung zu verstehen.
Schlüsselwörter
Wittgenstein, Philosophie, Sprachspiel, Bedeutung, Regelfolgen, Alltagssprache, Tractatus Logico-Philosophicus, Philosophische Untersuchungen, soziale Kontexte, Lebensformen, philosophische Methode.
Häufig gestellte Fragen zu: Wittgensteins Philosophische Entwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die philosophischen Fragen Ludwig Wittgensteins und deren Klärung, insbesondere den Wandel seiner Philosophie vom Tractatus Logico-Philosophicus zu den Philosophischen Untersuchungen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Bedeutungstheorie und der Rolle von Sprachspielen und Regelfolgen im Verständnis philosophischen Fragens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel in Wittgensteins Philosophie, seine neue Bedeutungstheorie und den sozialen Kontext von Sprache, Sprachspiele und Regelfolgen als konstitutive Elemente der Bedeutung, die Grenzen und Möglichkeiten philosophischer Arbeit sowie die Rolle der Alltagssprache in der philosophischen Analyse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Philosophischen Untersuchungen (mit Unterkapiteln zu Bedeutung, Sprachspielen und Regelfolgen) und ein Kapitel über die Aufgabe der Philosophie. Sie enthält außerdem eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist der Unterschied zwischen dem Tractatus und den Philosophischen Untersuchungen?
Der Tractatus postuliert einen direkten Zusammenhang zwischen Sprache und Wirklichkeit (Abbildtheorie), während die Philosophischen Untersuchungen diese Annahme verwerfen. Wittgenstein konzentriert sich in den Untersuchungen auf die Analyse der Alltagssprache und deren Gebrauch in sozialen Kontexten. Bedeutung wird durch Gebrauch definiert, und die Philosophie erhält einen deskriptiven Auftrag.
Welche Rolle spielt die Bedeutungstheorie in Wittgensteins Werk?
Wittgensteins Bedeutungstheorie in den Philosophischen Untersuchungen betont die soziale Eingebundenheit von Bedeutung. Die Bedeutung eines Wortes wird durch seinen Gebrauch im sozialen Kontext bestimmt und ist nicht an eine objektive Wirklichkeit gebunden. Die Philosophie muss die tatsächliche Verwendung von Worten in der Alltagssprache untersuchen, um Bedeutung zu verstehen.
Welche Bedeutung haben Sprachspiele und Regelfolgen?
Sprachspiele und Regelfolgen sind konstitutive Elemente von Bedeutung nach Wittgenstein. Sie zeigen, wie Sprache in sozialen Kontexten funktioniert und Bedeutung nicht aus einer isolierten Beziehung zwischen Wort und Objekt entsteht, sondern aus dem Gebrauch von Sprache in verschiedenen "Sprachspielen".
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Wittgenstein, Philosophie, Sprachspiel, Bedeutung, Regelfolgen, Alltagssprache, Tractatus Logico-Philosophicus, Philosophische Untersuchungen, soziale Kontexte, Lebensformen und philosophische Methode.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Philosophie Ludwig Wittgensteins, insbesondere für den Vergleich zwischen seinen frühen und späten Werken, interessieren. Sie eignet sich für Studierende der Philosophie und alle, die sich mit Fragen der Sprachphilosophie, Bedeutungstheorie und der Methode der philosophischen Analyse auseinandersetzen.
- Quote paper
- Kai Dreschmitt (Author), 2011, Welche Fragen sind nach Wittgenstein philosophische Fragen und worin sieht er zentrale Probleme ihrer Klärung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180167