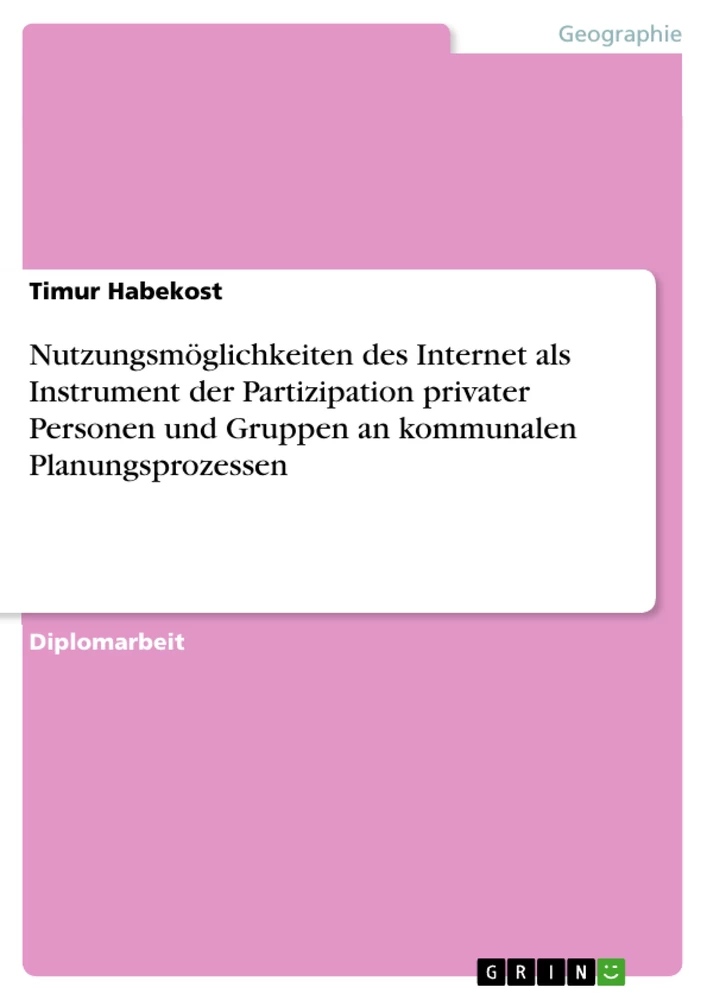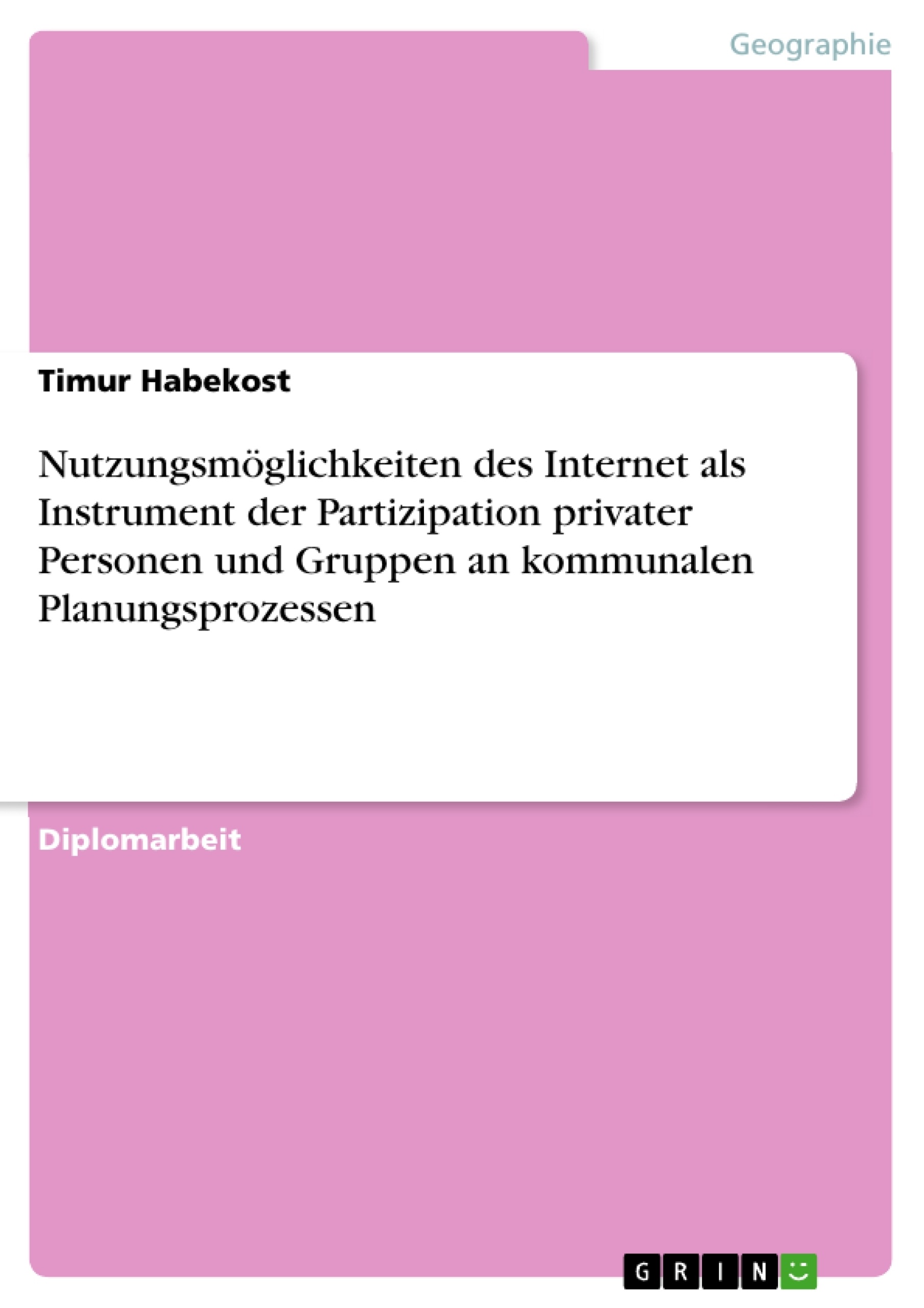Einleitung
Die seit Anfang der 90er Jahre auch in Deutschland augenscheinlich stark zunehmende Verbreitung des Internet und der damit in Zusammenhang stehenden Informations- und Kommunikationstechnik (IuKT) sowie Softwareanwendungen, stellt eine gesellschaftliche
Herausforderung dar, der sich vor allem auch die kommunalen Verwaltungen stellen müssen. Sozio - ökonomische Veränderungen, die im Rahmen des Vordringens dieser Technologien in die unterschiedlichsten Lebensbereiche auftreten, haben schon frühzeitig
zur Entstehung des Begriffs „Informationsgesellschaft“ geführt, der im Endeffekt besagt, dass das sozio - kulturelle und wirtschaftliche Leben einer Gesellschaft von der Sammlung, Aufbereitung, Vermittlung und Weiterleitung von Informationen in hohem Maße abhängig ist. Dieser Zustand ist zwar noch nicht zur Gänze erreicht, die Tendenzen sind allerdings offenkundig. Daraus erwachsen ebenfalls Konsequenzen für die Interaktionsmöglichkeiten und deren Qualität zwischen kommunalen Verwaltungen und den Bürgerinnen und Bürgern. Einerseits ist mit Hilfe der vernetzten Technik, wie beispielsweise Computern, eine technisch und funktional verbesserte Kommunikation möglich, andererseits stellt sich die Frage, wie es mit den Konsequenzen für die Qualität der Kommunikation bestellt ist. Vielleicht ergeben sich Möglichkeiten einer Verbesserung und Aufwertung, besonders im Bereich demokratischer Mitbestimmung. Schließlich wird seit den
60er Jahren diskutiert, wie partizipativ - plebiszitäre Möglichkeiten direkter Demokratie verwirklicht werden könnten. Dabei ist vor allem die Planung ein interessantes Feld, schließlich handelt es sich um die kommunale Aufgaben, deren Ergebnisse für Bürger zu besonders begreif- und erlebbaren Resultaten im Guten wie im Schlechten führen. Außerdem ist die Mitbestimmung, bei entsprechenden Angeboten der Kommunen, unmittelbarer als z.B. im Falle der Wahlen, deren Beteiligungsintensität eher mittelbaren Charakters ist.
Die „neuen“ Kommunikationstechnologien sind bereits dabei, den Austausch von Informationen und Dienstleistungen zwischen öffentlicher Verwaltung und Bürgern tiefgreifend umzugestalten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- PARTIZIPATION AN PLANUNGSPROZESSEN - WARUM?
- DEFINITIONEN
- GESETZLICHER RAHMEN
- Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung
- Vereinfachtes Verfahren bei geringfügigen Änderungen
- Beschleunigungsgesetze im Bauleitplanverfahren
- Beteiligung der Öffentlichkeit im UVP-Verfahren
- Beteiligung im Rahmen des Naturschutzgesetzes (BnatSchG)
- Beteiligungsrechte im Rahmen der Gemeindeordnungen
- Bürgerantrag (§ 22a GO Nds., § 20b GO BW)
- Bürgerentscheid
- Bürgerbegehren
- METHODEN, VERFAHREN UND UMSETZUNGSFORMEN DER BETEILIGUNG
- VORTEILE DER PARTIZIPATION
- SCHWIERIGKEITEN UND HINDERNISSE
- ANSPRÜCHE UND ZIELRICHTUNGEN DER KOMMUNEN BEZÜGLICH PARTIZIPATION IM PLANUNGSPROZESS
- ERWARTUNGEN PRIVATER PERSONEN UND GRUPPEN
- KAPITELZUSAMMENFASSUNG
- TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN EINE PARTIZIPATION AN PLANUNGSPROZESSEN ÜBER DAS INTERNET ZU REALISIEREN
- DAS INTERNET UND DIE ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION
- Vorteile des Internet
- Nachteile des Internet
- Gesellschaftspolitische Gefahren
- Sicherheits- und Rechtsfragen
- WWW (WORLD WIDE WEB)
- MAILING LISTS
- NEWSGROUPS
- DISKUSSIONSFOREN (MESSAGEBOARDS, VIRTUELLE SCHWARZE BRETTER)
- CHAT (INTERNET RELAY CHAT (IRC), WWW-CHAT)
- MULTI-MEDIA-KONFERENZEN, INTERNETKONFERENZ
- KAPTITELZUSAMMENFASSUNG
- VARIANTEN UND BEISPIELE INTERAKTIVER PARTIZIPATIONSMÖGLICHKEITEN AN PLANUNGSPROZESSEN IM INTERNET
- ANGEBOTE DER KOMMUNEN IM INTERNET
- Diskussionsforen zu Planungsthemen
- Formulare
- Planungsunterlagen und Planungsinformationen
- Beteiligung spezifischer Gruppen
- Kinder und Jugendliche
- Frauen
- Senioren
- Behinderte Bürgerinnen und Bürger
- ELEKTRONISCHE DEMOKRATIE
- KAPITELZUSAMMENFASSUNG
- INTERNETBEFRAGUNG
- VORGEHENSWEISE
- AUFBAU DES FRAGEBOGENS AN DIE KOMMUNEN
- AUFFÄLLIGKEITEN
- AUSWERTUNG DER FRAGEBÖGEN
- Internetanschlüsse (Frage 3)
- Ausstattung mit Webseiten und E-Mail (Fragen 5/6)
- Nutzungshäufigkeit verschiedener Internet - Kommunikationsmittel zur Verständigung über Planungsfragen (Frage 7)
- Kommunikationsverteilung (Frage 8)
- Interaktive Dienstleistungen (Frage 9)
- Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen von Planungsvorhaben (Fragen 10/11/12)
- Zukünftige Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten (Frage 13)
- Generelle Eignung des Internet zur Mitbestimmung an Planungsprozessen zu (Frage 14)
- Internetbeteiligung – Ergänzung oder eigenständiges Instrument (Frage 15)
- Nutzeranalyse - wie schätzen die Kommunen die Internetnutzer ein (Frage 16)
- Nutzen der Internetpartizipation aus Sicht der Kommunen (Frage 17/18)
- Angaben einzelner Bürgerinnen und Bürger (Fragebogen 3)
- KAPITELZUSAMMENFASSUNG
- GESAMTBEWERTUNG
- WIE PROFITIEREN WELCHE BEVÖLKERUNGSGRUPPEN VON DER INTERNETPARTIZIPATION
- GRÜNDEN FÜR DIE BENACHTEILIGUNG EINIGER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN
- AKTUELLE HANDLUNGSWEISE DER KOMMUNEN UND VARIATIONSMÖGLICHKEITEN
- ERGÄNZUNG ALTHERGEBRACHTER PARTIZIPATIONSFORMEN ODER DIE ZUKUNFT DER BETEILIGUNG
- SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
- FRAGEBÖGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Nutzungsmöglichkeiten des Internets als Instrument der Partizipation privater Personen und Gruppen an kommunalen Planungsprozessen. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse der technischen Möglichkeiten, der konkreten Umsetzung in verschiedenen Kommunen und der Evaluation der Effizienz und der Reichweite dieser partizipativen Ansätze.
- Partizipationsformen und -möglichkeiten im Bereich der kommunalen Planung
- Technische Möglichkeiten der Internet-gestützten Partizipation
- Umsetzung von Internet-basierten Partizipationskonzepten in der Praxis
- Bewertung der Vorteile und Herausforderungen der Internetpartizipation
- Zukünftige Entwicklungen und Potenziale der Internetpartizipation im Bereich der kommunalen Planung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt den rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext der Partizipation an Planungsprozessen. Es werden die verschiedenen Formen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die relevanten Gesetze und Vorschriften erläutert. Im zweiten Kapitel werden die technischen Möglichkeiten der Internet-basierten Partizipation beleuchtet, wobei verschiedene Kommunikations- und Interaktionsformen im Internet vorgestellt werden. Das dritte Kapitel stellt verschiedene Varianten und Beispiele für interaktive Partizipationsmöglichkeiten im Internet vor, die von Kommunen implementiert werden können. Im vierten Kapitel wird eine eigene Internetbefragung von Kommunen vorgestellt, die Erkenntnisse über den aktuellen Stand der Nutzung des Internets zur Partizipation liefert. Das fünfte Kapitel schließlich beschäftigt sich mit einer Gesamtbewertung der Ergebnisse der Internetbefragung und diskutiert die Chancen und Herausforderungen der Internetpartizipation.
Schlüsselwörter
Kommunale Planung, Partizipation, Internet, E-Demokratie, Online-Beteiligung, Informationsgesellschaft, Bürgerbeteiligung, digitale Kommunikation, kommunale Verwaltung, Planungsverfahren.
- Citar trabajo
- Timur Habekost (Autor), 1999, Nutzungsmöglichkeiten des Internet als Instrument der Partizipation privater Personen und Gruppen an kommunalen Planungsprozessen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17