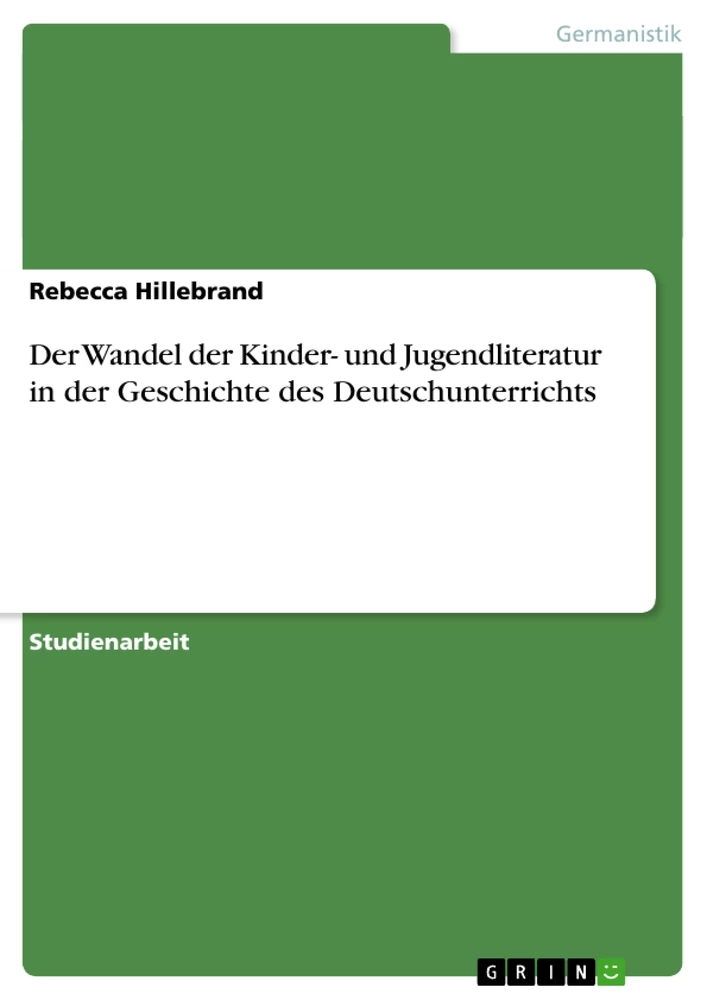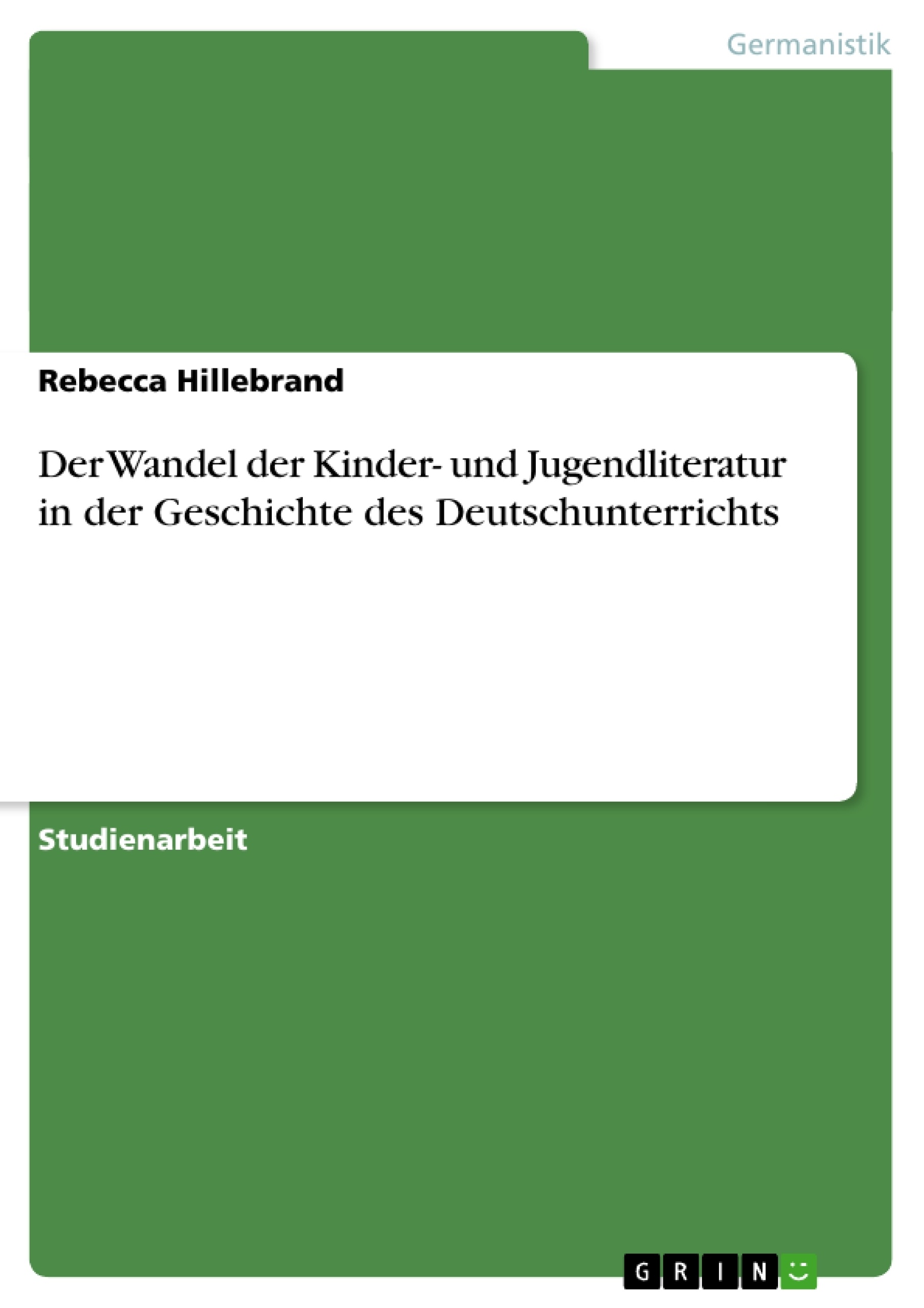Die zunehmende Ausbreitung der Mediengesellschaft seit den sechziger Jahren (Fernsehen) hat bewirkt, dass sich die literarische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen immer mehr auf die literarische Erziehung in der Schule verlagert hat. Die Neuen Medien, wie Fernsehen und Computer, haben eine Veränderung der Kindheit zur Folge. Somit rückt die Schule als vermittelnde Instanz von Leseförderung - speziell im Deutsch -und Literaturunterricht - in den Vordergrund. Sie soll die Lesemotivation und das Leseinteresse bei den Kindern und Jugendlichen wecken. 1 Das Einsetzten von Kinder und Jugendliteratur im Unterricht ermöglicht eine Auseinandersetzung mit Themen, die Heranwachsende auch im Privatleben beschäftigen. Oftmals ist die Einbeziehung von KJL 2 in den Unterricht problematisch. Schüler beklagen sich, dass die Literatur im Unterricht „ zerredet“ werde und ihnen das Interesse am Freizeitlesen nehme. 3 Kritik an diesem Phänomen existiert bereits seit den siebziger Jahren. Pädagogen warnen davor, die Freizeitlektüre der Kinder und Jugendlichen in den schulischen Kontext mit einzubeziehen, da es in diesem Zusammenhang die Freude am Lesen nehme. Das Jugendbuch gehöre in den Freizeitbereich, nicht in die „trockene Schulstube“. 4
Ziel dieser Untersuchung ist es, den Wandel der Kinder- und Jugendliteratur und seine Bedeutung für den Deutschunterricht seit den fünfziger Jahren bis zur Gegenwart herauszuarbeiten. In wie weit sich der Einsatz von KJL im Unterricht verändert hat, soll an Hand verschiedener Untersuchungen, die für die Bedeutung des Deutschunterrichts relevant sind, erarbeitet werden. Im folgenden soll eine Darstellung der Geschichte des Deutschunterrichts einen Überblick über allgemeine Veränderungen seit den fünfziger Jahren geben. Der Hauptteil dieser Untersuchung gilt allerdings speziell der Veränderung von KJL im Allgemeinen und die Bedeutung für den Deutschunterricht. Ein Vergleich von Fachdidaktiken und Lesebüchern soll Aufschluss über die Geschichte von KJL im Deutschunterricht geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte des Deutschunterrichts und der Deutschdidaktik
- 2.1. Die Nachkriegszeit
- 2.2. Die fünfziger Jahre
- 2.3. Die sechziger Jahre
- 2.4. Die siebziger Jahre
- 2.5. Die achtziger und neunziger Jahre
- 3. Kinder- und Jugendliteratur
- 3.1. Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur
- 3.2. Fachdidaktiken in Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur
- 4. Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht
- 4.1. Anna Krüger und ihre Auswirkungen auf den Deutschunterricht
- 4.2. Vergleich von Lesebüchern der fünfziger und sechziger Jahre
- 4.3. Aktuelle Positionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht seit den fünfziger Jahren. Sie analysiert, wie sich der Einsatz von Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht verändert hat und welche Bedeutung diese für den Deutschunterricht hat.
- Die Geschichte des Deutschunterrichts und der Deutschdidaktik seit den fünfziger Jahren
- Die Bedeutung von Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht
- Der Wandel der Kinder- und Jugendliteratur im Laufe der Zeit
- Der Einfluss von medialen Veränderungen auf die literarische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle des Deutschunterrichts bei der Förderung von Lesemotivation und Leseinteresse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den Einfluss der Mediengesellschaft auf die literarische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen und argumentiert, warum die Schule eine zentrale Rolle bei der Leseförderung im Deutsch- und Literaturunterricht spielt. Die Arbeit befasst sich mit der Problematik der Einbeziehung von Kinder- und Jugendliteratur in den Unterricht und den damit verbundenen Herausforderungen.
2. Geschichte des Deutschunterrichts und der Deutschdidaktik
2.1. Die Nachkriegszeit
Die Nachkriegszeit war geprägt von dem Bestreben, nationalsozialistisches Gedankengut zu beseitigen. Die Umerziehung zur Demokratie stand im Vordergrund, doch eine tatsächliche Umsetzung des Programms blieb in vielen Fällen aus. Der Unterricht konzentrierte sich auf den literarischen Kanon der zwanziger Jahre, während moderne Literatur, darunter Exilliteratur, weitgehend ignoriert wurde.
2.2. Die fünfziger Jahre
Die Konferenz der Länder (KMK) beschloss 1950 Richtlinien für politische Bildung als Unterrichtsprinzip in allen Schulen. Trotz dieses Beschlusses wurde die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit im Literaturunterricht vernachlässigt. Die Beschäftigung mit modernen Werken blieb aus, und klassische, moralisierende und naturverbundene Literatur dominierte den Unterricht.
3. Kinder- und Jugendliteratur
3.1. Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur und ihre Rezeption im Laufe der Zeit.
3.2. Fachdidaktiken in Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur
Die Fachdidaktik des Deutschunterrichts im Hinblick auf Kinder- und Jugendliteratur wird in diesem Kapitel beleuchtet.
4. Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht
4.1. Anna Krüger und ihre Auswirkungen auf den Deutschunterricht
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Einfluss von Anna Krüger und ihren Schriften auf den Deutschunterricht.
4.2. Vergleich von Lesebüchern der fünfziger und sechziger Jahre
Ein Vergleich von Lesebüchern aus verschiedenen Jahrzehnten zeigt die Veränderung der Literatur, die im Deutschunterricht verwendet wird.
4.3. Aktuelle Positionen
Aktuelle Positionen zur Verwendung von Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendliteratur, Deutschunterricht, Leseförderung, literarische Sozialisation, Mediengesellschaft, Umerziehung, Fachdidaktik, Lesebücher.
- Quote paper
- Rebecca Hillebrand (Author), 2002, Der Wandel der Kinder- und Jugendliteratur in der Geschichte des Deutschunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17991