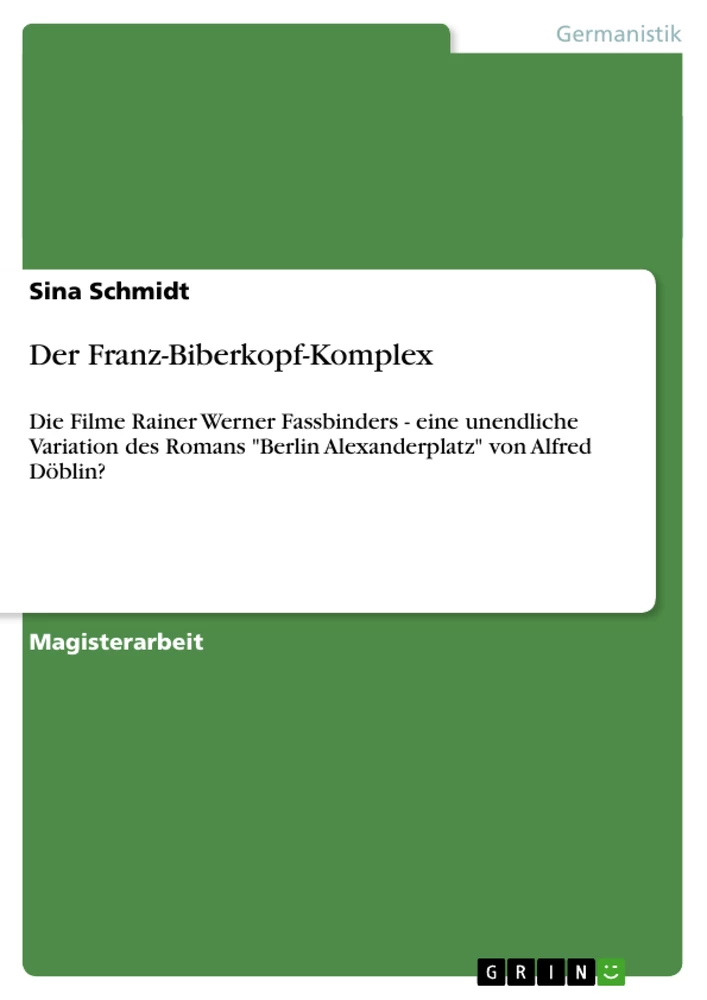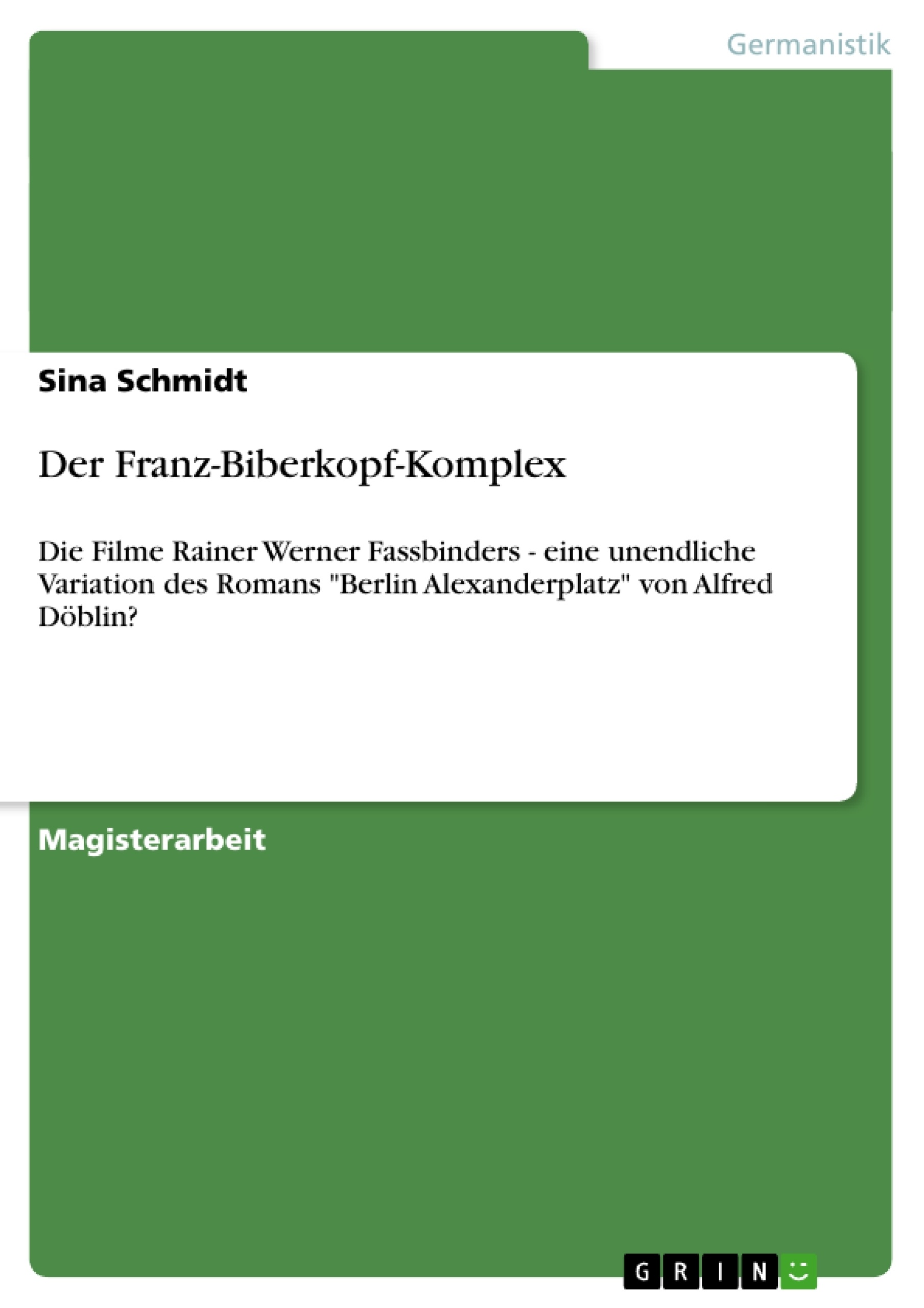„Jeder vernünftige Regisseur hat nur ein Thema, macht eigentlich immer denselben Film. Bei mir geht es um die Ausbeutbarkeit von Gefühlen, von wem auch immer sie ausgebeutet werden. Das
endet nie. Das ist ein Dauerthema. Ob der Staat, die Vaterlandsliebe ausbeutet, oder ob in einer Zweierbeziehung einer den anderen kaputt macht. Das kannst du in immer neuen Variationen erzählen.“1
Eine Schlüsselrolle im Gesamtwerk des seinerzeit umstrittenen Schriftstellers und Regisseurs Rainer Werner Fassbinder nimmt ohne Zweifel seine Verfilmung von Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ ein. Ein Roman, der für Fassbinder im Alter von 14
Jahren eine praktische Lebenshilfe2 darstellte. Untersucht man den Roman und Fassbinders Verfilmung näher, wird erst langsam offenbar, wie wesentlich und stilprägend Döblins Werk gewesen sein muss. Nicht nur, dass häufig der Name Franz oder Franz Biberkopf in verschiedenen Filmen auftaucht und Fassbinder selbst auf das Pseudonym Franz Walsch zurückgreift, die meisten Hauptfiguren in den Filmen des Regisseurs sind im Grunde derselbe Charaktertypos wie Biberkopf in Döblins Buch.
Steht nicht Franz Biberkopf im Zentrum, taucht oft ein charismatischer Unterdrücker mit sadistischen Zügen auf, der der Döblinschen Reinhold-Figur entspricht.Diesen wird der Typos „heilige Hure“, oder - wie Fassbinder selbst einen seiner Filme nannte - die heilige Nutte gegenübergestellt. Hier sind Frauen wie Mieze oder Eva gemeint, die in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu den sie umgebenden Männern stehen. Sie werden teilweise von den Männern unterdrückt, unterworfen, benutzt und missbraucht, werden aber nie als eindimensionale Opfer dargestellt, sondern auch als knallharte
Geschäftsfrauen, die ihren Wert und Preis kennen und ihre Unterdrücker ebenso in ein Abhängigkeitsverhältnis zu setzen wissen und dadurch unaufhaltsam gesellschaftlich aufsteigen. Dabei schaffen sie es, wie in der Beziehung zwischen Mieze und Franz, eine
einzelne ideelle Liebe im Herzen zu bewahren, für die sie alles auf sich nehmen.
In einer weiteren Gruppe von Filmen, setzt Fassbinder nun die so entwickelten Figuren miteinander in Beziehung und lässt sie verschiedenste Situationen durchlaufen. Hierbei mischen sich die Elemente aus Döblins Roman und den persönlichen Erfahrungen, die
Fassbinder mit den ihn umgebenden Menschen und Gruppierungen gemacht hat.
Anhand dieser Themenfelder sollen ausgewählte Filme Fassbinders auf die Leitfrage hin untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Hintergründe
- 1. 1. Ein Roman als konkrete Lebenshilfe – Eine Entdeckung
- 1. 2. Warum eine Verfilmung des Romans?
- 1. 3. Geschichtsschreibung mit Hilfe des Films
- 2. Der Roman „Berlin Alexanderplatz“
- 2. 1. 1. Von der Entlassung bis zur ersten Station – Der Vertrauensbruch
- 2. 1. 2. Flucht in Alkoholismus - ein zweiter Neuanfang
- 2. 1. 3. Die 3. Station - Eine schicksalhafte Begegnung – Verlust des Armes
- 2. 1. 4. Krankheit am Körper – Genesung
- 2. 1. 5. Ein drittes neues Leben
- 2. 1. 6. Der Untergang
- 2. 1. 7. Das Ende
- 3. Exkurs - Vom Für und Wider der Literaturverfilmung
- 3. 1. Zusammenprall zweier Medien
- 3. 2. Vorgehen
- 4. Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“
- 4. 1. Arbeitsweise
- 4. 2. Stilistik
- 4. 2. 1. Aufbau
- 4. 2. 2. Ein Großstadtroman wird Großstadtfilm
- 4. 3. Im Spannungsfeld Hollywoodmelodram – Nouvelle Vague
- 4. 3. 1. Bildsprache
- 4. 3. 2. Licht
- 4. 3. 3. Ton
- 5. Die Filme Fassbinders als endlose Variation des Romans „Berlin Alexanderplatz“?
- 5. 1. Versuch einer Systematisierung
- 6. Analyse eines tragischen Helden – Franz Biberkopf
- 6. 1. „Händler der vier Jahreszeiten“
- 6. 2. „In einem Jahr mit 13 Monden“
- 7. Analyse der Reinhold-Figur
- 7. 1. „Satansbraten“
- 7. 2. „Martha“
- 8. Die heilige Nutte
- 8. 1. „Lola“
- 9. Analyse von Gruppendynamiken
- 9. 1. „Chinesisches Roulette“
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Filme Rainer Werner Fassbinders im Hinblick auf ihre Beziehung zum Roman „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Filme Fassbinders als eine unendliche Variation des Romans verstanden werden können. Sie analysiert verschiedene filmische Elemente, wie Bildsprache, Licht und Ton, und setzt diese in Beziehung zu den Themen und Figuren des Romans.
- Fassbinders Auseinandersetzung mit Döblins „Berlin Alexanderplatz“
- Analyse von Figuren und Motiven in Fassbinders Filmen im Kontext des Romans
- Die filmische Adaption eines komplexen Romans
- Fassbinders ästhetisches Konzept und seine Rezeption
- Die Bedeutung von „Berlin Alexanderplatz“ für Fassbinders Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entdeckung des Romans „Berlin Alexanderplatz“ durch Fassbinder dar und skizziert den Entstehungsprozess seiner Verfilmung. Sie beleuchtet den Einfluss der Geschichte und der Geschichten um Fassbinders Leben auf die Rezeption seiner Werke. Die Arbeit geht auf den biographischen Ansatz in der Fassbinder-Forschung ein und kritisiert die Gefahr, die Filme auf Fassbinders mögliches Leben und seine Intention zu reduzieren.
Kapitel 1 beleuchtet die Hintergründe der Verfilmung und erläutert die Bedeutung des Romans „Berlin Alexanderplatz“ für Fassbinder. Es werden die Rezeption des Romans und die ästhetischen Herausforderungen einer Verfilmung des Großstadtromans thematisiert.
Kapitel 2 stellt den Roman „Berlin Alexanderplatz“ als eine Geschichte des Franz Biberkopfs vor. Es werden wichtige Stationen seiner Entwicklung und die Schlüsselfiguren des Romans, wie Reinhold, Eva und Mieze, vorgestellt. Kapitel 3 analysiert die Besonderheiten von Literaturverfilmungen und diskutiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich bei der Umsetzung von literarischen Werken ins filmische Medium ergeben.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Fassbinders Verfilmung von „Berlin Alexanderplatz“. Es werden die Arbeitsweise, die Stilistik und die ästhetischen Besonderheiten des Films beleuchtet. Kapitel 5 untersucht die Beziehung zwischen Fassbinders Filmen und dem Roman „Berlin Alexanderplatz“ und versucht, eine Systematik in der Rezeption des Romans in seinen Werken zu entwickeln.
Kapitel 6 und 7 widmen sich der Analyse der Figuren Franz Biberkopf und Reinhold. Sie beleuchten deren Darstellung in verschiedenen Fassbinder-Filmen und diskutieren die Relevanz der Figuren für Fassbinders Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Literaturverfilmung, insbesondere mit den Herausforderungen und Chancen, die sich bei der Adaption eines komplexen Romans wie „Berlin Alexanderplatz“ ergeben. Sie beleuchtet die Rezeption von Döblins Roman durch Fassbinder, analysiert die filmischen Mittel, die Fassbinder verwendet, und untersucht die Beziehung zwischen den Filmen und dem Roman. Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Großstadtleben, Gewalt, soziale Ungleichheit, Psychologie der Figuren und der ästhetischen Besonderheiten der Filme. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind „Enfant terrible“, „Neuer Deutscher Film“, „Hollywoodmelodram“, „Nouvelle Vague“, „Figurenkonstellation“, „biographischer Ansatz“, „Montage-Roman“ und „literarische Vorlage“.
- Citar trabajo
- Sina Schmidt (Autor), 2011, Der Franz-Biberkopf-Komplex, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179810