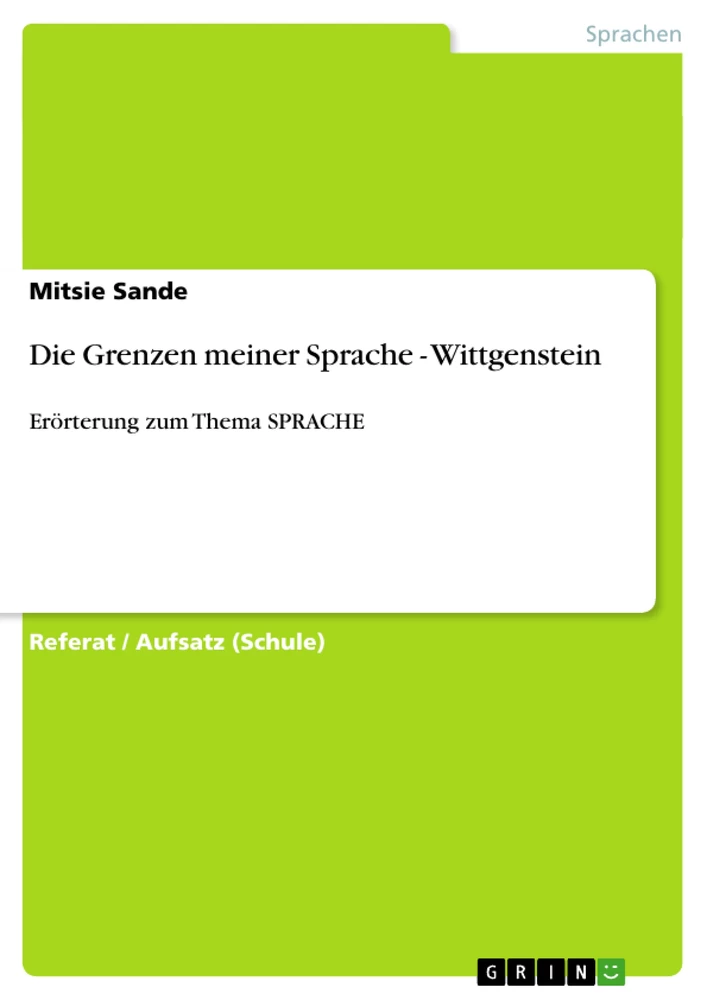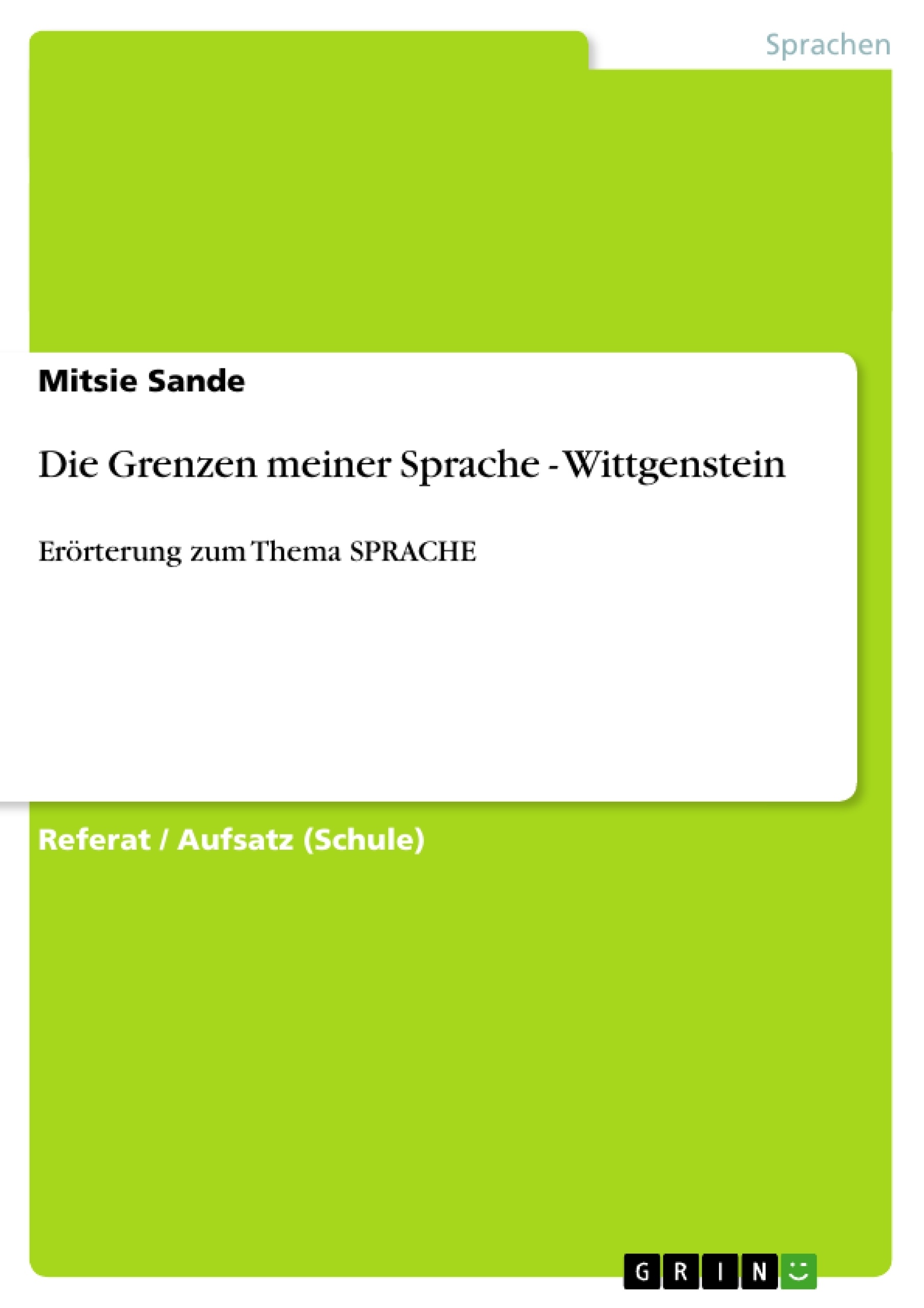Eine Erörterung zur Aussage "Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt" des österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein.
Inhaltsverzeichnis
- Erörterung
- Sprache als Ausdruck von Intelligenz
- Sprache als Indikator für Bildung und Beruf
- Sprache als Ausdruck von sozialer Interaktion
- Sprache und Autismus
- Sprache und Identifizierung
- Sprache als Verallgemeinerung
- Sprache als Mittel der Kategorisierung
- Sprache und Vorurteile
- Sprache und Gefühle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Aussage von Ludwig Wittgenstein, „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“, im Hinblick darauf, ob und inwiefern Sprache die Wahrnehmung und das Verständnis der Welt durch den Menschen prägt.
- Der Einfluss von Sprache auf die soziale und berufliche Positionierung
- Die Rolle der Sprache bei der Identifizierung und der Abgrenzung von Gruppen
- Die Verallgemeinerung und Kategorisierung der Welt durch Sprache
- Die Grenzen der Sprache in der Beschreibung von Gefühlen und Gedanken
- Die Frage, ob Sprache die Grenzen des Denkens setzt oder ob diese unabhängig von Sprache existieren
Zusammenfassung der Kapitel
- Erörterung: Der Text führt in die Aussage von Ludwig Wittgenstein ein und erläutert, dass Sprache ein Medium der Kommunikation und des Ausdrucks von Intelligenz ist. Die Rolle der Sprache in sozialen Interaktionen und bei der Einstufung von Personen wird beleuchtet.
- Sprache als Ausdruck von Intelligenz: Der Text argumentiert, dass Sprache ein Indikator für Bildung und Beruf sein kann. Es wird jedoch betont, dass Intelligenz nicht allein durch die Fähigkeit zur Rede bestimmt wird. Am Beispiel von autistischen Menschen wird gezeigt, dass auch ohne ausgeprägte Sprachfähigkeiten außergewöhnliche intellektuelle Leistungen möglich sind.
- Sprache und Identifizierung: Der Text zeigt auf, wie Sprache als Mittel der Identifizierung und der Abgrenzung von Gruppen dient. Das Beispiel von Insiderwitzen unter Freunden verdeutlicht, wie Sprache die Zugehörigkeit zu einer Gruppe symbolisieren und Außenstehende ausschließen kann.
- Sprache als Verallgemeinerung: Der Text analysiert, wie Sprache eine Verallgemeinerung der Welt bewirkt. Es wird gezeigt, dass verschiedene Sprachen unterschiedliche Wortstämme für ähnliche Phänomene verwenden können. So wird im Deutschen „Schnee“ für jede Art von gefrorenem Wasser verwendet, während Eskimos verschiedene Begriffe für fallenden und liegenden Schnee haben.
- Sprache und Gefühle: Der Text argumentiert, dass es Gedanken und Gefühle gibt, die sich nicht in Sprache fassen lassen. Es wird betont, dass der Ursprung unserer Gedanken in den Gefühlen liegt und dass die Sprache nicht in der Lage ist, diese vollständig zu erfassen.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen Sprache, Intelligenz, Autismus, Identifizierung, Verallgemeinerung, Gefühle und Gedanken. Weitere wichtige Begriffe sind: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“, Ludwig Wittgenstein, „Tractus Logico- Philosophicus“, Rhetorik, Bildung, Beruf, soziales Zusammenleben, Insiderwissen, Wortstämme, Vorurteile, Gefühlswelt.
- Quote paper
- Mitsie Sande (Author), 2010, Die Grenzen meiner Sprache - Wittgenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179771