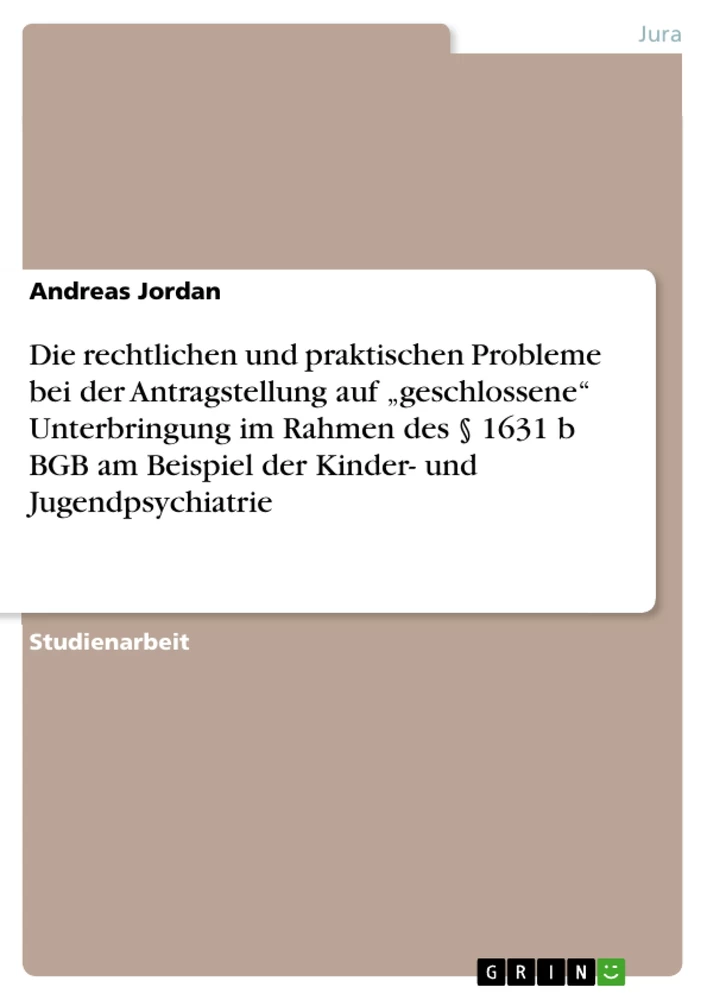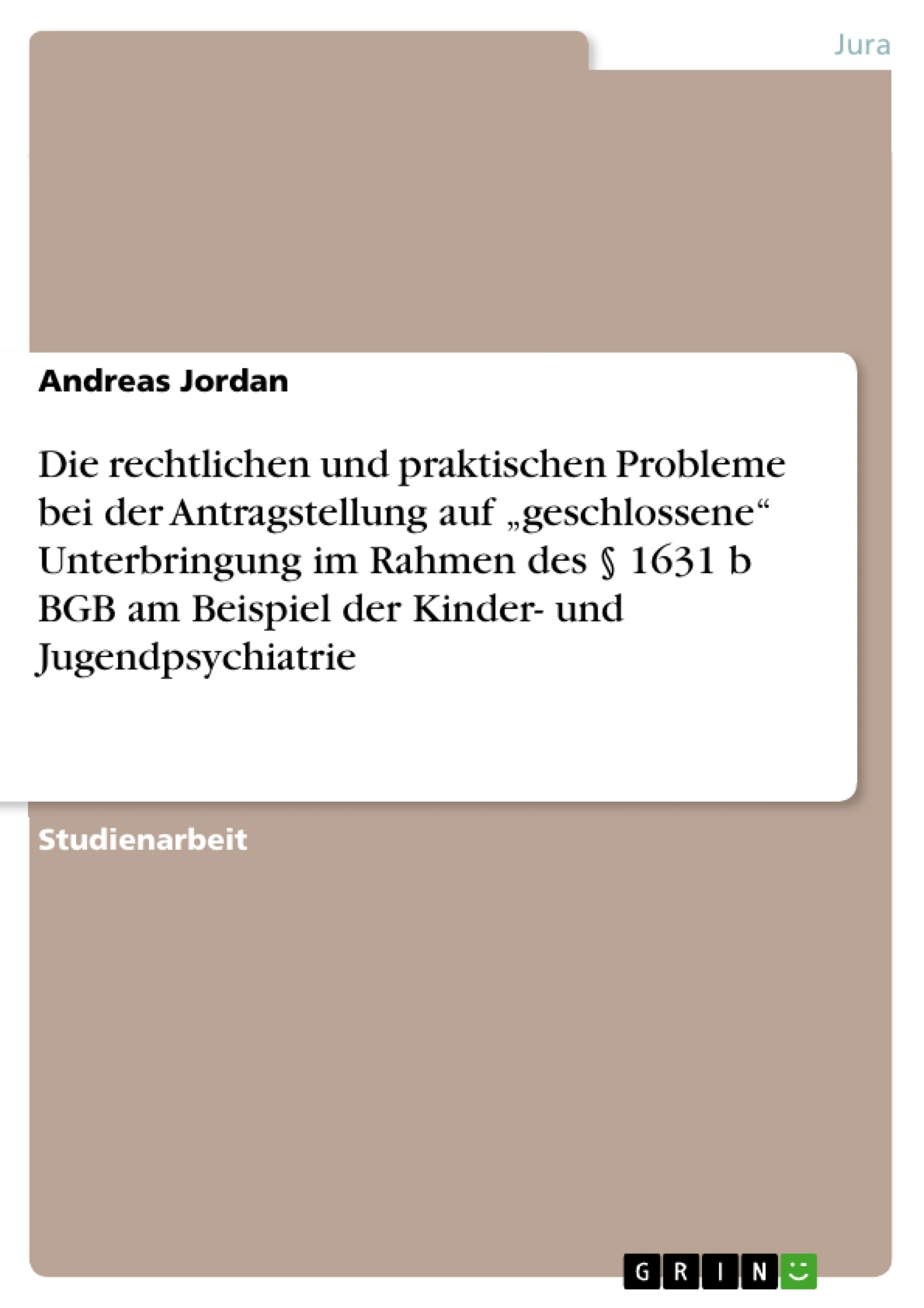In Deutschland wurden im Jahr 2005 genau 7383 Verfahren auf Genehmigung der Unterbringung eines Kindes geführt und 483 Verfahren auf Verlängerung der Unterbringung. Inwieweit alle Verfahren über einen korrekten Antrag eingeleitet wurden, kann den Zahlen allerdings nicht entnommen werden. Möglicherweise wurden viele Kinder und Jugendliche aufgrund falscher oder fehlender Anträge zu Unrecht in geschlossenen Abteilungen festgehalten. Aus diesem Grunde liegt der Schwerpunkt der Hausarbeit auf der Antragstellung. In der Hausarbeit soll die Frage untersucht werden, welche Personen einen Antrag auf Genehmigung der Unterbringung eines Kindes gemäß § 1631 b BGB stellen dürfen und welche formellen Voraussetzungen damit verknüpft sind. Außerdem sollen die praktischen Schwierigkeiten diskutiert werden, die mit der Antragstellung einhergehen und in vielen Fällen zu einer großen Rechtsunsicherheit führen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- I. Grundsätze der Freiheitsentziehung von Kindern und Jugendlichen i.S.d 1631b BGB
- 1. Gesetzgebungsverfahren
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Genehmigungsvorbehalt des Familiengerichts (§ 1631 b S. 1 BGB)
- 4. Kindeswohlgefährdung (§ 1631 b S. 2 BGB)
- 5. Nachträgliche Genehmigung (§ 1631 b S. 3 BGB)
- 6. Rücknahme der Genehmigung (§ 1696 Abs. 2 BGB)
- II. Der Antrag auf Unterbringung mit Freiheitsentzug i.S.d. § 1631 b BGB
- 1. Sorgeberechtigte stellen Antrag
- 2. Sorgeberechtigte sind sich nicht einig
- 3. Sorgeberechtigte sind nicht erreichbar
- 4. Sorgeberechtigte wollen keinen Antrag stellen
- 5. Antrag durch Dritte bei Kindeswohlgefährdung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die rechtlichen und praktischen Probleme im Zusammenhang mit der Antragstellung auf geschlossene Unterbringung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 1631b BGB im Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie analysiert die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsgrundlagen und beleuchtet die Herausforderungen, die sich im Umgang mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen, sowie deren Sorgeberechtigten stellen.
- Rechtsgrundlagen der geschlossenen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen
- Vergleich zwischen § 1631b BGB und Landes-PsychKG
- Rollen und Verantwortlichkeiten der Sorgeberechtigten
- Antragstellung und Verfahren bei Uneinigkeit der Sorgeberechtigten
- Praktische Schwierigkeiten bei der Antragstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der geschlossenen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein und benennt die zwei relevanten Rechtsgrundlagen: die Unterbringungsgesetze der Länder (PsychKG) und § 1631b BGB. Es wird der zentrale Unterschied zwischen beiden hervorgehoben: Während die Landesgesetze primär der Gefahrenabwehr dienen, liegt der Fokus von § 1631b BGB auf der Fürsorge für das Kind. Die Arbeit stellt die Frage nach dem Vorrang der einen oder anderen Rechtsgrundlage und verweist auf die Bedeutung von Art. 6 GG (natürliches Recht der Eltern zur Erziehung).
I. Grundsätze der Freiheitsentziehung von Kindern und Jugendlichen i.S.d 1631b BGB: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Freiheitsentziehung im Sinne des § 1631b BGB. Es untersucht das Gesetzgebungsverfahren, den Anwendungsbereich, den Genehmigungsvorbehalt des Familiengerichts, die Kindeswohlgefährdung als Voraussetzung, die Möglichkeit einer nachträglichen Genehmigung und die Rücknahme der Genehmigung. Der Fokus liegt auf der Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen und den damit verbundenen juristischen Interpretationsspielräumen.
II. Der Antrag auf Unterbringung mit Freiheitsentzug i.S.d. § 1631 b BGB: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Aspekten der Antragstellung auf geschlossene Unterbringung. Es analysiert verschiedene Konstellationen: den Antrag durch die Sorgeberechtigten, Situationen mit Uneinigkeit oder Unerreichbarkeit der Sorgeberechtigten, Fälle, in denen die Sorgeberechtigten keinen Antrag stellen wollen, und die Möglichkeit eines Antrags durch Dritte. Es beleuchtet die damit verbundenen rechtlichen und praktischen Herausforderungen und stellt die unterschiedlichen Vorgehensweisen dar.
Schlüsselwörter
§ 1631b BGB, Kinder- und Jugendpsychiatrie, geschlossene Unterbringung, Kindeswohlgefährdung, Sorgeberechtigte, Freiheitsentziehung, Genehmigung, Familiengericht, Unterbringungsgesetze der Länder (PsychKG), Art. 6 GG.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Antrag auf Unterbringung mit Freiheitsentzug nach § 1631b BGB
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen und praktischen Probleme im Zusammenhang mit der Antragstellung auf geschlossene Unterbringung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 1631b BGB in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie vergleicht § 1631b BGB mit Landes-PsychKG und beleuchtet Herausforderungen im Umgang mit betroffenen Kindern, Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten.
Welche Rechtsgrundlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht hauptsächlich § 1631b BGB und vergleicht ihn mit den Landes-PsychKG (Psychisch-Kranken-Gesetzen der Bundesländer). Es wird der Unterschied zwischen dem Fokus auf Gefahrenabwehr (Landes-PsychKG) und Fürsorge für das Kind (§ 1631b BGB) hervorgehoben, sowie die Bedeutung von Art. 6 GG (Recht der Eltern auf Erziehung).
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Einleitung: Einführung in das Thema, Vorstellung der relevanten Rechtsgrundlagen (§ 1631b BGB und Landes-PsychKG) und der zentralen Fragestellung. Kapitel I: Grundsätze der Freiheitsentziehung nach § 1631b BGB: Detaillierte Betrachtung der rechtlichen Grundlagen, inklusive Gesetzgebungsverfahren, Anwendungsbereich, Genehmigungsvorbehalt, Kindeswohlgefährdung, nachträgliche Genehmigung und Rücknahme der Genehmigung. Kapitel II: Antrag auf Unterbringung nach § 1631b BGB: Analyse verschiedener Antragskonstellationen (Sorgeberechtigte einig/uneinig/unerreichbar, Antrag durch Dritte) und der damit verbundenen Herausforderungen.
Wer kann einen Antrag auf Unterbringung stellen?
Grundsätzlich stellen die Sorgeberechtigten den Antrag. Die Arbeit betrachtet aber auch Fälle von Uneinigkeit oder Unerreichbarkeit der Sorgeberechtigten und die Möglichkeit eines Antrags durch Dritte, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.
Welche Voraussetzungen müssen für eine Unterbringung nach § 1631b BGB erfüllt sein?
Eine wesentliche Voraussetzung ist die Kindeswohlgefährdung. Das Kapitel I beschreibt detailliert die rechtlichen Anforderungen und die Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen.
Wie unterscheidet sich § 1631b BGB von den Landes-PsychKG?
Der Hauptunterschied liegt im Fokus: Landes-PsychKG dienen primär der Gefahrenabwehr, während § 1631b BGB den Schwerpunkt auf die Fürsorge für das Kind legt. Die Arbeit beleuchtet diesen Unterschied und die Frage nach dem Vorrang der jeweiligen Rechtsgrundlage.
Welche Rolle spielen die Sorgeberechtigten?
Die Sorgeberechtigten spielen eine zentrale Rolle bei der Antragstellung. Die Arbeit analysiert verschiedene Szenarien, darunter die Situation, wenn die Sorgeberechtigten uneinig sind, nicht erreichbar sind oder den Antrag nicht stellen wollen.
Welche praktischen Schwierigkeiten werden bei der Antragstellung behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die praktischen Herausforderungen bei der Antragstellung in verschiedenen Konstellationen, z.B. bei Uneinigkeit der Sorgeberechtigten oder wenn diese den Antrag nicht stellen wollen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
§ 1631b BGB, Kinder- und Jugendpsychiatrie, geschlossene Unterbringung, Kindeswohlgefährdung, Sorgeberechtigte, Freiheitsentziehung, Genehmigung, Familiengericht, Unterbringungsgesetze der Länder (PsychKG), Art. 6 GG.
- Citar trabajo
- Dipl.-Sozialpädagoge Andreas Jordan (Autor), 2011, Die rechtlichen und praktischen Probleme bei der Antragstellung auf „geschlossene“ Unterbringung im Rahmen des § 1631 b BGB am Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179738