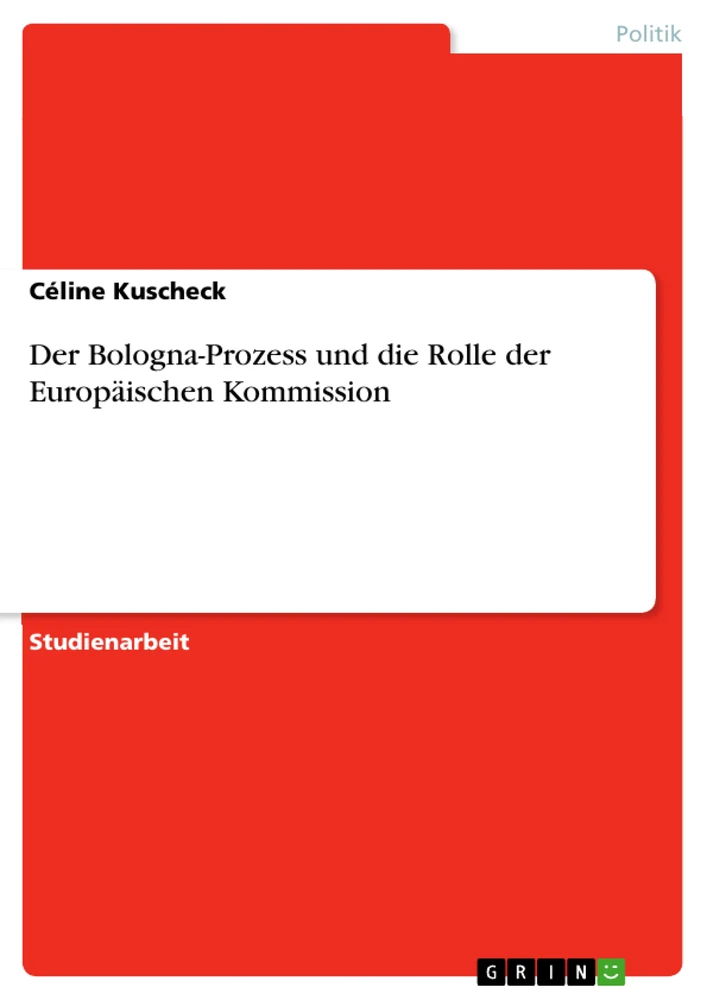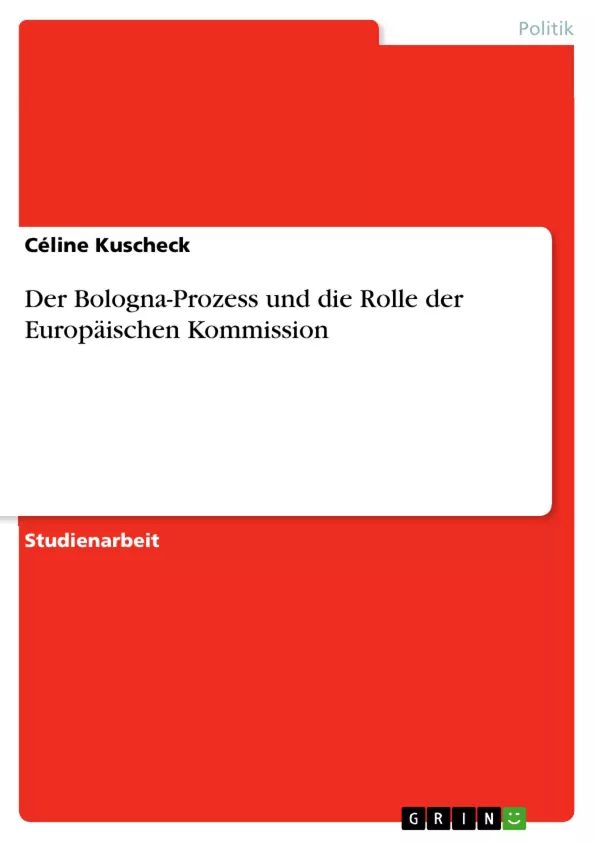Der Bologna-Prozess hat seit seiner Initiierung im Jahr 19981 durch die vier größten Mitgliedsländer der Europäischen Union2 für eine Reformwelle in der europäischen Hochschulpolitik gesorgt. Mittlerweile zählt dieser Prozess zu den bedeutendsten Reformen in der 900-jährigen Geschichte der europäischen Universität (Neave/Maassen zit. n. Bartsch 2009: 198).
Trotz des intergouvernementalen Charakters des Bologna-Abkommens „mischte sich die Europäische Kommission gleichwohl immer wieder in die […] Hochschulpolitik der Mitgliedstaaten ein“ (Martens/Wolf 2006: 153). Aufgrund der im EG-Vertrag festgesetzten Handlungsrestriktionen sowie dem Beharren der am Bologna-Prozess teilnehmenden Staaten auf ihrer bildungspolitischen Souveränität war der Europäischen Union eine koordinierende oder regulierende Rolle zunächst verwehrt (vgl. Becker/Primova 2009).
Erst das Ministertreffen in Prag 2001 führte zur Aufnahme der Kommission als vollwertiges Mitglied im intergouvernementalen Integrationsprozess, womit ihr als supranationalem Organ eine besondere Rolle zukommt. Die intergouvernementale Initiative gab der Europäischen Kommission eine enorme Bedeutung, heute gilt sie als treibende Kraft bei der Errichtung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes (Wolf/Martens 2006: 154).
Durch diese Überlegungen angeregt möchte die vorliegende Arbeit der Frage „Warum konnte die Europäische Kommission im Bologna-Prozesses an Einfluss gewinnen?“ systematisch nachgehen. Die hierfür aufgestellte Hypothese lautet: Die Absicht der den Bologna-Prozess initiierenden Länder, die Kommission zur Realisierung eigener Zwecke zu instrumentalisieren, führte zu ihrem Einflussgewinn3.
Die Relevanz der Fragestellung begründet sich darin, dass im Bereich der Europäischen Hochschulpolitik keine klassische Integration4 stattfindet, sondern neue Wege beschritten werden, um politischen Einfluss zu gewinnen (Bartsch 2009: 18). Ziel der Untersuchung ist es daher, anhand der Europäischen Hochschulreform als „Wendepunkt europäischer Hochschulpolitik“ (Walter 2006) und mittels der retrospektiven Rekonstruktion des Prozesses, den Einflusszuwachs der Europäischen Kommission – als Hauptakteur auf europäischer Ebene – herauszustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Akteurzentrierter Institutionalismus
- 3. Der Bologna-Prozess und die Rolle der Europäischen Kommission
- 3.1 Institutioneller Kontext
- 3.1.1 Initiierende Länder
- 3.1.2 Europäische Kommission
- 3.2 Akteure
- 3.2.1 Initiierende Länder
- 3.2.2 Europäische Kommission
- 3.3 Akteurkonstellation
- 3.4 Interaktionsformen
- 3.4.1 Sorbonne-Erklärung
- 3.4.2 Bologna-Erklärung
- 3.4.3 Lissabon-Strategie
- 3.4.4 Prag Kommunikee 2001
- 3.4.5 Berlin Kommunikee 2003
- 3.4.6 Bergen Kommunikee 2005
- 3.4.7 London Kommunikee 2007
- 3.4.8 Leuven Kommunikee 2009
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, warum die Europäische Kommission im Bologna-Prozess an Einfluss gewinnen konnte. Sie untersucht den Einflusszuwachs der Europäischen Kommission im Kontext der Europäischen Hochschulreform und analysiert die Hintergründe und Mechanismen, die zu diesem Wandel führten.
- Die Rolle der Europäischen Kommission im Bologna-Prozess
- Der Einflusszuwachs der Europäischen Kommission im Bereich der Hochschulpolitik
- Die Bedeutung des Akteurzentrierten Institutionalismus für die Analyse des Bologna-Prozesses
- Die Interaktionsformen und Konstellationen im Bologna-Prozess
- Die Rolle der Initiierenden Länder und deren Einfluss auf die Europäische Kommission
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Bologna-Prozess und die Rolle der Europäischen Kommission in diesem Kontext vor. Sie definiert die Fragestellung und die Hypothese der Arbeit sowie die Relevanz der Untersuchung. Das zweite Kapitel beschreibt den analytischen Rahmen des Akteurzentrierten Institutionalismus, der zur Analyse des Bologna-Prozesses verwendet wird. Das dritte Kapitel bildet den Hauptteil der Untersuchung. Es analysiert die institutionellen und akteurbezogenen Aspekte des Bologna-Prozesses und beleuchtet die Interaktionsformen und die Rolle der Europäischen Kommission in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Der Bologna-Prozess, Europäische Kommission, Akteurzentrierter Institutionalismus, Europäische Hochschulpolitik, Einflussgewinn, intergouvernementale Integration, supranationale Organisation, Mehrebenenpolitik, Sorbonne-Erklärung, Bologna-Erklärung, Lissabon-Strategie.
Häufig gestellte Fragen zum Bologna-Prozess und der EU-Kommission
Warum gewann die Europäische Kommission im Bologna-Prozess an Einfluss?
Obwohl der Prozess intergouvernemental startete, instrumentalisierte die Kommission ihn zur Realisierung eigener Ziele und wurde durch Ministertreffen (z.B. Prag 2001) als vollwertiges Mitglied aufgenommen.
Was ist der Bologna-Prozess?
Eine 1998/1999 initiierte Reform zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums mit vergleichbaren Abschlüssen (Bachelor/Master).
Welche Rolle spielt der „Akteurzentrierte Institutionalismus“?
Dieser Theorieansatz dient in der Arbeit als Rahmen, um das Handeln der beteiligten Akteure (Staaten, Kommission) innerhalb der institutionellen Regeln zu analysieren.
Was war die Bedeutung der Lissabon-Strategie?
Die Lissabon-Strategie verknüpfte Bildungspolitik mit wirtschaftlichen Zielen (Wettbewerbsfähigkeit), was der Kommission neue Argumente für eine stärkere Koordinierung lieferte.
Ist die Hochschulpolitik eine Kernkompetenz der EU?
Nein, die Bildungshoheit liegt primär bei den Mitgliedstaaten; daher nutzt die EU neue Wege der Koordination jenseits klassischer Gesetzgebung.
- Arbeit zitieren
- B.A. Céline Kuscheck (Autor:in), 2011, Der Bologna-Prozess und die Rolle der Europäischen Kommission, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179607