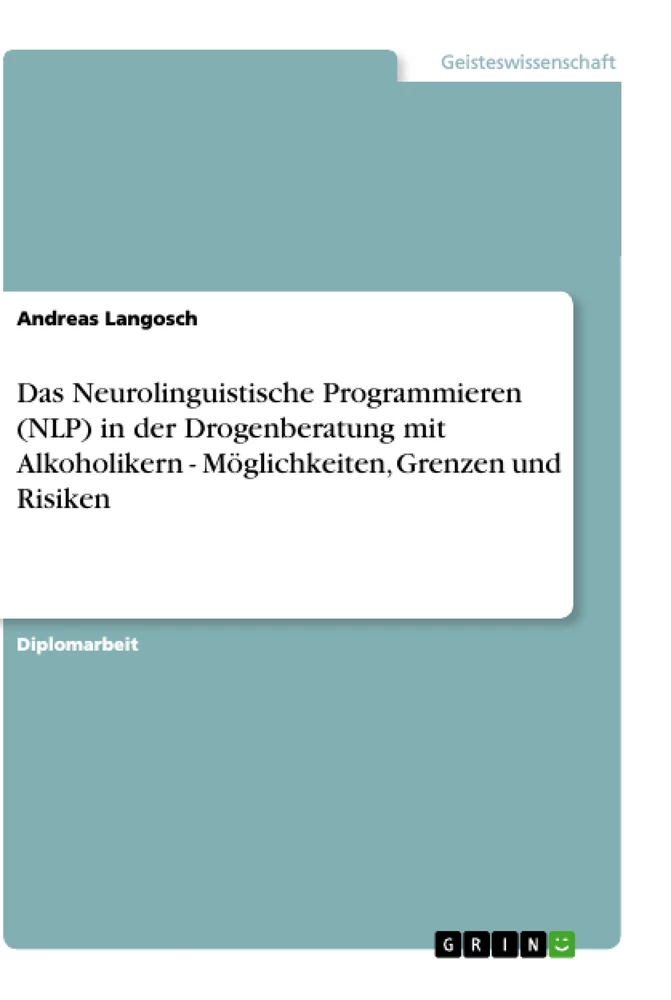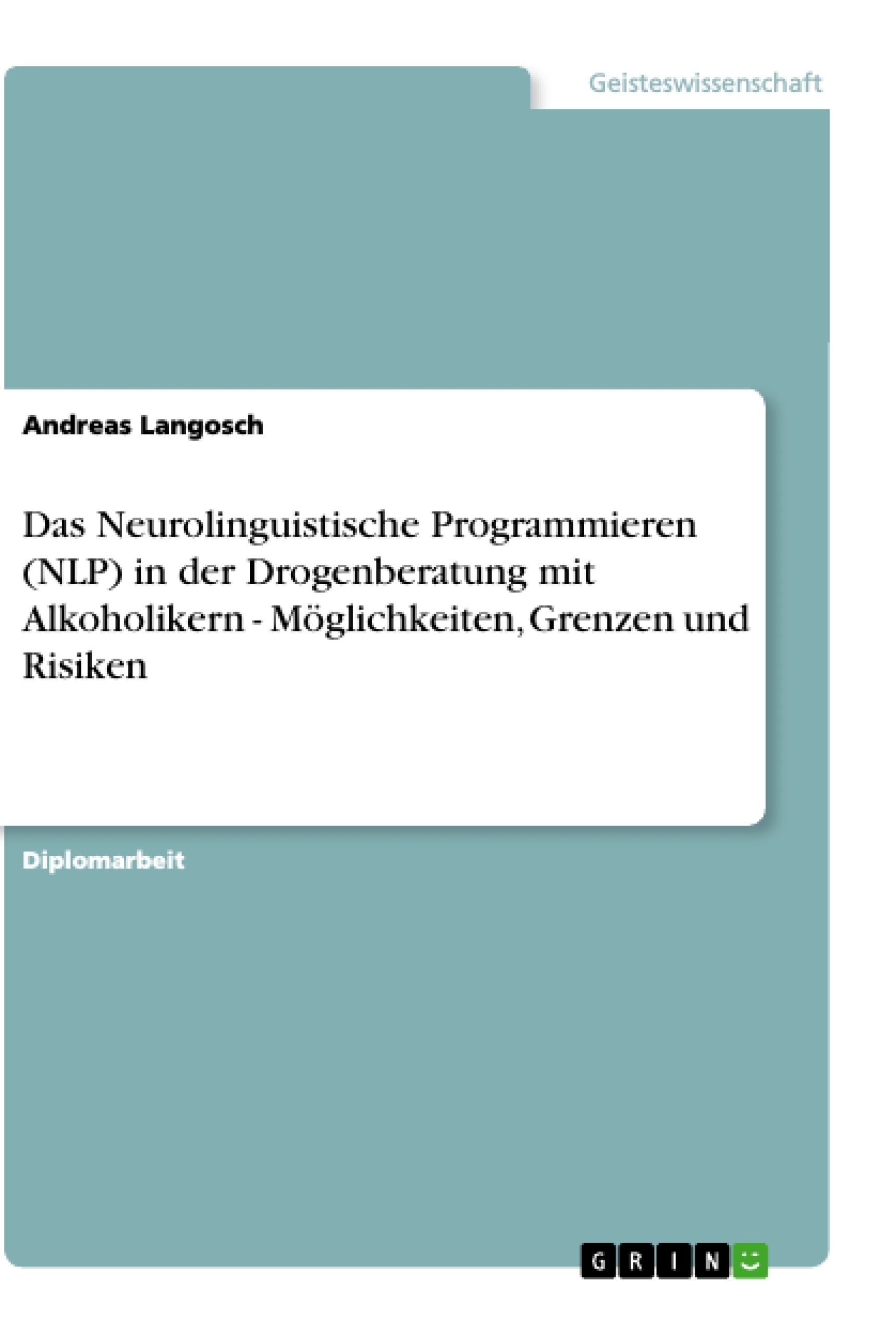Seit dem Beginn seiner Entstehung am Anfang der Neunzehnhundertsiebziger Jahre hat sich das Neurolinguistische Programmieren (NLP) weit verbreitet. In vielen Ländern der Welt wird es inzwischen in den unterschiedlichsten Bereichen angeboten und genutzt. Seine Anwendungsgebiete reichen von der Therapie über die Pädagogik bis zum Wirtschaftsleben. Einer der möglichen Gründe für den Erfolg des NLP könnte in der von ihm vertretenen Grundannahme liegen, dass jedes Verhalten in einem bestimmten Kontext nützlich sei. Auf diesem Gedanken aufbauend wird manches Problem zum Ausgangspunkt für Versöhnung mit problematischen Verhaltensweisen und für die Suche nach Handlungsalternativen - eine Einstellung, die auch für die Drogenberatung mit Alkoholikern nützlich sein könnte. Schaut man sich diesen Arbeitsbereich jedoch genauer an, stellt man fest, dass das NLP hier wenig genutzt wird. Diese Beobachtung wirft die Frage auf, ob es für die Drogenberatung mit Alkoholikern ungeeignet sei. Dieser Hypothese wird in dieser Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 mit Hilfe der Analyse der Möglichkeiten, Grenzen und Risiken der Anwendung des NLP in diesem Bereich nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschiedene Ansichten zum Thema
- Die Ansichten der mit Suchtfragen befaßten Verbände
- Die Ansichten der Drogenberatungsstellen
- Die Ansichten der NLP-Ausbildungsinstitutionen
- Die Ansichten einer Rehaklinik für Alkoholkranke, Medikamenten- und Drogenabhängige
- Schlußfolgerungen
- Die Erfordernisse der Drogenberatung mit Alkoholikern
- Die Aufgaben der Drogenberatung als Teil der Behandlungskette
- Besonderheiten in der Gesprächsführung mit Alkoholikern
- Schlußfolgerungen
- Das Angebot des NLP an die Drogenberatung mit Alkoholikern
- Theoretische Grundlagen: Die Anker-Theorie des NLP und der Alkoholismus
- Alkoholkonsum als Reaktion
- Alkoholkonsum als Anker
- Möglichkeiten, Grenzen und Risiken ausgewählter Orientierungen, Muster und Techniken des NLP in der Drogenberatung mit Alkoholikern
- Physiologie-Kategorien und gezielte Außenwahrnehmung als Orientierungshilfen
- Das Meta-Modell (nach BANDLER/GRINDER) und das Modell der (Neuro-)Logischen Ebenen (nach DILTS) als Hilfsmittel bei der Erforschung des Selbst- und Weltbildes des Klienten
- Das Milton-Modell (nach BANDLER/GRINDER) und die Verwendung von Metaphern
- Die Metapher vom Bio-Computer als möglicher Einstieg ins Ankläger-Opfer-Retter-Spiel
- Die NLP-Welt der Sinne: Repräsentationssysteme und Submodalitäten
- Zur Zielorientierung im NLP: Das Reframing, der Identity-Prozeß und die Wohlgeformtheitskriterien für Zieldefinitionen
- Theoretische Grundlagen: Die Anker-Theorie des NLP und der Alkoholismus
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) in der Drogenberatung mit Alkoholikern. Ziel ist es, die Möglichkeiten, Grenzen und Risiken dieser Methode zu analysieren und deren Eignung für diesen Kontext zu bewerten. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen des NLP und praktischen Erfahrungen aus einem Praktikum in einer Drogenberatungsstelle.
- Anwendbarkeit von NLP-Techniken in der Drogenberatung
- Analyse der Anker-Theorie im Kontext des Alkoholismus
- Bewertung von NLP-Modellen (Meta-Modell, Logische Ebenen, Milton-Modell) in der therapeutischen Praxis
- Rollen von Repräsentationssystemen und Submodalitäten
- Zielorientierung im NLP und deren Relevanz für die Alkoholberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung des NLP in der Drogenberatung mit Alkoholikern. Sie beschreibt die Verbreitung des NLP und seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, erwähnt die Grundannahme des NLP und die Beobachtung, dass es in der Alkoholberatung wenig genutzt wird. Der Autor kündigt seine Methode an, die Möglichkeiten, Grenzen und Risiken der Anwendung zu analysieren, und verweist auf die Einbeziehung eigener praktischer Erfahrungen aus einem Drogenberatungspraktikum.
Verschiedene Ansichten zum Thema: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Erhebung zu den verschiedenen Ansichten von Suchtverbänden, Drogenberatungsstellen, NLP-Ausbildungsinstitutionen und einer Rehaklinik zum Thema NLP in der Alkoholberatung. Es wird ein Vergleich der Perspektiven durchgeführt und daraus Schlussfolgerungen gezogen, um den aktuellen Kenntnisstand über die Akzeptanz und Anwendung von NLP in diesem Bereich zu beleuchten. Die verschiedenen Standpunkte bilden die Grundlage für die spätere Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen des NLP.
Die Erfordernisse der Drogenberatung mit Alkoholikern: Dieses Kapitel beschreibt die Aufgaben der Drogenberatung im Kontext der Behandlungskette und hebt die Besonderheiten der Gesprächsführung mit Alkoholikern hervor. Es analysiert den Umgang mit der "Trinker-Logik", dem Alkohol als Selbstheilungs- oder Selbstzerstörungsmittel und beleuchtet den Weg von spielerischen Phasen hin zu Krankheitsbewusstsein. Die Schlussfolgerungen dieses Kapitels betonen die Komplexität der Problematik und die Anforderungen an eine effektive Beratung.
Das Angebot des NLP an die Drogenberatung mit Alkoholikern: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen des NLP, insbesondere die Anker-Theorie, vor und diskutiert deren Relevanz für die Behandlung von Alkoholismus. Es beschreibt verschiedene NLP-Techniken wie die Arbeit mit Repräsentationssystemen, Submodalitäten, dem Meta-Modell, den Logischen Ebenen und dem Milton-Modell. Die Anwendung dieser Techniken in der Alkoholberatung wird beleuchtet, einschließlich der Metapher vom Bio-Computer, um die Komplexität und die verschiedenen Ebenen der Problematik zu erfassen. Der Abschnitt zur Zielorientierung im NLP betont die Bedeutung von Reframing und Wohlgeformtheitskriterien für die Zielsetzung im therapeutischen Prozess.
Schlüsselwörter
Neurolinguistisches Programmieren (NLP), Drogenberatung, Alkoholismus, Anker-Theorie, Meta-Modell, Logische Ebenen, Milton-Modell, Repräsentationssysteme, Submodalitäten, Reframing, Zielorientierung, Gesprächsführung, Behandlungskette.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Neurolinguistisches Programmieren (NLP) in der Drogenberatung mit Alkoholikern
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendung des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) in der Drogenberatung mit Alkoholikern. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten, Grenzen und Risiken dieser Methode und der Bewertung ihrer Eignung in diesem Kontext.
Welche Aspekte des NLP werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene NLP-Techniken wie die Anker-Theorie, das Meta-Modell, die Logischen Ebenen, das Milton-Modell, die Arbeit mit Repräsentationssystemen und Submodalitäten, Reframing und die Zielorientierung im NLP. Die Anwendung dieser Techniken in der Alkoholberatung wird detailliert beschrieben und analysiert.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den theoretischen Grundlagen des NLP, insbesondere der Anker-Theorie. Sie bezieht sich auf die Modelle von Bandler/Grinder (Meta-Modell, Milton-Modell) und Dilts (Logische Ebenen).
Welche praktischen Erfahrungen fließen in die Arbeit ein?
Die Arbeit integriert praktische Erfahrungen aus einem Praktikum in einer Drogenberatungsstelle. Diese Erfahrungen dienen der Illustration und Bewertung der theoretischen Konzepte.
Welche verschiedenen Perspektiven werden betrachtet?
Die Arbeit berücksichtigt die Ansichten von Suchtverbänden, Drogenberatungsstellen, NLP-Ausbildungsinstitutionen und einer Rehaklinik für Alkoholkranke, um ein umfassendes Bild der Akzeptanz und Anwendung von NLP in der Alkoholberatung zu erhalten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu verschiedenen Ansichten zum Thema, ein Kapitel zu den Erfordernissen der Drogenberatung mit Alkoholikern, ein Kapitel zum Angebot des NLP in der Drogenberatung mit Alkoholikern und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel beinhaltet Schlussfolgerungen und Zwischenzusammenfassungen.
Wie wird die Anker-Theorie im Kontext des Alkoholismus behandelt?
Die Arbeit analysiert die Anker-Theorie des NLP im Kontext des Alkoholismus, indem sie Alkoholkonsum als Reaktion und als Anker betrachtet und die Implikationen für die therapeutische Intervention diskutiert.
Welche Rolle spielen Repräsentationssysteme und Submodalitäten?
Die Arbeit betont die Rolle von Repräsentationssystemen und Submodalitäten im NLP und deren Anwendung in der Alkoholberatung zur besseren Erfassung und Bearbeitung der Klientenerfahrungen.
Wie wird die Zielorientierung im NLP behandelt?
Die Arbeit diskutiert die Bedeutung von Reframing und Wohlgeformtheitskriterien für die Zielsetzung im therapeutischen Prozess und deren Relevanz für die Alkoholberatung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Anwendbarkeit, den Grenzen und Risiken des NLP in der Drogenberatung mit Alkoholikern, basierend auf der theoretischen Analyse und den praktischen Erfahrungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neurolinguistisches Programmieren (NLP), Drogenberatung, Alkoholismus, Anker-Theorie, Meta-Modell, Logische Ebenen, Milton-Modell, Repräsentationssysteme, Submodalitäten, Reframing, Zielorientierung, Gesprächsführung, Behandlungskette.
- Quote paper
- Andreas Langosch (Author), 1997, Das Neurolinguistische Programmieren (NLP) in der Drogenberatung mit Alkoholikern - Möglichkeiten, Grenzen und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179544