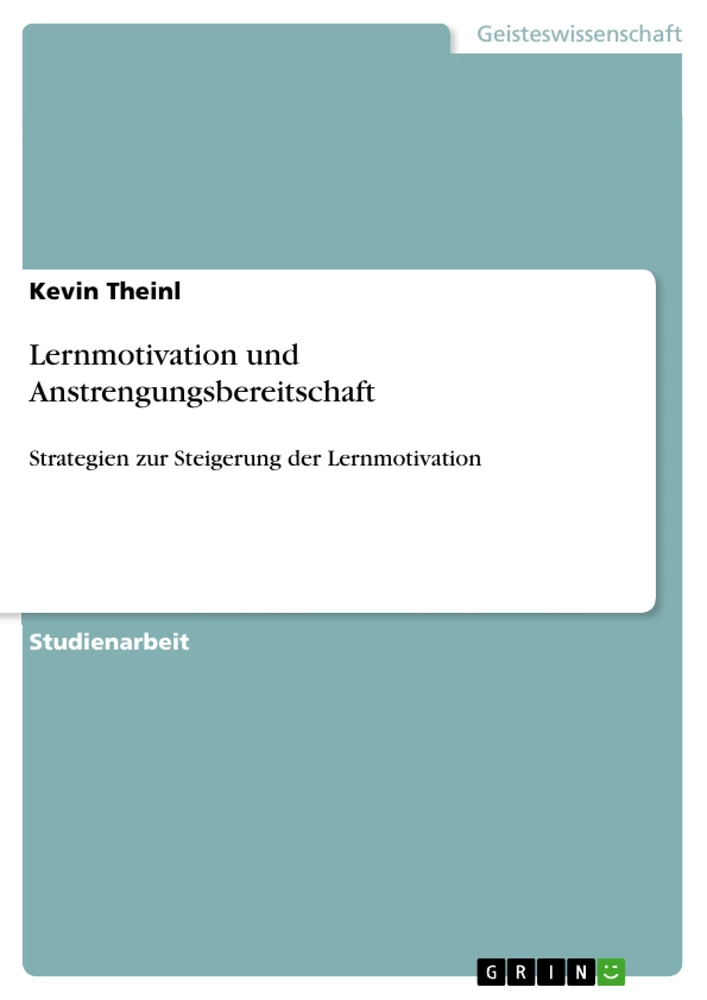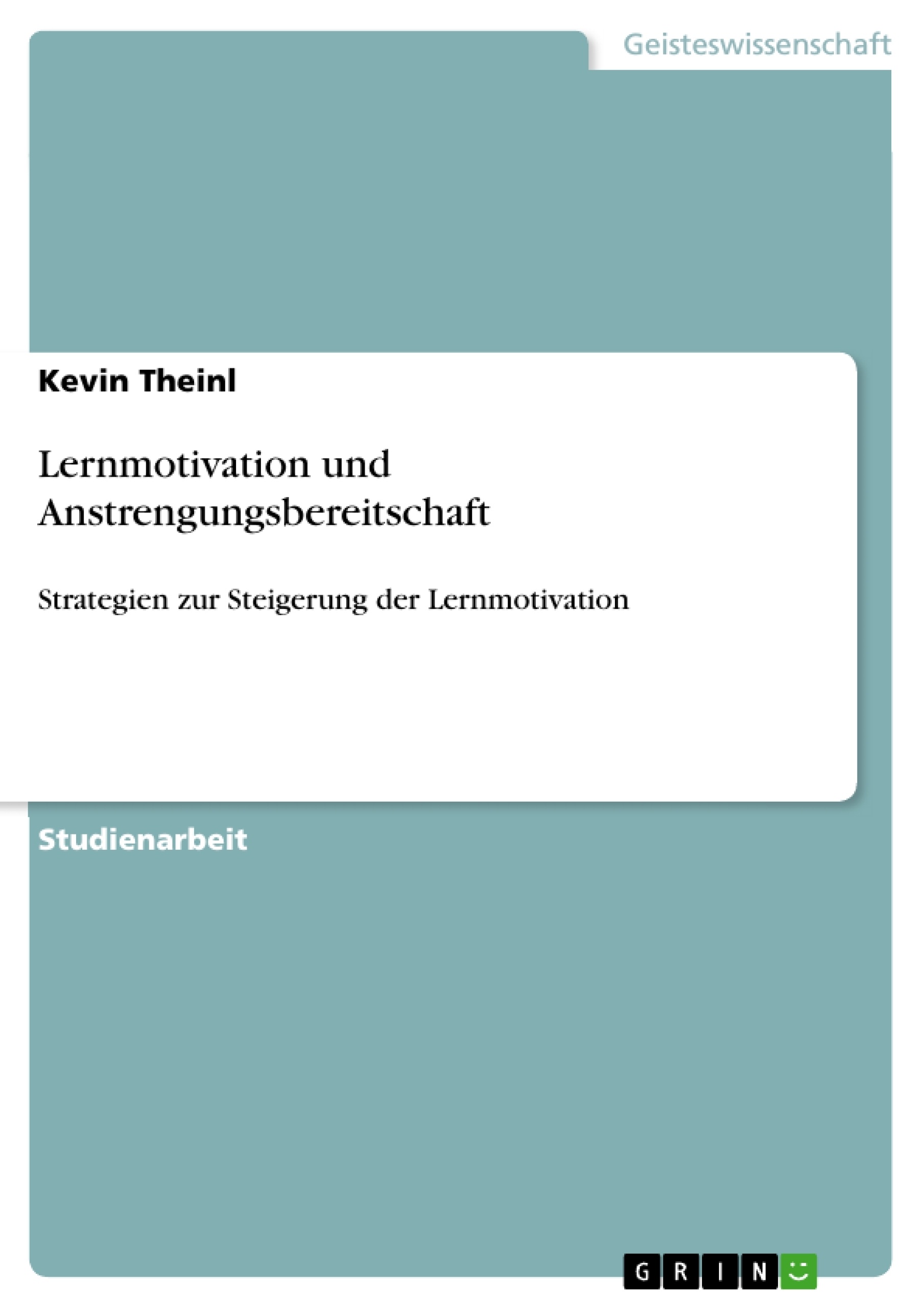1. Einleitung
Hauptaufgabe des erzieherischen Handelns ist es, Fähigkeiten und Wissensstrukturen der Schüler zu schaffen, aufzubauen und langfristig zu fördern. Dies ist allerdings ohne Motivation nicht möglich, und daher hat der Lehrer die Aufgabe die Lernmotivation langfristig zu steigern und weitgehend alle Schüler in den Lernprozess mit einzubeziehen. Da vielen Schülern der Antrieb fehlt auf ein Ziel hingerichtet zu lernen, ist es wichtig auf verschiedene Strategien zurückzugreifen, welche die Zielorientierung der Schüler steigert. In meiner folgenden Arbeit werde ich auf einen Vergleich der kurzfristigen und längerfristigen Wirkungsdauer von Motivation eingehen, und förderliche Bedingungen einer längerfristigen Wirksamkeit von Verstärkerprogrammen aufzeigen. Außerdem zeige ich Möglichkeiten zur Steigerung der Motivation von Schülern in verschiedenen Situationen auf, die durch die individuelle Bezugsnorm erreicht werden sollen. Des Weiteren werde ich den Weg, der von der Anstrengungsbereitschaft über die Anstrengungsrealisierung bis hin zur Erhaltung der Anstrengung gegangen werden muss, näher beleuchten und Gründe für engagierte Anstrengungsbereitschaft herausstellen. Abschließend gehe ich noch einmal zusammenfassend in einer Schlussfolgerung darauf ein, inwiefern sich Motivation und Anstrengungsbereitschaft im Schulkontext steigern lässt.
Gliederung
1. Einleitung
2. Strategien zur Steigerung der Lernmotivation
2.1. kurzfristige Wirkungsdauer von Motivation vs. längerfristige Wirkungsdauer von Motivation
2.2. Förderliche Bedingungen einer längerfristigen Wirksamkeit von Verstärkerprogrammen
2.3. Steigerung der Motivation in verschiedenen Situationen durch die individuelle Bezugsnorm
3. Anstrenungsbereitschaft
3.1. Von der Anstrengungsbereitschaft zur Erhaltung von Anstrengung
3.2. Gründe für engagierte Anstrengungsbereitschaft
4. Schlussfolgerung: Förderung der Motivation und Anstrengungsbereitschaft im Schulkontext
5. Bibliographie
1. Einleitung
Hauptaufgabe des erzieherischen Handelns ist es, Fähigkeiten und Wissensstrukturen der Schüler zu schaffen, aufzubauen und langfristig zu fördern. Dies ist allerdings ohne Motivation nicht möglich, und daher hat der Lehrer die Aufgabe die Lernmotivation langfristig zu steigern und weitgehend alle Schüler in den Lernprozess mit einzubeziehen. Da vielen Schülern der Antrieb fehlt auf ein Ziel hingerichtet zu lernen, ist es wichtig auf verschiedene Strategien zurückzugreifen, welche die Zielorientierung der Schüler steigert. In meiner folgenden Arbeit werde ich auf einen Vergleich der kurzfristigen und längerfristigen Wirkungsdauer von Motivation eingehen, und förderliche Bedingungen einer längerfristigen Wirksamkeit von Verstärkerprogrammen aufzeigen. Außerdem zeige ich Möglichkeiten zur Steigerung der Motivation von Schülern in verschiedenen Situationen auf, die durch die individuelle Bezugsnorm erreicht werden sollen. Des Weiteren werde ich den Weg, der von der Anstrengungsbereitschaft über die Anstrengungsrealisierung bis hin zur Erhaltung der Anstrengung gegangen werden muss, näher beleuchten und Gründe für engagierte Anstrengungsbereitschaft herausstellen. Abschließend gehe ich noch einmal zusammenfassend in einer Schlussfolgerung darauf ein, inwiefern sich Motivation und Anstrengungsbereitschaft im Schulkontext steigern lässt.
2. Strategien zur Steigerung der Lernmotivation
2.1. Kurzfristige Wirkungsdauer von Motivation vs. Längerfristige Wirkungsdauer von Motivation
Zur Steigerung der Motivation kann zum Einen auf eine kurzfristige Wirkungsdauer und zum Anderen auf eine längerfristige Wirkungsdauer zurückgegriffen werden. Nur sehr kurzfristig aufrechtzuerhalten wäre es, den Schüler für die Ausführung oder das Unterlassen einer Tätigkeit zu belohnen. Zum Beispiel gelang es durch das Belohnen von positivem Meldeverhalten oder aktiver Mitarbeit der Schüler am Unterricht, ein angestrebtes Verhalten kurzzeitig zu erreichen. Ebenso hatte eine Nachsichtigkeit der Schüler ein unerwünschtes Verhalten einzustellen, gleichermaßen eine Belohnung zur Folge. Das Problem hierbei ist, dass sich die positiven Effekte der kurzfristigen Verhaltenskontrolle einstellen, sobald kein Verstärker mehr verwendet wird. Um das angestrebte Verhalten jedoch längerfristig zu erhalten müssen Stimulus- und Konsequenzbedingungen dauerhaft geändert werden. Hierbei ist es möglich das Kontrakt-Management für den Unterricht nutzbar zu machen. Der Lehrer vereinbart mit den Schülern einen Vertrag auf schriftlicher Basis, der von den Schülern angenommen und unterzeichnet wird. Der Vertrag beinhaltet Erwartungen des Lehrers an die Verhaltensweisen der Schüler für das jeweilige Fach, und zeigt außerdem die bei Nichteinhalten des Vertrages resultierende Konsequenzen auf. Jedoch ist von großer Bedeutung die Schüler gelgentlich an den bestehenden Vertrag zu erinnern, um das positive Verhalten aufrecht zu erhalten.[1]
2.2. Förderliche Bedingungen einer längerfristigen Wirksamkeit von Verstärkerprogrammen
Wirken Verstärkerprogramme überdauernd, können sich einige förderlichen Effekte herausstellen, sodass der Schüler Erfahrungen macht und zu Erlebnissen kommt, dass eine weitere Motivation von außen nicht mehr notwendig ist. Der Verstärker könnte zum Einen als Initialzündung wirken und den Schüler dazu anregen, sich weiterhin mit einem Thema zu beschäftigen und dies selbst zu seinen Interessengebieten zu zählen. Allerdings führen bestimmte Verstärker erst bei einem sicheren Beherrschungsgrad zu positiven Effekten, wie zum Beispiel beim Erlernen eines Musikinstruments oder bei einer Mitgliedschaft in einem Sportverein. Hier kann sich ein Kind, bzw. ein Jugendlicher zu Beginn unwohl fühlen, da er im Vergleich zu anderen Lernern die erforderten Fähigkeiten noch nicht erworben hat. Daher ist es notwendig den Lernenden zu motivieren, bis sich Leistungsfortschritte zeigen, die ihn erkennen lassen, dass er zunehmend persönliche Erfolge erzielt. Der abschreckende Charakter wurde somit verloren und der Schüler motiviert sich ab diesem Zeitpunkt selbst, sodass von Außen keine Motivation mehr notwendig ist. Es wäre nur denkbar, dass Leistungsschwankungen demotivierend wirken können, und demzufolge sollte zwischendurch motiviert werden, damit das Kind oder der Jugendliche von Gedanken des Aufgebens abgebracht wird. Ziel des Motivationstraining ist es, Schülern den Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Anstrengung und Leistung aufzuzeigen, die bei einer realistischen Zielsetzung zu einem für den Schüler positiven Ergebnis führt.[2]
2.3. Steigerung der Motivation in verschiedenen Situationen durch die individuelle Bezugsnorm
Durch die Verwirklichung einer individuellen Bezugsnorm-Orientierung kann der Lehrer den einzelnen Schüler in verschiedenen Situationen des Unterrichts motivieren. Wenn Aufgaben im mündlichen Unterricht gestellt werden muss es das Ziel des Lehrers sein, den einzelnen Schüler zu fordern, ihn aber weder zu über- noch zu unterfordern. Im Falle des Erfolgs sollte er dem einzelnen Schüler weitere Möglichkeiten aufzeigen, die zum Fortschritt seiner Leistung beitragen. Potentielle Reaktionen wären hier die Erweiterung von Fragen, das Differenzieren und die Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Wird die angestrebte Leistung nicht erzielt, sollte der Lehrer dem Schüler durch eine Neuformulierung der Frage oder durch Zusatzhilfen wie Hinweisen oder Stichworten die richtige Antwort trotzdem ermöglichen. Oftmals mag es auch sinnvoll sein, dem Schüler mehr Zeit zum Nachdenken zu geben.
Wenn es eine Rückführung zur Ursache eines Resultats bedarf, sollte die Lehrkraft versuchen das Vertrauen des Schülers in die eigene Anstrengung zu stärken. Bei zu geringem Einsatz sollte nicht die Fähigkeit des Schülers bezweifelt werden, sondern versucht werden zu verdeutlichen, dass eine weitere Leistungssteigerung durch mehr Aufmerksamkeit und die daraus resultierende bessere Mitarbeit möglich sei.
Leistungsrückmeldungen werden in der individuellen Bezugsnorm mit Lob bei einer Leistungssteigerung gesteuert, die durch eine intensive Anstrengung erfolgt. Bei Misserfolg sollte eine neutrale Rückmeldung gegeben werden oder Unzufriedenheit geäußert werden. Allerdings sollte davon abgesehen werden ausdrücklichen Tadel auszusprechen, da Schüler dadurch entmutigt werden könnten.
Der Lehrer sollte ebenso seine Erwartungsäußerungen deutlich erkennbar machen, indem er klarstellt, dass er bei einer angemessenen Anstrengung mit einer Leistungssteigerung rechnet. Bei Erfolg könnten weitere mögliche Lernzuwächse aufgezeigt werden, wobei eindeutig betont werden muss, dass es ein Zuwachs der Leistung nur durch den eigenen Antrieb möglich sei. Auch bei Mißerfolg ist es wichtig, dem Schüler das Gefühl von Vertrauen zu geben. Hier wäre es wichtig, dass man auch trotz schlechter Leistungen dem Schüler den Eindruck vermittelt, dass ihm die richtige Antwort noch zugetraut wird. Somit wird er sich Mühe geben die richtige Lösung einer Aufgabe zu suchen, bzw. über den Lösungsweg intensiver nachzudenken.
Im Vergleich zur sozialen Bezugsnorm, die sinnvoll ist, um die leistungsstarken und leistungsschwachen Schüler herauszufiltern, ist die individuelle Bezugsnorm dadurch gekennzeichnet, dass sie den einzelnen Schüler fordert und besonders auf Leistungssteigerungen und Leistungsabfälle eingeht. Die soziale Bezugsnorm schafft ein gleiches Angebot für alle Schüler, reagiert mit Lob auf überdurchschnittliche Leistungen und motiviert den schlechten Schüler nicht, weiterhin Versuchungen anzustellen, die ihn zu einem guten Ergebnis führen könnten. Der Lehrer attribuiert zwischen Begabung und Leistungsfortschritt und demotiviert somit schlechtere Schüler, die erkennen, dass sie diese Begabung nicht besitzen und somit keine Leistungsfortschritte erzielen können. Durch wiederholten Misserfolg tritt Lernpessimismus ein, was zu geringem Selbstvertrauen und einer Schwächung der Persönlichkeit führt. [3]
3. Anstrengungsbereitschaft
3.1. Von der Anstrengungsbereitschaft zur Erhaltung von Anstrengung
Das menschliche Handeln basiert auf dem Erfahrungshintergrund: „Ohne Fleiß kein Preis“, worauf alle Lern- und Entwicklungsfortschritte bezogen sind. Jedoch wird Anstrengung oft mit etwas Unangenehmen verbunden und der Mensch neigt dazu ein Ziel mit dem geringsten Aufwand zu erreichen.
Zu Beginn aller Anstrengung steht die Anstrengungsbereitschaft eines Individuums, welches von sich aus bereit sein muss, sich für ein bestimmtes Ziel anzustrengen. Allerdings ist es nicht genug nur bereit zu sein sich anstrengen zu wollen. Der wichtige Schritt von der Anstrengungsbereitschaft zur Anstrengungsrealisierung muss von jedem Individuum selbst gegangen werden. Vorhaben dürfen nicht bei einfachen Lippenbekenntnissen bleiben, sondern müssen konkret umgesetzt werden. Hierbei ist es wichtig sich konkrete Ziele zu setzen, die erreichbar sind, also dem individuellen Leistungsniveau angepasst sind. Eine Aufgabe sollte ein mittelschweres Ziel haben, das fordernd, aber nicht über- oder unterfordernd ist. Realistische Aufgabenstellungen wirken besonders motivierend, während ein zu leichtes Ziel langweilen und ein zu schwierig erreichbares Ziel den einzelnen Schüler entmutigen oder frustrieren kann.
Wichtig zu beachten ist es, dass bei Zielen, die weit entfernt liegen, Zwischenziele gesetzt werden. Die Anstrengung wird besonders dann aufrechterhalten, wenn Zwischenziele erreicht werden, da diese „kleinen“ Erfolge motiverend wirken können und den Schüler ermutigen sich weiterhin anzustrengen. Für den Schüler ist es vorteilhaft Anstrengungs-Kompetenz zu besitzen, sodass er sich selbst motivieren und überprüfen kann, und somit nicht auf eine dauerhafte Motivation durch andere Personen angewiesen ist. Sinnvoll ist es, dass Erreichen eines Zwischenziels zu evaluieren und sich zu fragen, ob man mit der eigenen Anstrengung zufrieden ist, ob man seine eigenen Erwartungen erfüllt hat und mit welchen Anstrengungsfortschritten man selbst rechnet, die zu besseren Ergebnissen führen. Hier ist es wichtig, dass der Lehrer überzogene Anspruchshaltungen abbaut und den Schüler dabei hilft sich realistische Ziele zu setzen. Erst dann ist es möglich für sich selbst das beste Ergebnis zu erzielen, welches dann zur Steigerung in das eigene Vertrauen führt. Diese Überzeugung in sich selbst und ein starkes Streben nach dem bestmöglichsten Ergebnis mit Hinblick auf das absolute Ziel können auch zum „Flow-Erleben“ führen, welches eine Phase der selbstvergessenen Arbeit an einer Aufgabe beschreibt. Somit werden in unserer reizüberfluteten Welt mögliche Ablenkungen und Hindernisse von Außen ausgeblendet.[4]
[...]
[1] Rheinberg, Falko; Krug, Siegbert: Motivationsförderung im Schulalltag. Göttingen 1999, S. 18-20.
[2] Rheinberg, Falko; Krug, Siegbert: Motivationsförderung im Schulalltag. Göttingen 1999, S. 21-22.
[3] Rheinberg, Falko; Krug, Siegbert: Motivationsförderung im Schulalltag. Göttingen 1999, S. 84-85.
[4] Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend: Die erreichbare Ferne Anstrengungsbereitschaft – eine „Tugend“ auf dem Prüfstand!?. http://anwalt-des-kindes.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/anwalt-des-kindes.bildung-rp.de/empfehlungen/empf24.pdf. (Zugriff am 03.07.2011, 17:11).
- Citar trabajo
- Kevin Theinl (Autor), 2011, Lernmotivation und Anstrengungsbereitschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179373