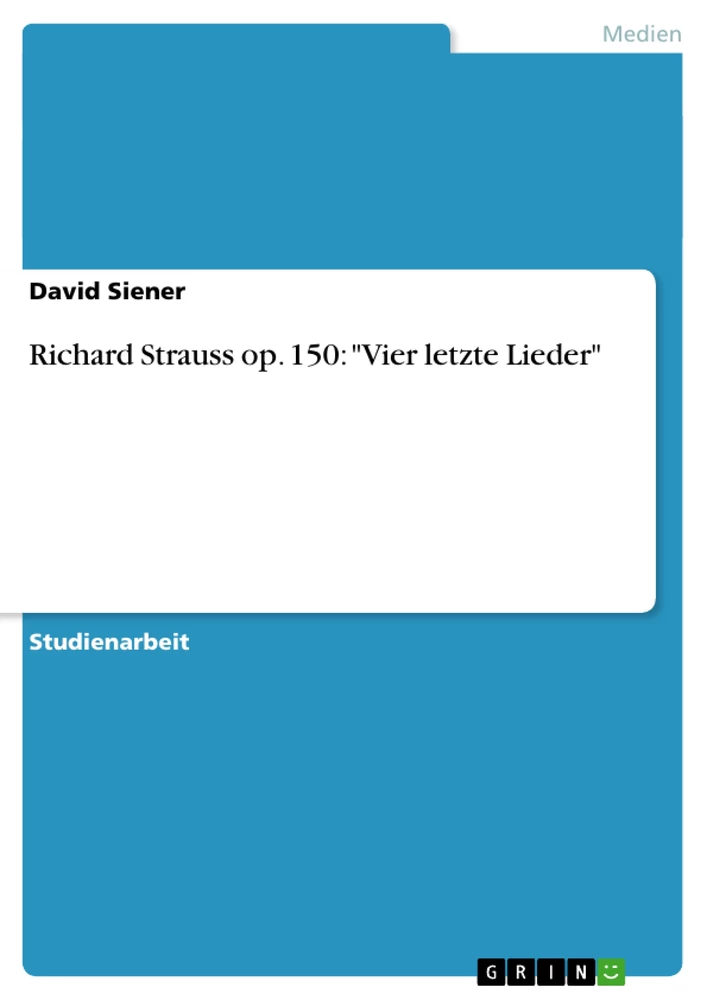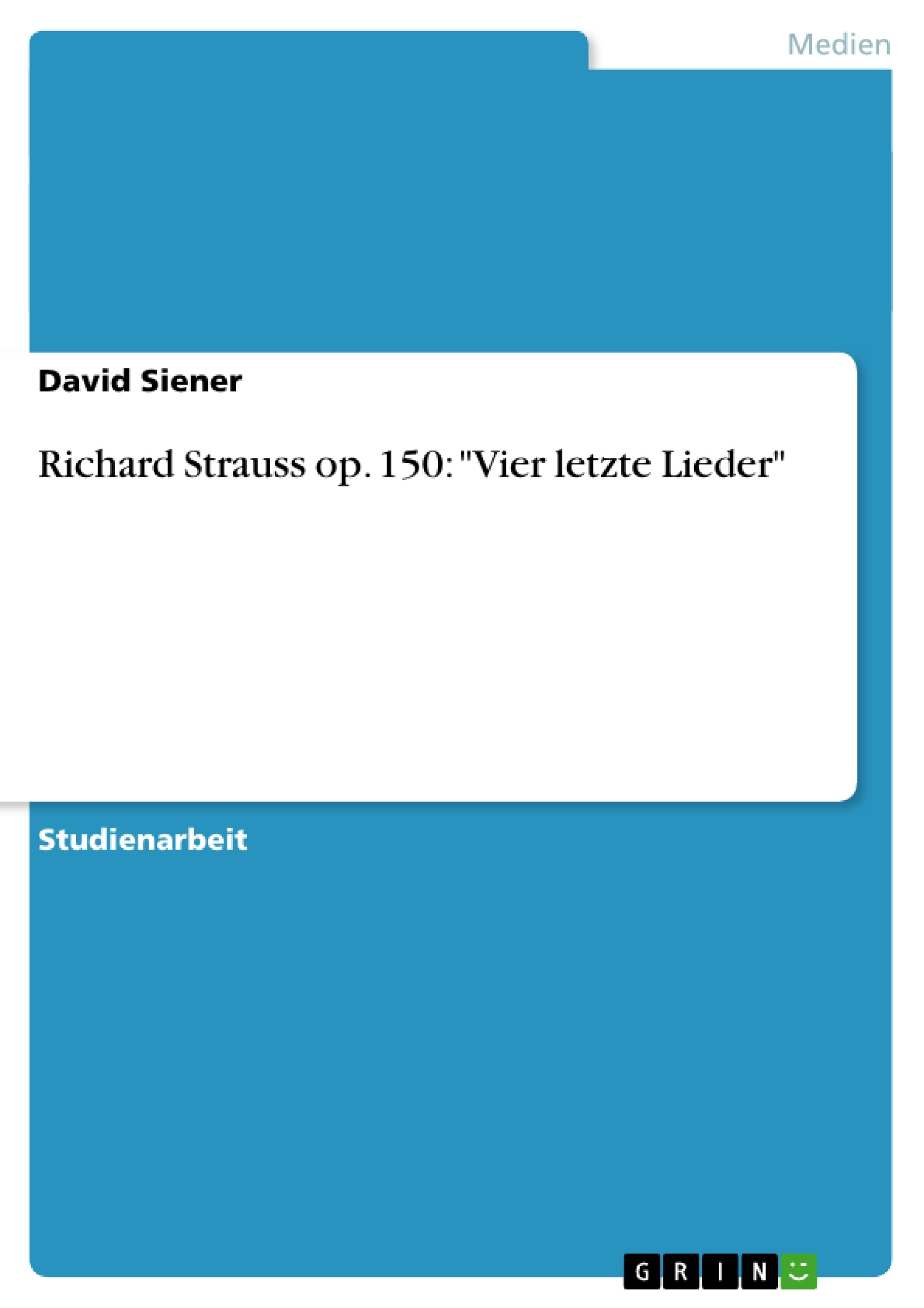Die Kompositionsphase der »Vier letzten Lieder«, die als Richard Strauss’ letztes komplettes Werk anzusehen sind, erstreckt sich vom Ende des Jahres 1946 bis in den September 1948. Geschrieben für Sopran wurde dieser in der Schweiz entstandene Liederzyklus von Strauss von Anfang an mit Orchesterbegleitung konzipiert. Eine Transkription der Lieder für Klavier entstand später durch Max Wolff.
Die Uraufführung der »Vier letzten Lieder« fand am 22. Mai 1950 in der Royal Albert Hall in London unter Wilhelm Furtwängler mit der Solistin Kirsten Flagstad statt. Richard Strauss selbst hat eine öffentliche Aufführung seines Op. 150 also nicht mehr erlebt, er starb bereits am 8. September 1949.
Der Text des Liedes „Im Abendrot“ stammt von Joseph von Eichendorff. Strauss hat bereits Ende 1946 angefangen sich mit diesem Gedicht zu beschäftigen. Bis zur Fertigstellung des Lieds im Mai 1948 bekam Strauss durch einen Verehrer des Dichters Hermann Hesse Gedichte zugesandt, die ihm als Grundlage für die restlichen drei Lieder, „Frühling“, „September“ und „Beim Schlafengehen“, dienen sollten. Die Gedichte Hermann Hesses stammen aus unterschiedlichen Schaffensperioden, stellen im Original also keine Zyklus dar.
Es sollte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass in Strauss’
Hinterlassenschaft Aufzeichnungen zu einem vierten Hesse-Gedicht gefunden wurden, das
den Titel „Besinnung“ trägt. Es ist durchaus vorstellbar, dass Strauss dieses Lied dem Zyklus hinzufügen wollte.
Inhaltsverzeichnis
- Gedichte im Original - Textabweichungen und Kompositionsdaten
- Allgemeines
- Zur Abfolge der Lieder und zur Zyklushaftigkeit
- Analysen
- Frühling
- Text
- Melodik und Motivik
- Harmonik
- September
- Text
- Melodik und Motivik
- Harmonik
- Beim Schlafengehen
- Text
- Melodik und Motivik
- Harmonik
- Im Abendrot
- Text
- Melodik und Motivik
- Harmonik
- Frühling
- Bibliographischer Nachweis
- Notenbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Richard Strauss' "Vier letzten Liedern", op. 150, einem Liederzyklus, der die letzten vier Jahre des Komponistenlebens widerspiegelt. Sie untersucht die Texte, die musikalische Gestaltung und die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Lieder und beleuchtet die Zyklushaftigkeit des Werkes.
- Die Bedeutung der Textauswahl für die Komposition
- Die musikalische Sprache und die kompositorischen Besonderheiten
- Die thematischen Schwerpunkte des Zyklus, wie z.B. Vergänglichkeit, Sehnsucht und Abschied
- Die Beziehung zwischen Musik und Text in den einzelnen Liedern
- Der Einfluss der persönlichen Lebensgeschichte Strauss' auf die Komposition
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Textauswahl des Zyklus und die Beziehungen zwischen Originaltext und Komposition. Es werden auch wichtige Kompositionsdaten zu jedem Lied erläutert. Im zweiten Kapitel werden die Abfolge der Lieder und ihre zyklische Struktur untersucht. Die Kapitel drei und drei-punkt-eins bis drei-punkt-vier befassen sich mit den Einzelanalysen der Lieder. Jedes Lied wird in Bezug auf Text, Melodik und Motivik sowie Harmonik betrachtet.
Schlüsselwörter
Richard Strauss, Vier letzte Lieder, op. 150, Liederzyklus, Textauswahl, Musik und Text, Melodik, Motivik, Harmonik, Vergänglichkeit, Sehnsucht, Abschied, Zyklushaftigkeit
- Quote paper
- David Siener (Author), 2003, Richard Strauss op. 150: "Vier letzte Lieder", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17921