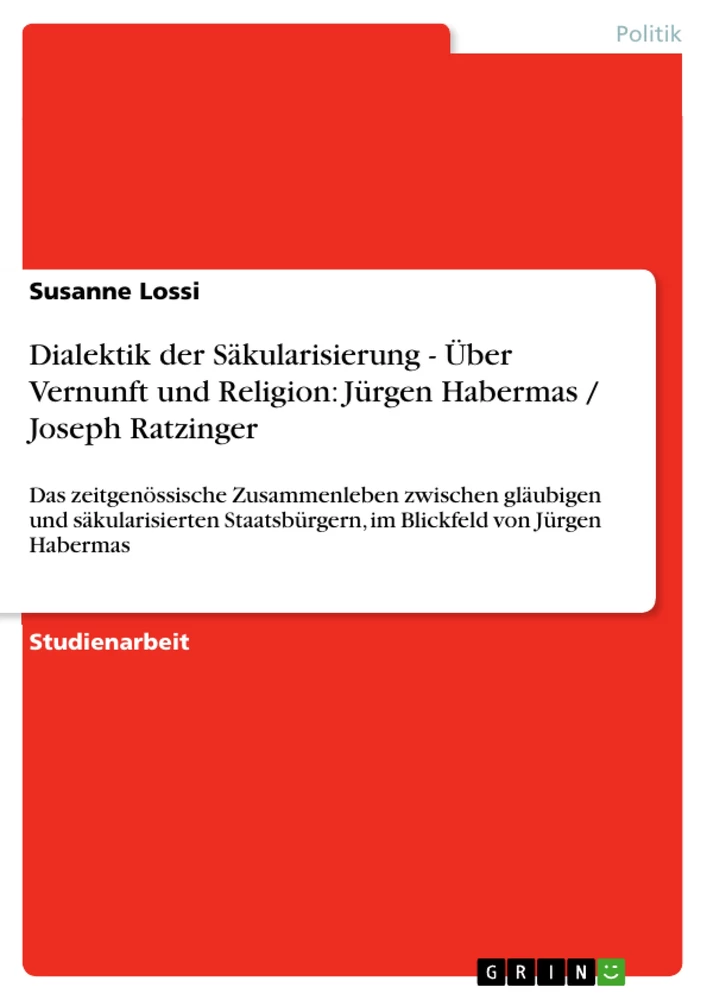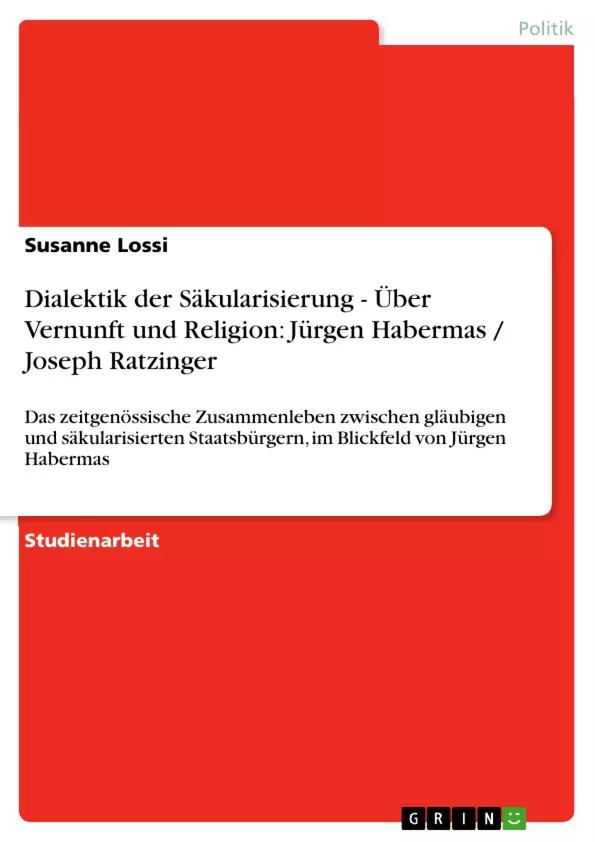„Der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben.“1
Diese Aussage stammt von dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde. Er thematisiert in diesen Sätzen, was es wahrhaftig bedeutet, als Mitglied in einer demokratischen Gemeinschaft zu bestehen und zu leben. Die heutige Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland beruht auf einem Staatssystem, welches seinem Bürger ein Höchstmaß an Freiheit und Selbstbestimmung zugesteht. Es liegt also in der Verantwortung der Bevölkerung diesen scheinbar leeren Raum eigenverantwortlich mit Normen, Werten und Gesetzmäßigkeiten zu füllen. Der Staat selbst verhält sich in diesem Gestaltungsprozess, gegenüber jeglichen Gruppierungen tolerant und vorurteilsfrei. Dies hat zur Folge, dass die liberale Staatsform auf die aktive Beteiligung der Bürger bei der Gestaltung des Regierungssystems, angewiesen ist. Lässt das Volk diese Chance der freiheitlichen Selbstbestimmung jedoch ungenutzt verstreichen, verfällt der Staat in eine Handlungsunfähig- und Machtlosigkeit, gegenüber den politischen Prozessen.
Die Fragestellung, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen wird, ist nicht nur die Suche nach den Voraussetzungen der Entstehung des Rechtes und den daraus folgenden Machtinstrumenten, sondern auch die Problematik des zeitgenössischen Umgangs mit religiösen Fragestellungen in einer säkularisierten Gesellschaft. Auch der Prozess, welcher zu der Entstehung eines säkularisierten Staates mit seinen bestimmten Normen und Werten führt, steht in einer kritischen Betrachtung. Die folgende Arbeit beschäftigt sich, auf der Grundlage dieser Überlegungen, mit der Problematik des bestmöglichen Zusammenleben zwischen gläubigen und säkularisierten Bürgern im Hinblick auf die momentan existierende Alltagssituation in der Bundesrepublik Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Recht, Vernunft und Selbstbestimmung — Die Basis flir einen freiheitlichen interkulturellen und säkularisierten Staat
- Das zeitgenössische Zusammenleben zwischen säkularisierten und gläubigen Staatsbürgern, im Blickfeld von Jürgen Habermas
- Leben wir in einer säkularisierten Gesellschaft?
- Jürgen Habermas- Eine kontrovers diskutierte Persönlichkeit
- „Dialektik der Säkularisierung"
- Die Geschichte der Säkularisierungsbewegung
- säkular, säkularistisch oder postsäkular?
- Von der säkularistischen zur postsäkularen Gesellschaft
- Die Voraussetzungen der Entstehung eines demokratischen Rechtsstaates
- Praktische Vernunft: Die Rechtsquelle des säkularen Verfassungsstaates
- Das „einigende Band" der staatsbürgerlichen Solidarität
- Die Religion im Zeichen der Säkularisierung
- Interkulturelle Zusammenarbeit eruünscht?
- Interkulturelle Integration- Eine Utopie moderner Gesellschaften?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz analysiert das zeitgenössische Zusammenleben zwischen gläubigen und säkularisierten Staatsbürgern in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere aus der Perspektive des Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas. Er untersucht die Voraussetzungen für die Entstehung eines demokratischen Rechtsstaates und beleuchtet die Rolle der Religion in einer säkularisierten Gesellschaft. Der Aufsatz befasst sich mit der Frage, ob wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben und welche Herausforderungen sich aus der postsäkularen Gesellschaftsform ergeben.
- Die Bedeutung von Vernunft und Religion für die Gestaltung eines freiheitlichen Staates
- Die Entwicklung des Säkularisierungsgedankens und seine Auswirkungen auf die Staats- und Gesellschaftsordnung
- Die Rolle der praktischen Vernunft als Rechtsquelle des säkularen Verfassungsstaates
- Die Bedeutung der staatsbürgerlichen Solidarität für die Stabilität eines demokratischen Systems
- Die Herausforderungen der interkulturellen Integration in einer postsäkularen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Aufsatzes stellt die Grundlage für die weitere Argumentation dar, indem er sich mit der Problematik des Zusammenlebens zwischen gläubigen und säkularisierten Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland befasst. Hier wird insbesondere die Frage nach den Voraussetzungen für die Entstehung eines freiheitlichen, interkulturellen und säkularisierten Staates aufgeworfen. Die Ausführungen von Ernst-Wolfgang Böckenförde über die Grenzen des säkularen Staates liefern dabei den Ausgangspunkt für die kritische Betrachtung von Jürgen Habermas.
Im zweiten Kapitel wird die Persönlichkeit und das Werk von Jürgen Habermas näher beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf seiner Schrift „Dialektik der Säkularisierung", in welcher er sich mit dem Verhältnis von Religion und Vernunft in einer postsäkularen Gesellschaft auseinandersetzt. Die Geschichte der Säkularisierungsbewegung und die Abgrenzung der Begriffe „säkular", „säkularistisch" und „postsäkular" liefern die Grundlage für die Analyse des Zusammenlebens zwischen gläubigen und säkularisierten Bürgern im Blickfeld von Jürgen Habermas.
Der dritte Abschnitt befasst sich mit den Voraussetzungen für die Entstehung eines demokratischen Rechtsstaates. Die Ausführungen von Jürgen Habermas über die praktische Vernunft als Rechtsquelle des säkularen Verfassungsstaates und die Bedeutung der staatsbürgerlichen Solidarität für die Stabilität dieses Systems stehen dabei im Vordergrund.
Im vierten Kapitel wird die Rolle der Religion in einer säkularisierten Gesellschaft untersucht. Der Aufsatz beleuchtet die Herausforderungen des Umgangs mit religiösen Fragestellungen im Kontext der Trennung von Kirche und Staat. Die Ausführungen von Jürgen Habermas über die Notwendigkeit einer interkulturellen Zusammenarbeit zwischen gläubigen und säkularisierten Bürgern in einer postsäkularen Gesellschaft liefern dabei den Rahmen für die Analyse.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Dialektik der Säkularisierung, das Verhältnis von Vernunft und Religion, die Entstehung eines demokratischen Rechtsstaates, die staatsbürgerliche Solidarität, die interkulturelle Integration, die postsäkulare Gesellschaft und die Herausforderungen des Zusammenlebens zwischen gläubigen und säkularisierten Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Böckenförde-Diktum im Kontext der Säkularisierung?
Das Böckenförde-Diktum besagt, dass der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben. Er ist auf die moralische Substanz der Bürger angewiesen.
Welche Rolle spielt Jürgen Habermas in der Debatte um Religion und Vernunft?
Habermas untersucht das Verhältnis von Glauben und Wissen in einer postsäkularen Gesellschaft und betont die Notwendigkeit einer gegenseitigen Lernbereitschaft zwischen säkularen und religiösen Bürgern.
Was versteht man unter einer postsäkularen Gesellschaft?
Eine postsäkulare Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die sich auf das Fortbestehen religiöser Gemeinschaften in einer zunehmend säkularisierten Umgebung einstellt und einen öffentlichen Diskurs zwischen beiden Sphären fördert.
Was ist die zentrale Rechtsquelle des säkularen Verfassungsstaates laut Habermas?
Die zentrale Rechtsquelle ist die praktische Vernunft, die es ermöglicht, allgemeingültige Normen unabhängig von religiösen Offenbarungswahrheiten zu begründen.
Warum ist staatsbürgerliche Solidarität für die Demokratie wichtig?
Sie fungiert als das „einigende Band“, das die Stabilität des demokratischen Systems sichert, indem Bürger eigenverantwortlich Normen und Werte in den freiheitlichen Raum einbringen.
Welche Herausforderungen bietet die interkulturelle Integration?
Die Herausforderung besteht darin, ein friedliches Zusammenleben zwischen gläubigen und säkularen Bürgern zu gestalten, ohne die religiöse Identität oder die staatliche Neutralität zu verletzen.
- Citar trabajo
- Susanne Lossi (Autor), 2008, Dialektik der Säkularisierung - Über Vernunft und Religion: Jürgen Habermas / Joseph Ratzinger, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178844