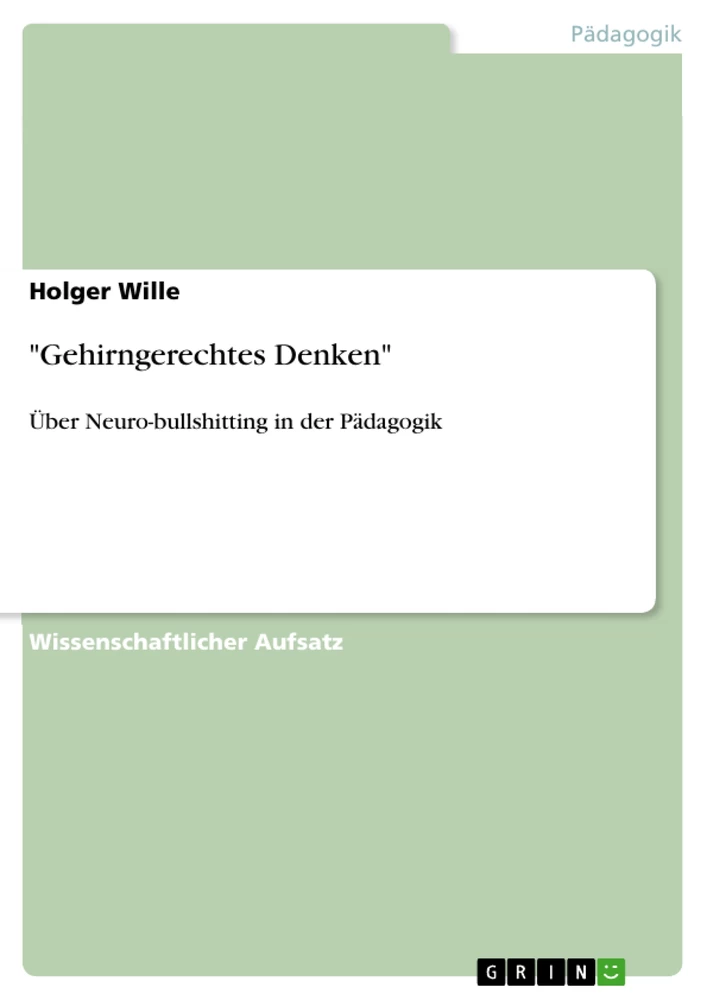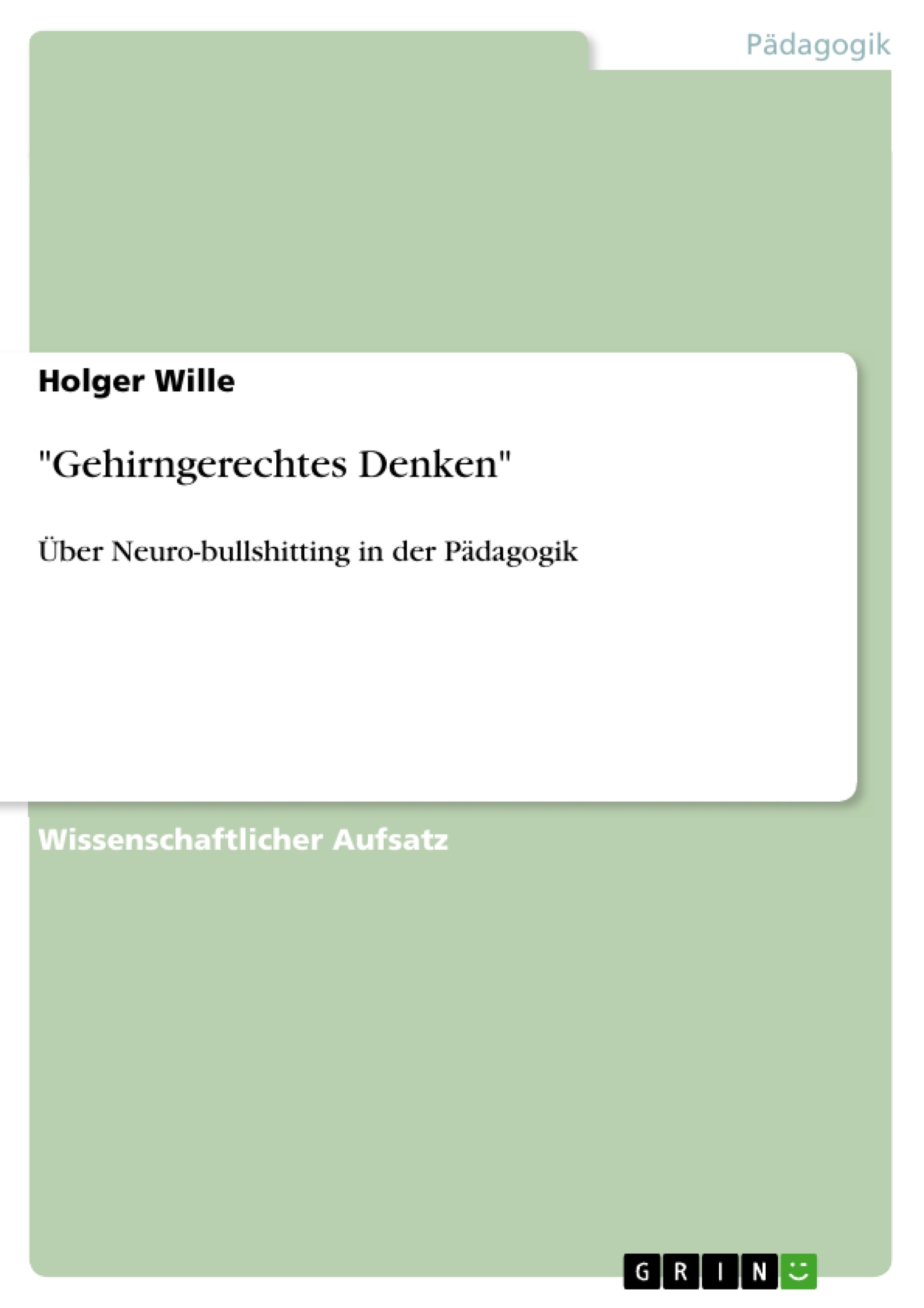Die vorliegende Studie unternimmt eine kritische Würdigung pädagogischer Anknüpfungen an die moderne Hirnforschung.
[...]
Terminologische Distanz gegenüber einem wissenschaftlichen Gegenstand lässt sich auf quantitativem oder qualitativem Wege gewinnen. Beim quantitativen Verfahren wird der Abstand zu einem Phänomen durch zunehmende Abstraktion, d.h. den Rückgriff auf allgemeinere Begriffe erreicht. Bei der qualitativen Methode dagegen wird der Distanzierungsgewinn durch die Wahl anderer Begriffe als der üblich verwendeten erzielt. Ein Beispiel für Verfremdungsversuche dieser Art ist die Wissenschaftsparodie. Wie der Titel gebende Ausdruck “gehirngerechtes Denken” zeigt, fühlen sich die folgenden Überlegungen einer so verstandenen “fröhlichen Wissenschaft” durchaus verpflichtet – nicht als Selbstzweck, sondern vielmehr, um gerade den Ernst der Lage zu berücksichtigen. Damit einige aktuelle Auseinandersetzungen um den menschlichen Zerebral-Apparat nicht noch weiter Opfer fehlenden Sinnes für die eigene Humorlosigkeit werden, muss deshalb anfänglich und leider ausdrücklich darauf hingewiesen werden: Der Neologismus “gehirngerechtes Denken” ist ein Nonsens-Ausdruck! Er ist weder dazu gedacht noch dazu geeignet, einen neuen Topos jener heutigen Neuro-Rhetorik zu begründen, die sich so gerne von sich selbst faszinieren lässt. Man hat diesen Ausdruck deshalb auch sorgfältig in Anführungszeichen zu setzen, die gleichsam als intellektuelle Gitterstäbe fungieren und einen Ausbruch in die freie Wildbahn verhindern sollen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Gehirngerechtes Denken: Ein Nonsens-Ausdruck
- Gehirngerechtigkeit: Appell an wen?
- Gehirngerechtes Lernen: Ein Kategorienfehler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht kritisch den Begriff des "gehirngerechten Denkens" und "gehirngerechten Lernens" im Kontext der Pädagogik. Er analysiert die unzulässige Naturalisierung pädagogischer Fragestellungen durch den Rückgriff auf die Hirnforschung und deckt die logischen Fehler und Unstimmigkeiten in dieser Argumentation auf.
- Kritik am Neuro-Bullshit in der Pädagogik
- Analyse des Kategorienfehlers im Konzept "gehirngerechtes Lernen"
- Unterscheidung von Seins- und Geltungsgebilden
- Die Problematik normativer Aufladung des Gehirnbegriffs
- Die unzulässige Übertragung biologischer Tatsachen auf normative Forderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Gehirngerechtes Denken: Ein Nonsens-Ausdruck: Der Text beginnt mit der Feststellung, dass der Ausdruck "gehirngerechtes Denken" ein Unsinn ist. Er dient als Ausgangspunkt, um die zunehmende Zerebralisierung von Problemen in den Humanwissenschaften, insbesondere in der Pädagogik, zu kritisieren. Der Autor bemängelt den naiven Enthusiasmus, mit dem pädagogische Adaptionen der Hirnforschung betrieben werden und sieht darin eine Delegationsleistung, die den ureigenen Fragestellungen der Pädagogik schadet. Der Rückgriff auf biologische Materialität wird als Versuch interpretiert, der Pädagogik vermeintliche Seriosität und den Status einer "Hard Science" zu verleihen, obwohl die zugrundeliegenden philosophischen und physikalischen Grundlagen fragwürdig sind. Der Autor weist darauf hin, dass viele populäre Begriffe, wie "gehirngerechtes Lernen", "Neuro-Didaktik" und "Gehirn-Jogging", gleichartige logische Mängel aufweisen.
Gehirngerechtigkeit: Appell an wen?: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Begriff der "Gehirngerechtigkeit". Der Autor argumentiert, dass dieser appellative Ausdruck sich an Personen und nicht an Gehirne richtet und somit eine Inkonsistenz aufweist. Die Forderung nach Gehirngerechtigkeit impliziert eine normative Aufladung des Gehirnbegriffs, da nur bestimmte Arten von Gehirnen (normale, gesunde) als Maßstab dienen. Der Text betont, dass Normen nicht vor Gehirnen, sondern durch unser Denken und unsere Vernunft gerechtfertigt werden müssen. Die unreflektierte Übernahme biologischer Erkenntnisse in normative Forderungen wird als problematisch dargestellt. Die Frage, ob Ansprüche, einer bestimmten Tatsache gerecht zu werden, selbst gerechtfertigt sind, wird kritisch diskutiert, um die Willkür solcher Forderungen zu verdeutlichen.
Gehirngerechtes Lernen: Ein Kategorienfehler: Das Kapitel analysiert den Begriff des "gehirngerechten Lernens" und argumentiert, dass die Forderung nach diesem prinzipiell unerfüllbar ist. Der Autor identifiziert einen Kategorienfehler, da dem Gehirn Leistungen zugeschrieben werden (Denken, Lernen), die es prinzipiell nicht erbringen kann. Die Unterscheidung zwischen "Seinsgebilden" (Gehirn als empirischer Gegenstand) und "Geltungsgebilden" (Urteile, Wahrheitswerte) wird eingeführt. Der Text verdeutlicht, dass das Gehirn eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Denken und Lernen ist. Jede Lernleistung ist, aufgrund der biologischen Voraussetzung des Gehirns, bereits "gehirngerecht". Die Forderung nach "gehirngerechtem Lernen" wird als redundantes Postulat und Verstoß gegen die Regeln adäquater Rede bezeichnet. Der Autor illustriert seine Argumentation mit anschaulichen Beispielen und betont, dass eine normative Vorstellung von einem "idealen" Gehirn nur durch Eingriffe in die biologische Hardware realisiert werden könnte.
Schlüsselwörter
Gehirngerechtes Denken, Gehirngerechtes Lernen, Neuro-Pädagogik, Kategorienfehler, Naturalisierung, Normativität, Seinsgebilde, Geltungsgebilde, Hirnforschung, Pädagogik, Kritik, Bullshit.
Häufig gestellte Fragen zu "Gehirngerechtes Denken: Eine kritische Auseinandersetzung"
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text kritisiert den weit verbreiteten Gebrauch von Begriffen wie "gehirngerechtes Denken" und "gehirngerechtes Lernen" in der Pädagogik. Er analysiert die problematische Verbindung von Hirnforschung und Pädagogik und deckt logische Fehler und Unstimmigkeiten in dieser Argumentation auf.
Welche Kritikpunkte werden am Konzept "gehirngerechtes Lernen" geäußert?
Der Text argumentiert, dass "gehirngerechtes Lernen" ein Kategorienfehler darstellt. Dem Gehirn werden Leistungen zugeschrieben (Denken, Lernen), die es prinzipiell nicht selbst erbringen kann. Die Forderung nach "gehirngerechtem Lernen" wird als redundant und unerfüllbar bezeichnet, da Lernen aufgrund der biologischen Voraussetzung des Gehirns bereits "gehirngerecht" ist. Die Unterscheidung zwischen Seinsgebilden (Gehirn) und Geltungsgebilden (Urteile, Wahrheitswerte) wird zur Erklärung herangezogen.
Was versteht der Text unter "Naturalisierung" im pädagogischen Kontext?
Die "Naturalisierung" pädagogischer Fragestellungen beschreibt den Versuch, pädagogische Probleme durch den Rückgriff auf die Hirnforschung zu lösen. Der Text kritisiert dies als unzulässige Übertragung biologischer Erkenntnisse auf normative Forderungen. Er sieht darin eine Delegationsleistung, die den ureigenen Fragestellungen der Pädagogik schadet und ihr eine scheinbare wissenschaftliche Seriosität verleihen soll.
Welche logischen Fehler werden im Text identifiziert?
Der Text identifiziert einen Kategorienfehler im Konzept "gehirngerechtes Lernen", sowie die unzulässige Übertragung biologischer Tatsachen auf normative Forderungen. Die normative Aufladung des Gehirnbegriffs, die implizit in Begriffen wie "Gehirngerechtigkeit" enthalten ist, wird ebenfalls als logischer Fehler kritisiert.
Was ist der Unterschied zwischen Seins- und Geltungsgebilden im Kontext des Textes?
Der Text unterscheidet zwischen "Seinsgebilden" (das Gehirn als empirischer Gegenstand) und "Geltungsgebilden" (Urteile, Wahrheitswerte, normative Forderungen). Die Vermischung dieser Kategorien wird als Quelle der logischen Fehler im Konzept "gehirngerechtes Lernen" identifiziert. Das Gehirn ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Denken und Lernen. Normen und Werturteile beziehen sich auf Geltungsgebilde, nicht auf Seinsgebilde.
Woran richtet sich die Kritik des Textes?
Die Kritik richtet sich gegen den naiven Enthusiasmus, mit dem populäre Begriffe wie "gehirngerechtes Lernen", "Neuro-Didaktik" und "Gehirn-Jogging" in der Pädagogik verwendet werden. Der Text kritisiert die unreflektierte Übernahme biologischer Erkenntnisse in normative Forderungen und die damit verbundene Delegation pädagogischer Fragen an die Hirnforschung.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Gehirngerechtes Denken, Gehirngerechtes Lernen, Neuro-Pädagogik, Kategorienfehler, Naturalisierung, Normativität, Seinsgebilde, Geltungsgebilde, Hirnforschung, Pädagogik, Kritik, Bullshit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst drei Hauptkapitel: "Gehirngerechtes Denken: Ein Nonsens-Ausdruck", "Gehirngerechtigkeit: Appell an wen?" und "Gehirngerechtes Lernen: Ein Kategorienfehler".
- Quote paper
- Dr. Holger Wille (Author), 2011, "Gehirngerechtes Denken", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178626