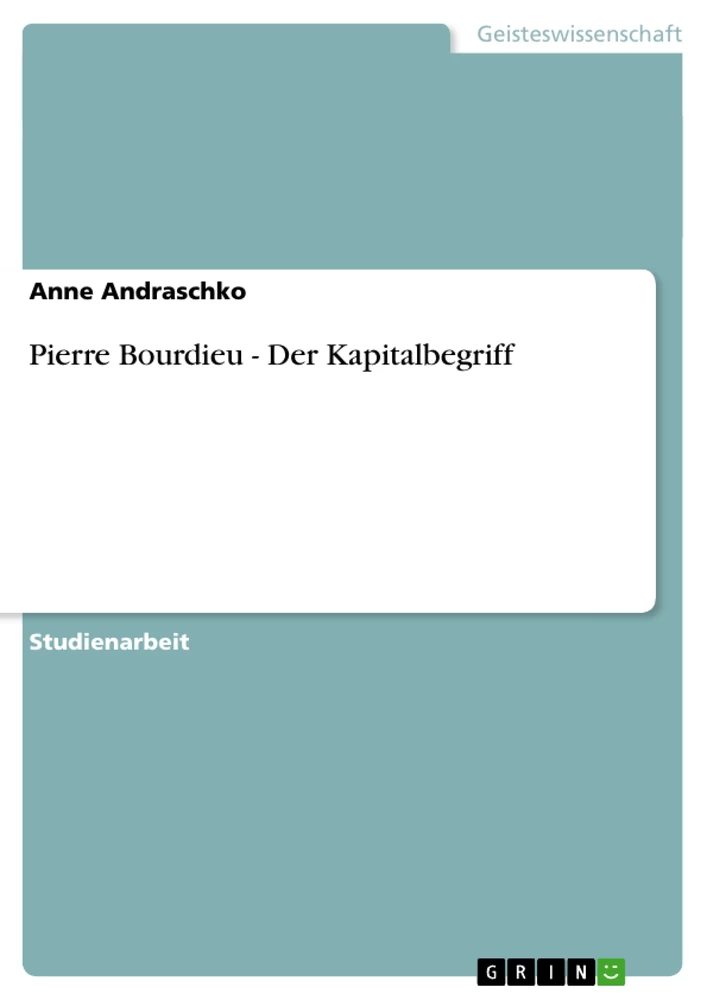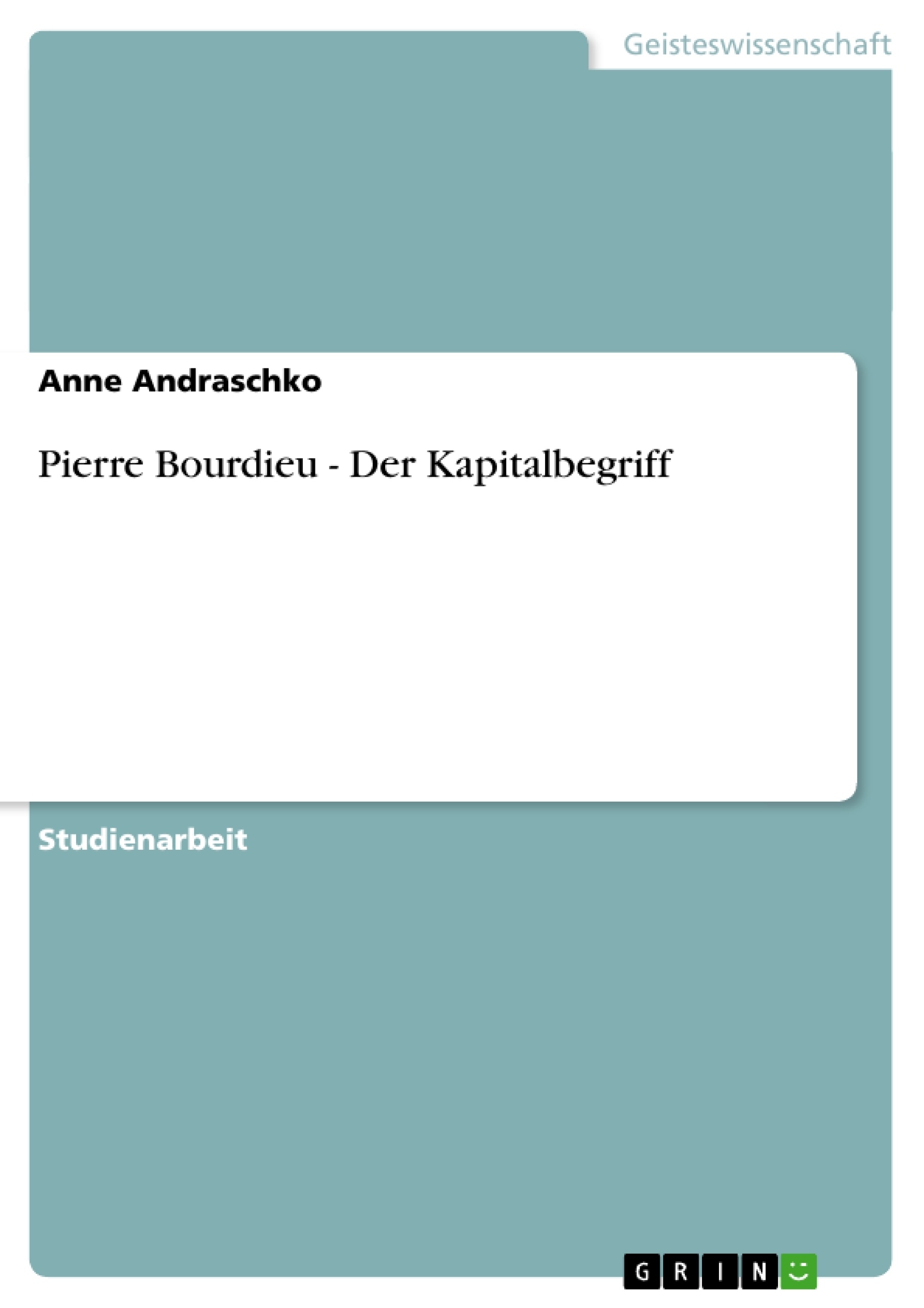Pierre Bourdieu, war ein französischer Soziologe, der Begriffe aus der Soziologie und der Ökonomie, so weiterentwickelte, dass sie eine neue soziologische Theorie ergaben. Er analysierte soziale Ungleichheitsverhältnisse und unterschied hierfür vier Kapitalarten, die nicht immer streng voneinander abzugrenzen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kapitalbegriff
- Das ökonomische Kapital
- Das kulturelle Kapital
- Das inkorporierte Kulturkapital
- Das objektivierte Kulturkapital
- Das institutionalisierte Kulturkapital
- Das soziale Kapital
- Das symbolische Kapital
- Die Kapitalumwandlung
- Kritik am Kapitalbegriff
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Theorie von Pierre Bourdieu und seine Erweiterung des Kapitalbegriffs. Er erläutert die verschiedenen Kapitalarten, die Bourdieu definiert, und untersucht ihre Interaktionen und Umwandlungen. Der Text konzentriert sich auf die Bedeutung des Kapitals für soziale Ungleichheit und die Herausforderungen, die sich aus der Unterscheidung und Vergleichbarkeit der Kapitalarten ergeben.
- Der erweiterte Kapitalbegriff von Pierre Bourdieu
- Die verschiedenen Kapitalarten: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital
- Die Interaktionen und Umwandlungen zwischen den Kapitalarten
- Die Bedeutung des Kapitals für soziale Ungleichheit
- Kritik am Kapitalbegriff und seine Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Pierre Bourdieu als französischen Soziologen vor, der den Kapitalbegriff weiterentwickelte, um soziale Ungleichheitsverhältnisse zu analysieren. Er unterscheidet dabei vier Kapitalarten, die nicht immer streng voneinander abzugrenzen sind.
Das Kapitel "Der Kapitalbegriff" erklärt, wie Bourdieu den Marxschen Kapitalbegriff erweitert, indem er ihn als gesellschaftlichen Ressourcenbegriff versteht, der über das enge ökonomische Verständnis hinausgeht. Dieser erweiterte Kapitalbegriff umfasst alles, was Handlungsmöglichkeiten einrichtet und soziale Positionen verbessern oder bewahren kann. Die verschiedenen Kapitalarten lassen sich untereinander austauschen und ineinander umwandeln.
Das Kapitel "Das ökonomische Kapital" definiert ökonomisches Kapital als die einfachste Form des Kapitals, die in Geld umgetauscht werden kann. Es wird als wichtigstes Kapital im Kapitalismus angesehen und bildet die Basis für die Aneignung aller anderen Kapitalarten.
Das Kapitel "Das kulturelle Kapital" erläutert, wie Bourdieu den Begriff des kulturellen Kapitals als theoretische Hypothese entwickelte, um die Ungleichheit schulischer Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen zu untersuchen. Er untergliedert das kulturelle Kapital in drei Formen: inkorporiertes, objektiviertes und institutionalisiertes Kulturkapital.
Das Kapitel "Das inkorporierte Kulturkapital" beschreibt, wie kulturelles Kapital körpergebunden ist und Verinnerlichung voraussetzt. Der Verinnerlichungsprozess erfordert Zeit und Investition, die nicht durch fremde Personen vollzogen werden kann. Inkorporiertes Kapital ist somit ein fester Bestandteil des Individuums und kann nicht einfach weitergegeben werden.
Das Kapitel "Das objektivierte Kulturkapital" erklärt, wie die Eigenschaften des objektivierten Kulturkapitals nur durch seine Verbindung zum inkorporierten Kulturkapital bestimmt werden können. Objektiviertes Kulturkapital ist materiell übertragbar und setzt entweder ökonomisches oder inkorporiertes Kapital voraus. Es ist ein selbstständiges und zusammenhängendes Ganzes, das seinen eigenen Gesetzen folgt.
Das Kapitel "Das institutionalisierte Kulturkapital" beschreibt, wie biologische Grenzen des inkorporierten Kulturkapitals durch Titel, die das Kulturkapital institutionalisieren, überwunden werden. Titel sind das Produkt der Umwandlung von ökonomischem in kulturelles Kapital und zeigen das erworbene, inkorporierte kulturelle Wissen des Einzelnen.
Das Kapitel "Das soziale Kapital" definiert soziales Kapital als die Gesamtheit der Ressourcen, die mit dem Besitz eines Netzwerks von Beziehungen verbunden sind. Beispiele hierfür sind Gruppen wie Familien, Parteien oder Adelsgruppen. Die Mitglieder dieser Gruppen tauschen materielle und symbolische Ressourcen aus und haben Verpflichtungen aufgrund von subjektiven Gefühlen wie Freundschaft.
Das Kapitel "Das symbolische Kapital" beschreibt das symbolische Kapital als Hyperonym aller Kapitalbegriffe. Es zeigt sich im Prestige, Ruhm und Privilegien der Individuen in der Gesellschaft und hängt von ökonomischem Kapital ab. Umgekehrt lässt sich Prestige auch in ökonomisches Kapital umwandeln.
Das Kapitel "Die Kapitalumwandlung" erläutert, wie alle Kapitalarten mit ökonomischem Kapital erworben werden können. Die Umwandlung erfordert jedoch einen mehr oder weniger hohen Aufwand an Transformationsarbeit und kann mit Kosten oder Risiken verbunden sein.
Das Kapitel "Kritik am Kapitalbegriff" analysiert die Kritik an Bourdieus Kapitalbegriff. Ein Kritikpunkt ist die Ausdehnung des Kapitalbegriffs auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die Ähnlichkeit verschiedener Kapitalarten und die Schwierigkeit der Vergleichbarkeit der verschiedenen Kapitalarten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Kapitalbegriff, soziale Ungleichheit, die verschiedenen Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital), die Interaktionen und Umwandlungen zwischen den Kapitalarten, die Bedeutung des Kapitals für soziale Ungleichheit, Kritik am Kapitalbegriff und seine Auswirkungen.
- Quote paper
- Anne Andraschko (Author), 2010, Pierre Bourdieu - Der Kapitalbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178603