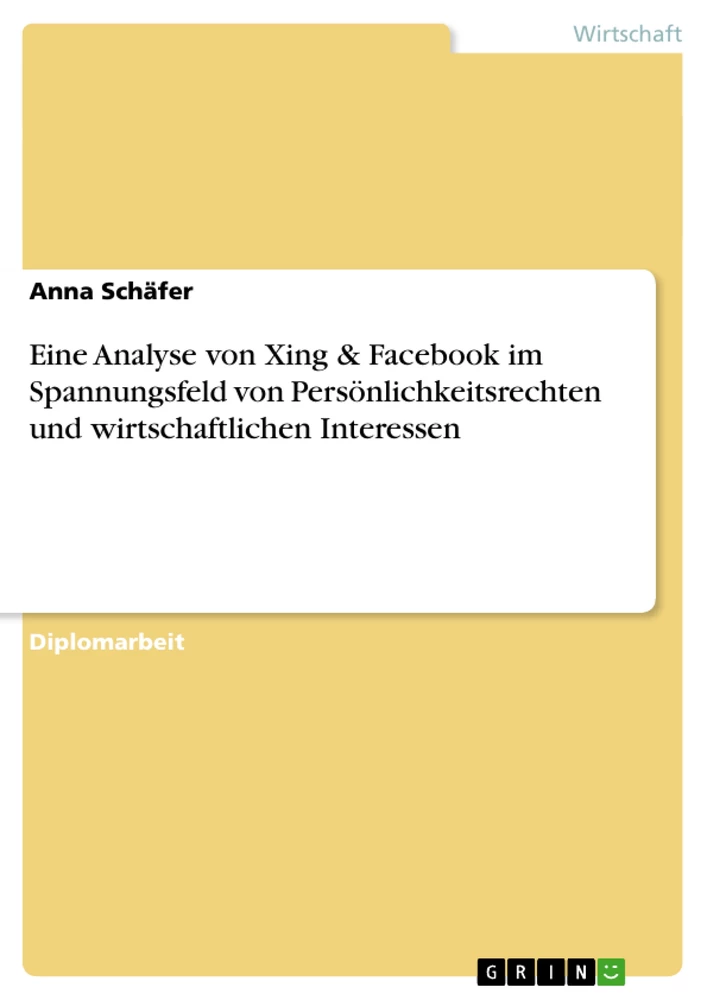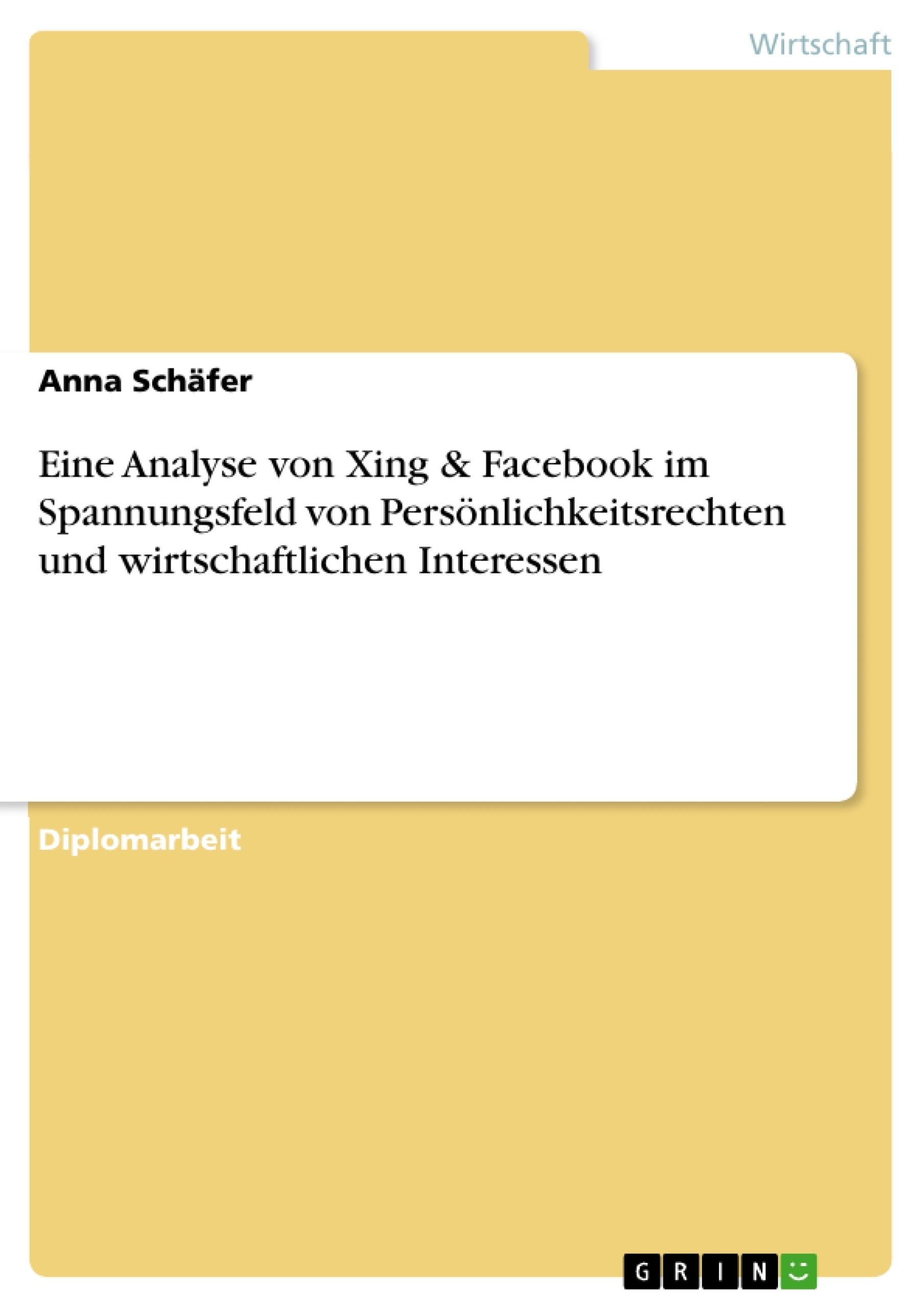Immer wieder gibt es Negativmeldungen bezüglich des Datenschutzes und der Wahrung von Persönlichkeitsrechten im Rahmen der Nutzung virtueller sozialer Netzwerke. Beispielsweise weil es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Nutzerdaten für Werbezwecke verkauft werden oder scheinbar grundlos immer mehr und privatere Informationen über Nutzer abgefragt und gesammelt werden.
Diese Arbeit soll einerseits den Nutzen sozialer Netzwerke für Privatleute, Unternehmen und Wirtschaft und demgegenüber Widersprüche mit Persönlichkeits- und Datenschutzrecht vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Interessen aufzeigen.
Exemplarisch für soziale Netzwerke untersucht diese Arbeit Facebook und Xing.
Diese sozialen Netzwerke wurden gewählt, um die Interessen hinter den Communitys und die Problematik des Persönlichkeitsrechtsschutzes an zwei Plattformen zu untersuchen, die typische Funktionen für soziale Netzwerke beherbergen und aufgrund der Unterschiede bezüglich Zielgruppen, Zweck und Kosten ein weites Feld abdecken.
Überprüft werden soll im Besonderen, ob zivilrechtliche Persönlichkeits- und Datenschutzrechte der Nutzer von sozialen Netzwerken zugunsten von wirtschaftlichen Interessen missachtet werden und ob User dies möglicherweise in Abwägung mit dem Nutzen der Netzwerke tolerieren.
Zunächst werden Facebook und Xing mit ihren einzelnen Bereichen, Zielgruppen und Funktionen genauer vorgestellt, um dem Leser ein Bild von Oberfläche und Funktionen zu vermitteln. Anschließend wird auf spezifische Marketingmöglichkeiten im Web 2.0 eingegangen, die Grund und Ziel für Unternehmen sind, das Internet und soziale Netzwerke im Speziellen für sich zu nutzen. Daher wird dann konkret die Umsetzung der vorgestellten Marketingstrategien in Xing und Facebook behandelt. Um potentielle Eingriffe in Persönlichkeitsrechte messen zu können, ist es vonnöten, die Geschichte und Entwicklung des deutschen Persönlichkeitsrechts zu umreißen. So wird ein Verständnis für das Verhältnis von allgemeinem und besonderen Persönlichkeitsrechten, die Verankerung im Grundgesetz und gesetzliche Grundlagen der zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechte geschaffen. Anschließend werden potentielle Verletzungen zivilrechtlicher Persönlichkeitsrechte durch Social Networks unter dem Einfluss wirtschaftlicher Interessen untersucht. In Kürze wird noch die Anwendbarkeit des deutschen Rechts angesprochen um dann abschließend das Resultat der Arbeit vorzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Gliederung
- A. Einleitung
- I. Thema
- II. Begriffsklärung
- 1. Tagging
- 2. Instant Messaging
- 3. Client
- 4. IP-Adresse
- 5. URL
- 6. Apps/Applikationen
- 7. Personalisierte Werbung
- 8. Plugin
- 9. Gefällt-mir-Button
- 10. Definition Web 2.0
- a) Web 2.0 als Service-Plattform
- b) Web 2.0 als Live Space
- c) Web 2.0 — das Mitmachweb
- d) Web 2.0 - der soziale Raum
- e) Web 2.0 — die intelligente Maschine
- 11. Definition sozialer Netzwerke
- B. Die zu untersuchenden sozialen Netzwerke
- I. Facebook
- II. Xing
- C. Interessen hinter sozialen Netzwerken
- I. Marketingstrategien im Web 2.0 — Marketing 2.0
- 1. Virales Marketing
- 2. Word-of-Mouth-Marketing
- 3. Influencer-Marketing
- 4. Crowdsourcing (Schwarmintelligenz) und Social Commerce
- 5. Long-Tail-Business
- 6. Shop-Spreading
- 7. Suchmaschinen-Optimierung (SEO)
- 8. Social Graph
- 9. Bewertung der Marketingstrategien
- 11. Marketingmöglichkeiten in Facebook und Xing
- 1. Facebook — Aufteilung nach Gebieten
- a) Pages — Profil
- b) Pages — Fanpage
- c) Community Pages
- d) Gruppen
- e) Facebook-Ads
- f) Apps
- g) OpenGraph
- h) Facebook Places
- i) Facebook Deals
- j) Verknüpfung von Facebook mit externen Diensten wie Skype Oder ICQ
- 2. Xing
- a) Privatprofil
- b) Unternehmenspräsentation
- c) Gruppen
- d) Termine
- e) Jobs
- f) Applikationen
- g) Best Offers
- h) Xing Mobile
- i) Verknüpfung mit Xing
- D. Persönlichkeitsrechte
- I. Allgemeines zum Persönlichkeitsschutz
- II. Entstehung des Persönlichkeitsrechts
- III. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Grundrecht
- 1. Träger des APR als Grundrecht
- 2. Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- a) Die Schutzsphären
- (i) Intimsphäre
- (ii) Privatsphäre
- (iii) Sozialsphäre
- (iv) Öffentlichkeitssphäre
- b) Die Darstellung der eigenen Person in der Öffentlichkeit
- c) Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- IV. Staatliche Schutzpflichten
- V. Abwägung Persönlichkeitsrecht gegenüber Freiheitsrechten
- 1. Spannungsverhältnis Persönlichkeitsrecht und Meinungs-, Pressefreiheit, Art. 5 1 GG
- 2. Spannungsverhältnis Rundfunk- und Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht
- 3. Spannungsverhältnis Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit
- E. Zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz im Zusammenhang mit möglichen Verletzungen im Rahmen der Nutzung von Social Networks
- I. Abgrenzung APR als Grundrecht und im Zivilrecht
- II. Entstehung des zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechts
- III. Verhältnis des allgemeinen APR zu den besonders ausformulierten Teilaspekten des Persönlichkeitsrechts im Zivilrecht
- IV. Allgemeines Persönlichkeitsrecht — Inhalt
- V. Träger des zivilrechtlichen APR
- VI. Verletzungen des zivilrechtlichen APR
- VII. Disposition des APR
- VIII. Niederschlag des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im Datenschutzrecht
- 1. Personalisierte Werbung
- a) Facebook
- (i) Verwendung der Nutzerdaten für Personalisierte Werbung auf Facebook
- (ii) Weitergabe an Dritte zum Zwecke der personalisierten Werbung unabhängig von Facebook
- b) Xing
- 2. Applikationen
- a) Facebook
- ( 1 ) Erheben der Daten durch Facebook
- (2) Übermitteln der Daten von Facebook an externe Betreiber von Applications
- (3) Verletzung durch Datenerhebung seitens der App-Betreiber
- (4) Übermitteln an Datensammlungsagenturen
- (5) Betroffenem-echte
- b) Xing
- 3. Der GeRillt-mir-Button
- 4. Facebook Places
- 5. Verknüpfung mit Skype und ICQ
- a) Facebook
- b) Xing
- 6. Status arbeitssuchend bei Xing
- 7. Informationelle Selbstbestimmung als Auffangrecht
- a) 823 BGB
- (aa) Prüfung der Voraussetzungen des 823 BGB
- (bb) Rechtsfolgen
- b) Eingriffskondiktion gem. 812 1 1 Alt. 2 BGB
- IX. Besondere Persönlichkeitsrechte im Zivilrecht
- 1. 12 BGB — das Namensrecht
- a) Inhalt und Bedeutung
- b) Schutzumfang des 12 BGB
- c) Übertragbarkeit der Namensrechtsverletzung
- d) Verletzungen des 12 BGB
- (i) Namensleugnung (Namensbestreitung)
- (ii) Namensanmaßung
- e) Voraussetzung einer Verletzung von \ 12 BGB
- (i) Zuordnungsverwirrung
- (ii) Recht der Gleichnamigen
- (iii) Interessenverletzung
- f) Mögliche Verletzungen des Namensrechts im Zusammenhang mit virtuellen sozialen Netzwerken durch Fakeprofile mit falschen/fremden Namen
- g) Rechtsfolgen einer Namensrechtsverletzung
- h) Sonstige Beeinträchtigungen
- 2. 22 ff. KUG — Recht am eigenen Bild
- a) Inhalt und Bedeutung
- b) Voraussetzungen des 22 KUG
- (i) Bildnis
- (ii) Zurschaustellen
- (iii) Verbreiten
- c) Einwilligung des Abgebildeten undAusnahmen der 23, 24 KUG
- d) Verletzung des KUG durch Onlinestellen von Fotos und durch Verlinken
- e) Rechtsfolgen der Verletzung des Rechts am eigenen Bild
- f) Sonstige Beeinträchtigungen des eigenen Bildes
- 3. 12 ffUrhG — Urheberpersönlichkeitsrecht
- a) Comic-Bilder/Bilder von Prominenten als Profilbild
- b) Links und Zitate im Status Oder als öffentliche Nachrichten
- c) Übertragung von Urheber-/Nutzungsrechten in den AGB
- d) Urheberrechtsverletzung durch Sichtbarkeit in (Personen-)Suchmaschinen
- e) Rechtsfolge von Verletzungen des Urheberpersönlichkeitsrechts
- F. Anwendbarkeit des deutschen Rechts
- G. Zusammenfassung
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse virtueller sozialer Netzwerke im Spannungsfeld von Persönlichkeitsrechten und wirtschaftlichen Interessen. Am Beispiel von Xing und Facebook werden die Funktionsweisen der Plattformen, die dahinterstehenden Marketingstrategien und die potentiellen Verletzungen des Persönlichkeitsrechts durch die Nutzung der Netzwerke untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des deutschen Persönlichkeitsrechts, die verschiedenen Schutzbereiche und die Abwägung mit anderen Grundrechten wie der Meinungs- und Pressefreiheit. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dessen Verletzung durch die Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung von Nutzerdaten durch die Plattformbetreiber.
- Entwicklung und Bedeutung des deutschen Persönlichkeitsrechts
- Marketingstrategien im Web 2.0 und deren Anwendung in sozialen Netzwerken
- Potentielle Verletzungen des Persönlichkeitsrechts durch soziale Netzwerke
- Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutzrecht
- Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichen Interessen und Persönlichkeitsrechten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und definiert die relevanten Begrifflichkeiten wie Tagging, Instant Messaging, Client, IP-Adresse, URL, Apps/Applikationen, personalisierte Werbung, Plugin, Gefällt-mir-Button und Web 2.0. Anschließend werden die beiden zu untersuchenden sozialen Netzwerke Facebook und Xing vorgestellt, wobei ihre Funktionen, Zielgruppen und Bereiche näher beleuchtet werden.
Das Kapitel C. widmet sich den Interessen hinter sozialen Netzwerken, wobei die verschiedenen Marketingstrategien des Web 2.0 wie virales Marketing, Word-of-Mouth-Marketing, Influencer-Marketing, Crowdsourcing, Long-Tail-Business, Shop-Spreading, Suchmaschinen-Optimierung, Social Graph und die Bewertung der Marketingstrategien behandelt werden. Anschließend werden die Marketingmöglichkeiten in Facebook und Xing im Detail erläutert.
Im Kapitel D. wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Grundrecht und dessen Entstehung im deutschen Recht dargestellt. Die verschiedenen Schutzbereiche des Persönlichkeitsrechts, darunter die Intimsphäre, Privatsphäre, Sozialsphäre, Öffentlichkeitssphäre, die Darstellung der eigenen Person in der Öffentlichkeit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, werden detailliert beschrieben. Die Arbeit beleuchtet auch die staatlichen Schutzpflichten und die Abwägung des Persönlichkeitsrechts gegenüber anderen Freiheitsrechten wie Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit.
Kapitel E. beschäftigt sich mit dem zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz im Zusammenhang mit Social Networks. Die Abgrenzung zwischen dem verfassungsrechtlichen und dem zivilrechtlichen Persönlichkeitsrecht wird erläutert, die Entstehung des zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechts dargestellt und das Verhältnis zu den besonderen Persönlichkeitsrechten im Zivilrecht beleuchtet. Der Inhalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wird detailliert beschrieben und die Träger des zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechts definiert. Im weiteren Verlauf werden mögliche Verletzungen des zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechts durch Social Networks untersucht.
In Kapitel VIII. wird der Niederschlag des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im Datenschutzrecht behandelt. Die relevanten Vorschriften des Telemediengesetzes (TMG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden vorgestellt und die Problematik der personalisierten Werbung, der Applikationen, des Gefällt-mir-Buttons, von Facebook Places, der Verknüpfung mit Skype und ICQ sowie des Status "arbeitssuchend" bei Xing im Hinblick auf das Datenschutzrecht untersucht. Es werden die verschiedenen Formen der Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung durch die Plattformbetreiber analysiert und die Betroffenenrechte erläutert.
Das Kapitel IX. widmet sich den besonderen Persönlichkeitsrechten im Zivilrecht, insbesondere dem Namensrecht nach 12 BGB und dem Recht am eigenen Bild nach 22 ff. KUG. Die Arbeit befasst sich mit dem Inhalt und der Bedeutung dieser Rechte, den Schutzbereichen, den Voraussetzungen für eine Verletzung, den möglichen Verletzungsformen und den Rechtsfolgen. Abschließend wird das Urheberpersönlichkeitsrecht nach 12 ffUrhG in Bezug auf Social Networks behandelt.
Im Kapitel F. wird die Anwendbarkeit des deutschen Rechts auf die behandelten Fälle kurz beleuchtet. Die Arbeit geht auf die Problematik der extraterritorialen Anwendung des deutschen Rechts auf Facebook ein und diskutiert die Bedeutung des Safe Harbor Abkommens.
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit bezüglich der Problematik des Datenschutzes in sozialen Netzwerken. Die Arbeit zeigt, dass insbesondere Facebook große Lücken im Datenschutz aufweist, während Xing sich weitgehend an das geltende deutsche Datenschutzrecht hält. Die Arbeit betont die Bedeutung des bewussten Umgangs mit persönlichen Daten im Internet und die Notwendigkeit einer stärkeren Sensibilisierung der Menschen für Datenschutzbelange.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen virtuelle soziale Netzwerke, Persönlichkeitsrechte, wirtschaftliche Interessen, Datenschutz, Facebook, Xing, Marketingstrategien, Web 2.0, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Datenschutzrecht, Telemediengesetz (TMG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Namensrecht, Recht am eigenen Bild, Urheberpersönlichkeitsrecht, Anwendbarkeit des deutschen Rechts, Social Media Marketing, gläserner Internetnutzer, Datenschutzbelange.
Häufig gestellte Fragen
Welches Spannungsfeld untersucht diese Arbeit bei Xing und Facebook?
Die Arbeit analysiert den Konflikt zwischen der Wahrung von Persönlichkeitsrechten der Nutzer und den wirtschaftlichen Interessen (z.B. Datenverkauf, Marketing) der Plattformbetreiber.
Was ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung?
Es ist ein Grundrecht, das dem Einzelnen die Befugnis verleiht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.
Welche Marketingstrategien werden in sozialen Netzwerken genutzt?
Behandelt werden unter anderem virales Marketing, Influencer-Marketing, Social Graph Analysen und personalisierte Werbung (Targeting).
Wie unterscheiden sich die Zielgruppen von Facebook und Xing?
Während Facebook eher auf private Vernetzung und Freizeit ausgelegt ist, fokussiert sich Xing primär auf berufliche Kontakte und Business-Netzworking.
Welche rechtlichen Gefahren bestehen beim Tagging oder Verlinken?
Es können Verletzungen des Rechts am eigenen Bild (§ 22 KUG) oder des Namensrechts (§ 12 BGB) vorliegen, wenn Personen ohne Einwilligung markiert werden.
- Quote paper
- Anna Schäfer (Author), 2011, Eine Analyse von Xing & Facebook im Spannungsfeld von Persönlichkeitsrechten und wirtschaftlichen Interessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178477